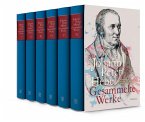Höltys Gedicht »Üb immer Treu und Redlichkeit« gehört zum Kanon der deutschen Lyrik.Von den Mitgliedern des »Göttinger Hain« ist Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748-1776) der bedeutendste Lyriker. Die Ausgabe enthält sämtliche Gedichte in den Fassungen der Handschriften sowie der rezeptionsgeschichtlich wichtigen Drucke in den Musenalmanachen und den von Johann Heinrich Voß besorgten Gedichtausgaben der Jahre 1783 und 1804. Unter den Prosaschriften werden die Aufsätze »Leben des Petrarca« und »Leben der Laura« erstmals vollständig gedruckt. Der Briefwechsel und eine Sammlung von Dokumenten zu Höltys Leben bieten einen faszinierenden Einblick in das kurze Leben des Dichters, der sich trotz schwerer Krankheit als überraschend humorvoller Zeitgenosse erweist.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ludwig Christoph Heinrich Hölty dichtet · Von Ernst Osterkamp
Zu den Opfern der Goethe-Rezeption und eines missverstandenen Goethe-Kults gehören alle großen deutschen Lyriker des achtzehnten Jahrhunderts von Haller und Hagedorn bis hin zu Hölty, dem begabtesten Zeitgenossen des jungen Goethe. Zwischen ihnen und uns liegt als eine gewaltige Rezeptionsschranke das lyrische Werk Goethes, an dem das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert ihren Begriff vom Lyrischen ausgebildet haben. Selbst auf die Sprachwunder der Oden Klopstocks, ohne die die Gedichte des jungen Goethe nicht zu denken sind, lassen sich nur noch Spezialisten ein - schon deshalb, weil Klopstock ohne Theologie nicht zu haben ist.
Man muss es in dieser Situation einer Verarmung des literarischen Kanons begrüßen, dass Ludwig Christoph Heinrich Höltys schmales Werk in einer wunderschönen Neuausgabe wieder zugänglich ist. Der Name Höltys (1748 bis 1776) fällt gemeinhin nur noch im Zusammenhang mit dem "Göttinger Hain", dem am 12. September 1772 gegründeten Dichterbund juvenil-begeisterter Klopstock-Verehrer. Und doch, wie einsam steht die melancholische Gestalt Höltys auch in dieser Freundesrunde, deren bedeutendstes lyrisches Talent er ist. Zöge man den Beitrag Höltys ab, so bliebe die dichterische Produktion des "Göttinger Hain" im Wesentlichen nur als historisch merkwürdiges Zeugnis literarischer Gruppenbildung interessant.
Keiner hat die Sonderstellung Höltys in diesem Kreis und seine dichterische Originalität aus der Kraft eines empfindenden Herzens stärker gespürt als Georg Christoph Lichtenberg, der das "rasende Odengeschnaube" der Klopstock-Epigonen verabscheute. Am 28. Januar 1775 schrieb er an seinen Freund Dieterich, den Verleger des "Göttinger Musenalmanachs": "Herr Hölty ist, meines Erachtens, ein wahres Dichter-Genie . . . Mich dünkt, so wie Hölty zuweilen zu dichten, dazu gehört natürliche Anlage, allein wie die meisten übrigen, weiter nichts, als daß man ein Vierteljahr ähnliche Werkchen liest."
So eng sich Hölty auch an den Themenkatalog der empfindsamen Lyrik hielt, so wenig dichtete er nach der modischen Schablone, und selbst wenn er sich einmal auf den Bardenton seiner Bundesbrüder - "Braga zum Gruß!" - einließ, so verfeinerte er doch deren Bardengebrüll zum zarten Bardengelispel. Hölty habe, so schrieb in ihren Lebenserinnerungen die Freundin Charlotte von Einem, das "kleine Entzücken" seiner Briefe, "in dem allerhäßlichsten Körper die schönste Engelseele" besessen. Im Gedicht fand diese Engelseele das Medium, in dem sie sich auszusprechen vermochte.
Dabei besaß Hölty, wie schon seine Freunde wussten, bei allem Hang zur "süßen Schwermut", die seine Gedichte besangen, auch eine entschiedene "Anlage zum Drollichten" (so Johann Martin Miller, der Verfasser des in Höltys Todesjahr erschienenen Bestsellers "Siegwart, eine Klostergeschichte"). In Romanzen aus dem Geiste des Studentenulks hat er antike Mythen mit übermütigem Witz travestiert und es dabei auch nicht verschmäht, seine eigene Dichterrolle zu ironisieren; so in der Romanze "Narcias und Echo": "Er gab dem Bache Kuß auf Kuß. / So liebt' er, wie Poeten, / Ein Ideal, fern vom Genuß / Und den Realitäten." In gleicher Weise parodierte er die modischen Bardengesänge, und auch seine Balladen zeichnen sich durch einen abgründigen Witz aus. Höltys "Töffel und Käthe" trägt übrigens als erstes deutsches Gedicht die Gattungsbezeichnung "Ballade".
Aber im Schatten des heiligen Sängers Klopstock wuchs auch bei Hölty der Anspruch an das eigene Dichtertum, und so entsagte er der komischen Poesie: "Die comische Muse ist nicht für den ernsten denkenden Deutschen, wollte der Himmel, daß wir gar keine comische Dichter hätten, sie entnerven die Sprache." Fortan dominierte in seinem lyrischen Werk jener elegische Ton, der es berühmt machte. Natürlich hat auch er wie alle Dichter seit Hagedorn die Freude als den Affekt der aufgeklärten Geselligkeit besungen, aber wie es um die Fähigkeit des schüchternen und einfältig wirkenden Hölty, sich zu freuen, tatsächlich stand, hat sein Freund Johann Heinrich Voß in einer rührenden Anekdote erzählt. Er berichtet über Höltys Reaktion auf die Nachricht, dass Klopstock nach Göttingen kommen werde: "Er hatte sich bisher ganz ruhig, mit dem Butterbrod in der Hand, auf dem Stuhle gewiegt; mit einmal stand er auf, und bewegte sich langsam und stolpernd auf der linken Ferse herum. Was machst du da, Hölty? fragte ihn einer. Ich freue mich! antwortete er lächelnd."
Wer sich so apollinisch freut, dem stehen die dionysischen Erregungen seiner Zeitgenossen, der Stürmer und Dränger, fern. Nichts hat Hölty so geliebt, nichts so häufig besungen wie die Freuden des Landlebens; in der Ruhe fernab vom Treiben der Städte und ihrer sittlichen Verwilderungen wird er "ganz Wollust, ganz Gefühl". In der Betrachtung der Natur und ihrer Schönheiten, zumal wenn sie im Lichte des Zentralgestirns der Empfindsamkeit, des silbernen Mondes, liegen, entfaltet sich jene sanft schwärmerische und halb melancholische Stimmung, die den Grundton der Höltyschen Lyrik bildet. Da blickt er auf Blumen, Bäume und Bach mit "verschlingendem Wonneblick" und träumt von reizenden Mädchen - aber ach, von ihnen träumt er nur, denn die "Seligkeit der Liebe", die er noch in seinem Todesjahr in schönen Versen besungen hat, sie war ihm nicht beschieden.
Das Schlüsselwort für die Lyrik Höltys, in der sich alle Wahrnehmungen in sanfte Empfindung verwandelt, lautet "Busen"; in fast jedem seiner Gedichte taucht es, oft mehrfach variiert, auf. Der Busen ist der Sitz der lieblichen Gefühle, und andere als liebliche Gefühle, gar Leidenschaften, hat sich der Dichter Hölty versagt. Und dennoch: Oft genug träumt der Einsame von einer fernen oder künftigen Geliebten, und dabei führt ihm seine Einbildungskraft immer wieder eines "Busens Silberschleyer" vor Augen, der doch mehr und anderes verbirgt als nur liebliche Empfindungen: "Und ich zerfloß in Entzückungsschauer."
"Trunken an ihrer weißen Brust entschlummern / Und im Traume mit ihrem Busen tändeln", das war es, was er sich von der künftigen Geliebten erhoffte, und da zeigt sich denn, dass Empfindsamkeit doch mehr ist als nur die Kommunikation sanfter Seelen. Hölty schreibt eben Oden nicht nur "An den Mond", sondern auch "An einen schönen Busen", und beides hat sehr viel miteinander zu tun. Der sanfte Hölty hat jedenfalls die Qualen der Liebe gut gekannt, wie der kurz vor seinem Tode entstandene Entwurf der Ode "An eine Nachtigall, die vor meinem Kammerfenster sang" zeigt: "Sie trinkt voll Gier von unserem Herzensblute, / Und schwelgt sich satt; / Giebt Dornen dem, der sonst auf Rosen ruhte, / Zur Lagerstatt." Kein Wunder, dass der strenge Rudolf Borchardt 1926 diese Verse in seinen "Ewigen Vorrat deutscher Poesie" aufgenommen hat.
"Der Tod ist dein Brautführer", diesen ungeheuerlichen Satz hatte Johann Heinrich Voß schon am 15. Mai 1775 an Hölty geschrieben, als dieser noch hoffte, von der Schwindsucht genesen zu können. Die Briefe der letzten Jahre sprechen von der Qual des todkranken Dichters, der Morgen für Morgen Blut und Eiter auswirft und sich mit Übersetzungsarbeiten ebenso tapfer wie mühsam über Wasser hält. "Es sind hier magre unpoetische Zeiten", schrieb Hölty wenige Monate vor seinem Tode, "so mager, wie die magern Kühe des Pharao, oder wie ich jezt selber bin."
Walter Hettche hat das lyrische Gesamtwerk Höltys, das der Dichter diesen unpoetischen Zeiten abtrotzen konnte, eine Auswahl aus den Übersetzungen des überaus sprachbegabten Hölty und seine Briefe in einer kritischen Studienausgabe zusammengefasst, die mustergültig ist. Hölty hat unablässig an seinen Gedichten gefeilt und sie auch, den Produktionsbedingungen im "Göttinger Hain" entsprechend, dem kritischen Urteil seiner Freunde zur Verbesserung überlassen. So existieren viele seiner Gedichte in verschiedenen Fassungen, ohne dass der Dichter einer von ihnen den Vorzug gegeben hätte. Hettche hat hieraus die richtige Konsequenz gezogen und nicht eine Fassung ausgewählt, um die anderen in den kritischen Apparat zu verbannen, sondern die verschiedenen Fassungen als "Variationen über ein Thema" in den Textteil aufgenommen; weniger bedeutende Varianten werden im Kommentar verzeichnet. Man lernt viel über empfindsames Dichten, wenn man diese Variationen vergleicht.
Deutscher Biedersinn hat sich Höltys Vers "Üb' immer Treu und Redlichkeit, / Bis an dein kühles Grab" so sehr zu eigen gemacht, dass er dessen Dichter vergaß. Der bescheidene Hölty hatte sich gewünscht, man möge nach seinem Tode seine "kleine Harfe" zur Erinnerung "hinter dem Altar" aufhängen - die kleine Harfe des Elegikers, nicht die große des Epikers, der zu werden ihm sein Schicksal versagte. Nun ist, was die "goldenen Saiten" dieser kleinen Harfe erklingen ließen, in einem Bande wieder zugänglich.
Ludwig Christoph Heinrich Hölty: "Gesammelte Werke und Briefe". Kritische Studienausgabe. Herausgegeben von Walter Hettche. Wallstein Verlag Göttingen 1998. 598 S., geb., 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main