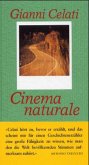Ein selbsternannter Hygieneinspektor untersucht Hinterhöfe mit Brunnen. Dort wohnen die Mondköpfe, schrullige Leute, die unerhörte Geschichten erzählen (und veranstalten).Ein Roman voller Geschichten von Menschen, die sich für normal und andere für verrückt halten, und umgekehrt. Zugleich ein höchst amüsanter Bericht über das Fehlen einer Weltanschauung und die alte Frage: Wie virtuell ist die Wirklichkeit?»Gesang der Mondköpfe« ist Cavazzonis erster Roman: er war die Vorlage für Fellinis poetischen Film »Die Stimme des Mondes«.

Knorpelig: Ermanno Cavazzonis Reprisen der Romantik
"Man glaubt, es könne nicht anders sein und als habe man bisher nur in der Welt geschlummert." So beschrieb einst der Dichter Novalis die Wirkung eines "echt romantischen Buches". Ermanno Cavazzoni, geb. 1947, hält sich offenbar gern an derlei Rezepte der Altvordern. Denn in diesem Werk, das nur mühsam eine vage Handlungsfolge entwickelt, geht es nicht um die Reproduktion vertrauter Wirklichkeiten, sondern um "Abenteuer" des inneren Empfindens, um Traumvisionen, phantastische Ausflüge und Metamorphosen des erzählenden Ichs. Hier und da wird dem Leser klargemacht, daß auch der moderne Autor nur in der Reflexion seiner selbst, nur in einem Text, der sich selbst allegorisch als Poesie deklariert, souveräne Gesten der Freiheit inszenieren kann.
Daß die Verwandlung des Autors in den Märchenhelden dabei auf die Dauer Erzählhaltungen verkrampfter Naivität und intellektueller Dürftigkeit fördert, läßt sich kaum leugnen und macht die Lektüre von Cavazzonis Arabesken oft zur argen Geduldsprobe. Denn was hier in einer phantastischen Landschaft seelischer Wünsche und Anfechtungen ausgebreitet wird, präsentiert sich allzu häufig nur als literarische Reprise, als Verkettung angejahrter Motive und als - manchmal immerhin ingeniöse - Nacherzählung des bereits Erzählten. Dazu gehört auch der böse, der verfremdende Blick der Hauptfiguren. In ihren Augen vollzieht sich soziales Handeln in einer Theaterkulisse, die nur sinnloses Rollenspiel erlaubt.
Jenseits dieser belanglosen Alltagsprosa läßt sich eine zweite Realität entdecken. Sie eröffnet sich dem Wasserinspektor Savini, der die Poebene durchstreift und es vor allem auf Wasserlöcher abgesehen hat. Aus den alten Brunnen holt er Rätselhaftes herauf, kümmert sich auch um Spukgestalten, Mären und Sagen, die von einer bedrohlich wirkenden Zone unterirdischer Mächte künden. Sie wirken nicht nur in der Tiefe, sondern verkörpern sich auch koboldhaft an und in Wasserleitungen. Nach Auskunft eines Totengräbers ist selbst die Hölle eigentlich im Gewirr von Abflußrohren anzusiedeln. "Der tiefe Brunnen weiß es wohl", schrieb einst Hofmannsthal in einem Gedicht. Welches "Weltgeheimnis" in Cavazzonis Wasserspielen umspült werden soll, bleibt im verborgenen.
Kein Wunder also, daß der Autor seinen teils raunenden, teils neckischen Vorlieben für die feuchte Unterwelt bald den Rücken kehrt. Savini findet im "Präfekten" Gonella einen mondsüchtigen Gefährten, ja Vorgesetzten, dessen Haß auf die kleinstädtischen Zeitgenossen nur noch durch seine Ordnungssucht und seinen Verfolgungswahn übertroffen wird. Was sich die Protagonisten mitzuteilen haben, betrifft vor allem "geheimnisvolle Gegenden mit unbekannten fremden Völkern". Cavazzoni kultiviert mit Vorliebe variationsreiche Vorgänge der "Grenzüberschreitung". Wer dies nicht sofort begreift, wird vom Autor darauf gestoßen: in der Geschichte Alexanders von Makedonien. In dessen Neugier spiegelt sich das Verlangen nach einer Schwerelosigkeit des Bewußtseins, in der sich aus dem "Getümmel von Träumen" eine Welt mit seltsamen Bewohnern erhebt. Hier wohnen Zweisprachler, Blutegel, Stichbohrer, Zweifler und auch eine Gattung von Wesen, die den Autor verständlicherweise besonders bedrängen. "Im Land der Erinnerung, wo nichts verlorengeht" hausen nämlich die "knorpeligen Wiederholer", also offenbar Vertreter jener Spezies von zweifelhafter Kreativität, die "alles nachsagt, was man denkt, auch wenn es keinen Sinn hat".
Gegenüber solch anzüglichen Symbolisierungen kann sich Cavazzoni glücklicherweise in Gestalt seines Erzählers manchmal in Dorfkneipen flüchten oder auch bäuerlich-bukolisches Gelände durchstreifen. Savini darf sich hier als glücklicher Imitator diverser Vogelstimmen betätigen: "In meinem Kopf war nun schon eine ganze Vogelkolonie." Immerhin beschränkt sich der Text nicht auf die Lautmalerei des Krähens, Flötens und Zwitscherns, sondern deutet allerlei Ambivalenzen des Savini widerfahrenen Liebesglücks an. Das geliebte Huhn, das eigentlich ein Hahn ist, kontrastiert dabei augenfällig jener Ehefrau des früheren Gesprächpartners Nestor, die sich beim Liebesakt fatalerweise immer in ein Dampfroß verwandelte.
Indem die Kapitel dieses Buches sich so von einem bizarren Einfall zum anderen schleppen, soll nur ein Thema variiert werden: die Autonomie des Träumers und Poeten, der sich einer feindlichen Umwelt gegenübersieht. Deshalb läuft alles am Ende auf eine Entscheidungsschlacht zu, aus der Gonella in die Luft entweicht und Savini wie ein Märchenprinz erwacht: "Also muß ich im ganzen genau einen Monat weg gewesen sein . . ." Endlich stellt er die Frage: "Wozu rede ich eigentlich? Das heißt, am Schluß sagt man nicht einmal mehr das; man hat schließlich einfach nichts mehr zu sagen . . ." Daß dieser skeptische Befund auf den Autor zutrifft, wird man nicht ohne weiteres zugeben. Cavazzonis Stärken werden auch in diesem eher ärgerlichen Buch durchaus sichtbar. Sie offenbaren sich in knappen Geschichten und phantastischen Fabeln, die - in sich abgerundet - auf die größte Erzählform des Romans gar nicht angewiesen sind. Mit Genuß kann sich der Leser zum Beispiel die Perspektive eines Gartenbesitzers in Waterloo zu eigen machen, dem die hin- und herwogenden Truppen kostbare Pflanzen zertreten und der, von aller Kenntnis abgeschnitten, im militärischen Getümmel nichts anderes entdecken kann als die jeweilige Bestrafung für solch barbarische Rücksichtslosigkeit.
Sollte Cavazzoni einst in den Poetenhimmel kommen, wird ihn an der Pforte eine Gruppe namhafter Vorgänger begrüßen, an ihrer Spitze E. T. A. Hoffmann. "Mein lieber Cavazzoni", könnte er sagen, "daß sich in der scheinbar geordneten Welt der Bürger ein Reich des Traums und der Poesie ausbreitet, habe ich schon weitaus packender und bedrohlicher geschildert als Du in Deinem Roman. Ich begrüße Dich als späten Nachkommen, muß aber feststellen, daß postmoderne Epigonalität leider nur passagenweise den Glanz des Originellen ausstrahlen kann." WILHELM KÜHLMANN
Ermanno Cavazzoni: "Gesang der Mondköpfe". Roman. Aus dem Italienischen übersetzt von Marianne Schneider. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1996. 293 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main