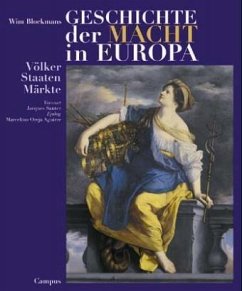In diesem opulent ausgestatteten Werk gibt der niederländische Historiker Wim Blockmans einen anschaulichen Überblick über die europäische Geschichte. Er untersucht die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Machtsysteme des vergangenen Jahrtausends, die der Entwicklung Europas ihre einzigartige Dynamik verliehen.

Europa ist heute nicht mehr die Christenheit: Was die Einigung des Kontinents für die Mediävistik bedeutet
Um Mariä Lichtmeß 956 traf am Hof Ottos des Großen in Frankfurt am Main ein Gesandter 'Abdarrahmans III. ein, des muslimischen Herrschers von Córdoba. Recemund war Westgote der Herkunft nach und Christ, der Arabisch ebenso zu sprechen verstand wie Latein. Er sollte die seit Jahren stagnierenden Verhandlungen mit Otto wiederaufnehmen, durch die der wichtigste muslimische Fürst des Kontinents ins Gefüge der europäischen Politik vordringen wollte. 'Abdarrahman hatte dafür gute Gründe; zwar war es ihm gelungen, seinen Staat zu stabilisieren, der im Spannungsfeld von Islam, Christentum und Judentum eine große Vielfalt kultureller Gruppierungen zu integrieren hatte, doch bedrängten ihn von Nordafrika her die schiitischen Fatimiden. Seine Glaubensbrüder hatten sogar ein Kalifat errichtet und ihn gezwungen, um seiner Selbstachtung willen den Emir-Titel seiner Vorfahren ebenfalls mit dem Namen des Kalifen zu vertauschen.
Unmittelbare Konflikte drohten den verfeindeten Muslimen wegen konkurrierender Aspirationen auf Italien und die Küste der Provence. Otto der Große war zweifellos der geeignete Partner 'Abdarrahmans; er hatte in den zwei Jahrzehnten seiner Regierung die Dominanz über das westfränkische Reich und über Burgund gewonnen, die beide ans Mittelmeer grenzten, und war überdies 951 Herrscher in Italien geworden. Wie richtig der Kalif von Córdoba die Lage der europäischen Politik eingeschätzt hatte, zeigte sich, als Recemund in Frankfurt eintraf. Otto hatte nämlich im Sommer zuvor die Ungarn bei Augsburg entscheidend geschlagen und wurde von seinen Anhängern bereits wie ein Kaiser verehrt; den Rang des sächsischen Königs auf dem Thron Karls des Großen unterstrich auch die Gegenwart anderer Sendboten, die im Auftrag des Papstes in Rom und des Kaisers von Konstantinopel unterwegs waren.
Recemunds Interesse fand aber vor allem ein Mann aus Italien, ein Höfling wie er selbst im Dienst eines fremden Herrn und von ebenso ungewöhnlicher Bildung. Dieser Diakon aus Pavia namens Liudprand stammte aus bestem langobardischen Haus, hatte die Hofschule des Königs Hugo besucht und war im Dienst von dessen Nachfolger Berengar auf Gesandtschaftsreise in Konstantinopel gewesen. Spätestens bei dieser Legation hatte er Griechisch gelernt und sich mit der Kultur des byzantinischen Reiches auseinandergesetzt. Im Zerwürfnis von Berengar geschieden, hatte er bei Otto Aufnahme gefunden, ein Paradiesvogel unter mäßig kultivierten Sachsen. Das Gespräch der beiden Intellektuellen muß anregend gewesen sein, denn zuletzt erbat sich Recemund von Liudprand einen Bericht über "die Taten der Kaiser und Könige aus ganz Europa". Offenbar traute der Mozaraber dem Langobarden im Dienst des künftigen Westkaisers den Überblick über Lage und Geschichte des Kontinents zu, und das Ergebnis mochte seinem Herrn politisch ebenso nützlich werden wie ihm selbst neue Horizonte öffnen.
Liudprand indessen begann mit der Schrift erst zwei Jahre später, als der diplomatische Kontakt zu keinem greifbaren Resultat geführt hatte. Sein Werk blieb Fragment, auch wenn der Verfasser nicht nur Zeitgeschichte schrieb, sondern zwei Generationen zurückgriff, er beschränkte sich aber auf die Verhältnisse im Reich nördlich und südlich der Alpen und auf Byzanz, so wie es seinem eigenen Erfahrungsraum entsprach. Konsequent hat er deshalb seine Abhandlung einleitend nur als Buch über die "Könige und Fürsten eines Teils von Europa" bezeichnet.
Was Liudprand mißlang - eine Geschichte ganz Europas zu verfassen -, glückte im Mittelalter auch keinem anderen Autor, ja es ist zweifelhaft, ob es je einer wieder versucht hat. Zwar schrieb man Weltgeschichten und Reichschroniken, die Geschichten von Adelshäusern, Bistümern, Abteien und schließlich auch von Städten, aber Europa ist nie ein Gegenstand der Historiographie geworden. "Europa" war zwar bekannt als Name eines der drei Kontinente neben Afrika und Asien, aber Geographie und Geschichte blieben verhüllt im Nebel, den mancher hier und da durchstieß, aber niemand wirklich aufhellen mochte. Der Raum zwischen dem Weltganzen und dem eigenen Lebensbereich entzog sich unter christlichen Vorzeichen jeder heilsgeschichtlichen Deutung und damit der historischen Dignität, er mußte unbeachtet bleiben. Pointiert gesagt, gab es keine Europaidee des Mittelalters, sondern die Europaidee löste das Mittelalter ab (Rudolf Hiestand).
Auch wenn auf die Formierung von Europabegriff und Europaidee im Humanismus schon bald die erste "Geschichte Europas" folgte (1566), entdeckt die Geschichtswissenschaft ihre Europäisierung erst im Zeichen der wirtschaftlichen und politischen Integration unserer Zeit als Desiderat. Der Diagnose von Winfried Schulze, daß "eine wirklich europäische Geschichte bislang nicht existiert", kann dabei auf zweierlei Weise begegnet werden: durch eine sowohl international wie interdisziplinär angelegte Forschungsstrategie und durch neue Synthesen, also durch Darstellungen der europäischen Geschichte. Vor allem den Historiographen kommt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung einer transnationalen Geschichtsbetrachtung zu, sind sie doch ständig zur Vermittlung zwischen kritisch dargebotener Vergangenheit und Geschichtsbildern des Publikums, seinen Werturteilen über die Gegenwart und seinen Hoffnungen für die Zukunft gezwungen.
Den Mediävisten scheint sich auf diesem Feld ein großer Ermessensspielraum zu eröffnen, eben weil "Europa" durch die Wahrnehmung der mittelalterlichen Menschen selbst kaum vorherbestimmt ist. Dieser Eindruck täuscht aber, denn tatsächlich ist die Mittelalterforschung bislang eng an eine besondere Tradition der Wissenschaftsgeschichte gebunden, die den Blick auf Europa bestimmt oder sogar einschränkt. Mediävistik ist die Wissenschaft vom lateinischen Europa; von allem Anfang an bezieht sie sich auf ein "Mittelalter", das in einem progressiv konzipierten Geschichtsverlauf zwischen Antike und Neuzeit steht. Sie wird ergänzt durch die Slawistik und die Byzantinistik für Ost- und Südosteuropa, durch die Islamwissenschaft für die muslimischen Herrschaften in Spanien und in Italien, schließlich auch durch die Judaistik für die wechselnden Siedlungen der Juden. Vom "Mittelalter" kann im Hinblick auf diese Bereiche aber nur uneigentlich und in Analogie die Rede sein. Denn wo es keine Antike gegeben hat, kann es streng genommen auch kein Mittelalter geben; und wo die Tradition der lateinischen Sprache und römischen Kultur verschüttet oder gar nicht rezipiert wurde, gab es keine der für Mittelalter und Neuzeit so bezeichnenden Renaissancen. Versteht man aber unter ihrem Gegenstandsbereich den Raum der Völker, die heute zu Europa gehören wollen, dann droht der Mediävistik der Verlust der Definitionsmacht für jene Zeit, die wir Mittelalter nennen.
Die Ereignisse von 1989/90 haben die politischen Diskussionen um die künftige Gestalt Europas wiederbelebt und auch den Historiographen die Frage nach der Wahrnehmung Europas neu gestellt. Soll man, vereinfacht gesagt, Europa als Wertegemeinschaft verstehen, die in unserem Jahrhundert Nordamerika eingeschlossen hat, oder als Raum, den Kulturen heterogener Ursprünge und divergenter Entwicklungslinien entscheidend prägten? Im Sinne der These von der "Western civilization" hat der Neuhistoriker Hagen Schulze kürzlich eine entschlossene Antwort gegeben: "Osteuropa muß Westeuropa werden." Was das Mittelalter angeht, spiegelt sich das Problem in der Bewertung Karls des Großen. Schon in einem großen Gedicht über die Begegnung Karls mit Papst Leo III. im Sommer 799 in Paderborn wird der Frankenkönig als pater Europae bezeichnet, und auch andere Zeitgenossen suchten mit dem Bezug auf Europa einen angemessenen Ausdruck für Karls Herrschaft und Reich. In Anspielung auf solche Epitetha feierte noch die große Ausstellung des Europarats in Aachen 1965 Karl als den "ersten Kaiser, der Europa zu vereinen wußte". Einer der international bekanntesten Mediävisten jener Jahre evozierte das Bild Karls als "das eines kraftvollen Staatsmannes und siegreichen Eroberers, der dem fränkischen Reich den größten Teil von Mittel- und Osteuropa fest eingegliedert hat" - ein erstaunliches Urteil, wenn man bedenkt, daß das Karlsreich über Elbe und Donau im Osten nicht hinausgereicht hat.
In der neueren Forschung ist freilich klargestellt worden, daß der Autor des Karlsepos keineswegs einen Begriff von Gesamteuropa hatte und auch die anderen Lobredner des Kaisers lediglich die Unterwerfung der Sachsen und Awaren sowie die Erweiterung des Frankenreiches nach Italien und Spanien hinein ins Auge faßten. Trotzdem bietet sich Karl der Große bis heute als Bezugspunkt europapolitischer Aspirationen an, zumal der große Herrscher ja als Reformer im Bildungswesen wahrhaft Grundlegendes für die europäische Kultur geleistet hat. Doch wie weit darf die Vereinnahmung Karls gehen? Dieser Frage wird sich das vom 15. bis zum 18. März in Leipzig stattfindende achte Symposion des Mediävistenverbandes unter dem Titel "Karl der Große und das Erbe der Kulturen" widmen. Bereits am 31. Januar, drei Tage nach Karls Todestag, hatte der Bundespräsident im Aachener Dom die Staatsoberhäupter von Ungarn, Slowenien, Rumänien, Bulgarien und Mazedonien um sich versammelt. Der ungarische Präsident sagte in seinem Festvortrag, kraft ihrer Geschichte gehörten die mitteleuropäischen Staaten zur Einheit der europäischen Völker; das Bemühen um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union sei ein Gebot der Stunde. Man kann die Frage stellen, ob in diesem Zusammenhang der Dom Karls zum Symbol der europäischen Einheit taugt, wenn doch einige der betreffenden Staaten für die prägende Zeit ihrer Geschichte der griechisch-orthodoxen, nicht der lateinischen Christenheit angehört haben? Doch gerade für die Ungarn wurde der Aachener Dom im Spätmittelalter zum wichtigen Pilgerziel. 1999 und 2000 sind jedenfalls Jahre der Karlsjubiläen. Welches Karlsbild werden die Paderborner Ausstellung zur Erinnerung an das Treffen von 799 und die Aachener Feiern zur Vollendung der Pfalzkapelle und zur Kaisererhebung vor 1200 Jahren präsentieren?
Schon die letzte Generation der Mittelalterforscher war sich darüber im klaren, daß das Karlsreich mit Europa nicht identisch war, doch galt es oft als Voraussetzung für die Entstehung eines Europa, das von der Vielfalt der Nationen geprägt sei. Als Zerfallsprodukte des Reiches rückten in dieser Perspektive Frankreich und Deutschland in den Vordergrund, die - entsprechend der Wirklichkeit des europäischen Einigungsprozesses - als die Kernländer Europas angesehen wurden. In jüngerer Zeit greift man weiter zurück als bis zu Karl dem Großen und sieht statt in der großen Persönlichkeit und statt im Imperium in den kollektiven Vorgängen der Völkerwanderung und in der Pluralität der daraus entstehenden Staaten die Ursprünge Europas. Vehement hat diese Auffassung etwa Jacques Le Goff vertreten. Seit dem vierten Jahrhundert habe sich ein erster Entwurf Europas auf zwei Grundlagen abgezeichnet: Da gab es einerseits die Gemeinschaft des Christentums, geformt von Religion und Kultur, andererseits die vielförmigen Königreiche, die auf eingeführten ethnischen oder alten multikulturellen Traditionen gegründet waren. Das sei die Vorwegnahme des Europas der Nationen gewesen.
Le Goffs Auffassung schließt die Verbindung von Latinität und Christentum als das Fundament Europas ein; das lateinische Christentum sei geradezu mit dem mittelalterlichen Europa identisch. Andererseits setze die Mehrzahl der Königtümer in "Europa" die Ablehnung theokratischer Macht voraus, wie sie den byzantinischen Osten und erst recht den Islam kennzeichne. Auch das westliche Kaisertum Karls des Großen oder Ottos I. wird in dieser Sicht abgewertet; das karolingische Reich gilt Le Goff lediglich als Episode und als Etappe bei der Errichtung Europas. Der Teilungsvertrag von Verdun 843 und seine Korrekturen unterstrichen indessen die Vorwegnahme eines politischen Europa voller Erfolge und Konflikte: "Das Paar Frankreich-Deutschland beginnt sich klarer abzuzeichnen." Einen neuen Schub für das mittelalterliche Europa hat die zweite Welle der Christianisierung ab dem zehnten Jahrhundert gebracht; mit ihr "treten der Christenheit oder Europa, denn beides stimmt nun überein, zwei neue Gruppen von Europäern bei: die Skandinavier und die Slawen". Russen und Serben will der französische Mediävist jedoch nicht zu Europa rechnen. Andererseits werden die muslimischen Reiche in Europa als Fremdherrschaft empfunden; das christliche Europa habe seine Unabhängigkeit erst 1492 mit der Wiedereroberung Granadas vollendet.
Abgesehen von der Völkerwanderung, diskutieren die Mediävisten gegenwärtig vor allem über das Hochmittelalter als entscheidende Zeit für die "Entstehung Europas" im Sinne einer relativ einheitlichen westlichen Kultur. Unter verschiedenen anderen Konzepten fand besonders das Denkmodell "Revolution" viel Zustimmung, wenn es darum ging, das elfte bis vierzehnte Jahrhundert zu charakterisieren. Man spricht von "Agrarrevolution", "Handelsrevolution", "Stadtrevolution", "demographischer Revolution" und so weiter, in Deutschland vorsichtiger von "Aufbruch" oder "Wende". Die Historiker lassen sich gefangennehmen vom beschleunigten wirtschaftlichen und sozialen Wandel der Zeit sowie von einer im Frühmittelalter noch unbekannten horizontalen Mobilität. Diese Dynamik erinnert an die Moderne, und bisweilen wurde das Hochmittelalter geradezu als Aufbruch zur Moderne aufgefaßt.
Der Ursprung der Auffassung liegt schon in den Debatten westeuropäischer Intellektueller der Zwischenkriegszeit. Als um 1920 der Erste Weltkrieg als Weltrevolution verstanden wurde, avancierte Revolution zu einem Dauerthema von Literaten und Wissenschaftlern. In dieser Zeit verfaßte auch der Mediävist Eugen Rosenstock-Huessy sein Werk über die europäischen Revolutionen; demnach soll von der "Papstrevolution" Gregors VII. und Innozenz' III. eine ununterbrochene Folge von Revolutionen bis hin zur Oktoberrevolution ausgelöst worden sein. Rosenstock wirkt bis heute nach, besonders in der englischsprachigen Mediävistik. In dieser Tradition steht das Werk von Robert Bartlett über die Entstehung Europas im Sinne einer "zunehmend homogenen europäischen Gesellschaft" westlicher Prägung. Bartlett will zeigen, daß Kolonisierung, Eroberung und Staatenbildung in den Randzonen des Altsiedellandes beziehungsweise im östlichen Mittelmeerraum durch Adel und Rittertum eine "Europäisierung Europas" selbst bewirkt hätten.
Geographisches Zentrum für die Ausbreitung der besonderen Kultur mit Hilfe von Eroberung und Beeinflussung seien Frankreich, das Deutschland westlich der Elbe und Norditalien gewesen, Gebiete also, die auf eine gemeinsame Geschichte als Teile des karolingischen Reiches zurückblickten. Das Ergebnis des Kolonisations- und Expansionsprozesses lasse sich jedoch nicht mit dem Modell von Zentrum und Peripherie bestimmen. Beim hochmittelalterlichen Kolonialismus sei es nämlich nicht um die Unterordnung der "neuen" Gebiete unter die Kernländer gegangen, sondern um Replikation der angebotenen Kultur. Bartlett spricht denn auch nicht von einem Differenzierungs-, sondern von einem Nachahmungsprozeß. Andererseits habe sich die Kultur der lateinischen Christenheit durch den Vorgang ihrer Ausbreitung selbst verändert und homogenisiert. Bartletts Buch nimmt den Leser leicht gefangen, doch beruht seine Suggestion weniger auf den zahlreichen neuen Beobachtungen als auf seiner unilinearen Anlage. Das einseitige, geradezu kausalistische Geschichtsbild läßt kaum Raum für Varianten des historischen Prozesses, geschweige denn für die Wahrnehmung gegenläufiger Entwicklungen und Wechselwirkungen. Und soll man wirklich akzeptieren, daß Europa, wie die deutsche Ausgabe behauptet, aus "dem Geist der Gewalt" entstanden sei?
Nur langsam bewegt sich die Geschichtswissenschaft auf eine Historiographie Europas im ganzen zu. Einen interessanten Versuch, wenigstens die letzten tausend Jahre mit einem Konzept zu erfassen, das Einheit wie Vielfalt des Kontinents gleicherweise Rechnung trägt, hat der niederländische Spätmittelalterhistoriker Wim Blockmans unternommen. Das Buch ist aus einem Projekt der European Science Foundation von 1987 hervorgegangen, das den Anfängen des modernen Staates zwischen dem dreizehnten und achtzehnten Jahrhundert auf die Spur kommen wollte. Blockmans hat diesen Ansatz aber in zweifacher Hinsicht überschritten: Einmal, indem er die Thematik bis zur Gegenwart weiterführte, wie es ihm "die Rolle des Historikers in dieser Gesellschaft" zu gebieten schien. Zum anderen hat der Verfasser der Einsicht Rechnung getragen, daß die Dynamik der europäischen Geschichte mit Staatengeschichte allein nicht eingefangen werden könne; für die europäische Geschichte sei es geradezu kennzeichnend, daß sich staatliche Einflußzonen mit anderen Machtzentren nicht deckten, so daß durch diese Divergenzen und Disproportionen der historische Prozeß immer wieder angestoßen worden sei.
Der stark typologisierende Zugriff des Autors, der ja auch nur einen Aspekt der Geschichte behandeln wollte, hat eine geschlossene historische Darstellung nicht begünstigt. Jacques Santer, der als Präsident der Europäischen Kommission das Buch zum vierzigsten Jahrestag des Vertrags von Rom entgegennehmen konnte, hat aber zu Recht in seinem Vorwort die weite Perspektive von Blockmans herausgehoben: Auch wenn die Ursprünge Europas im Zusammentreffen der Romanen, Germanen und Slawen zu suchen seien, habe doch auch die arabische Welt, "besonders im Mittelalter", die europäische Zivilisation angereichert, und andere Völker im Abseits, wie Magyaren und Finnen, seien später hinzugekommen.
Unter den Europa-Historikern der Gegenwart, die René Girault gewiß viel zu gering nach hundert Köpfen bemißt, hat nur Norman Davies in Oxford den Mut aufgebracht, eine umfassende Geschichte des Kontinents von der Prähistorie bis zur Gegenwart zu schreiben. Sein Werk ist völlig zu Recht als ein "abenteuerliches, ein grandioses Projekt" gewürdigt worden (Hagen Schulze), denn es markiert die äußerste Grenze dessen, was Europa-Historiographie derzeit zu leisten vermag; wegen seiner eminenten Zeitgemäßheit zwingt es freilich auch alle betroffenen Disziplinen, darunter die Mediävistik, zur Überprüfung ihrer Zukunftsentwürfe.
Davies hat sein Buch als hervorragend ausgewiesener Osteuropahistoriker verfaßt; dementsprechend wendet er sich scharf gegen die These von der "Western civilization" sowie gegen jeden Eurozentrismus. Osteuropäischen Begebenheiten wollte er schon deshalb einen angemessenen Raum geben, weil die Slawen die größte der ethnischen Familien Europas seien. Und "ein Land wie Polen mag sehr verschieden von Deutschland oder England sein; aber die polnischen Erfahrungen kommen denjenigen von Irland oder von Spanien näher als das, was viele westeuropäische Länder miteinander verbindet. Ein Land wie Griechenland, von dem manche gesagt haben, es sei westlich wegen der Wirkungen von Homer und Aristoteles, ist zur Europäischen Gemeinschaft zugelassen worden; aber seine prägenden Erfahrungen in der Moderne hat es in der Orthodoxie unter ottomanischer Herrschaft gemacht." Durch den Kunstgriff seiner Textmontage hält er die Konstrukthaftigkeit der Erzählung, die Unerreichbarkeit des historischen Ganzen und die unaufhebbare Diversität der europäischen Geschichte ständig präsent. Die offene Form des Werkes sollte aber vor allem der Lage Europas am 14. Februar 1992 entsprechen, dem ausführlich geschilderten letzten Tag der Niederschrift. Es sei ganz ungewiß, ob die europäische Bewegung der neunziger Jahre Erfolg haben werde oder scheitere; europäische Geschichte zu schreiben sei aber eigentlich erst möglich, wenn das Ergebnis feststehe. Ein vorläufiger Versuch wie der seine müsse ohne einen Mythos von Europa auskommen, doch werde es vielleicht später einmal möglich sein, ein überzeugendes neues Bild von Europas Vergangenheit zu komponieren, das auch neue Hoffnungen für Europas Zukunft freisetze. Europäische Geschichtsschreiber der Gegenwart könnten immerhin denjenigen Millionen Europäern eine geistige Heimat bieten, deren multiple Identitäten und Loyalitäten schon jetzt bestehende Grenzen überschritten.
Durch das Reden und Schreiben über Europas Einheit und Differenzen können die Historiker neue Nähe zur Lebenswelt ihres Publikums gewinnen, das sich nicht mehr nur auf Reisen, sondern durch tägliche Erfahrung mit der Fremdheit anderer Kulturen auseinandersetzen muß. Zu dieser neuen Aufgabe der Historie muß auch die Mediävistik ihre Haltung finden. Sie kann auf ihrer Zuständigkeit für das lateinische Mittelalter beharren und darauf vertrauen, daß sich die westliche Kultur in Europa durchsetzt, riskiert dann aber, in einem multikulturell geprägten Europa ins Abseits zu geraten. Sie kann sich freilich auch dem interdisziplinären Gespräch öffnen und sich einer wirklich umfassenden Wissenschaft der mittelalterlichen Jahrhunderte nähern. Wenn die Beziehungen zwischen den Kulturen erforscht, die unterschiedlichen Lebensformen verglichen und das Nebeneinander des Eigenen und Fremden dargestellt werden, kann das nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Lebensorientierung einer Leserschaft nützlich werden, die die Historie dafür in Anspruch nehmen will. MICHAEL BORGOLTE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main