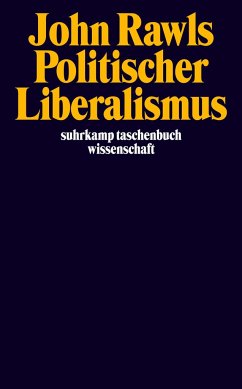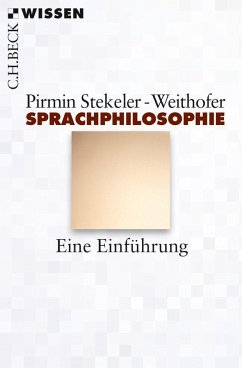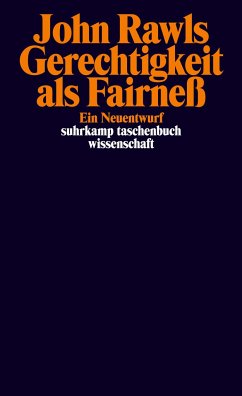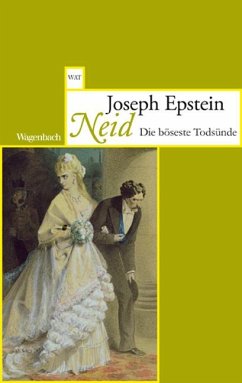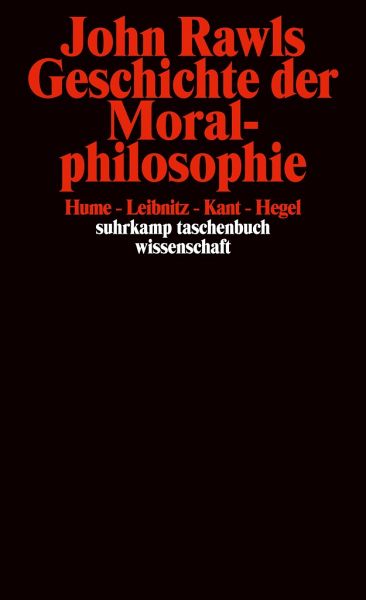
Geschichte der Moralphilosophie
Hume, Leibniz, Kant, Hegel
Herausgegeben: Herman, Barbara;Übersetzung: Schulte, Joachim
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
24,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
John Rawls ist fraglos der bedeutendste amerikanische Philosoph im Bereich der politischen Philosophie und der Moralphilosophie. Seine Geschichte der Moralphilosophie, die als Manuskript lange unter der Hand zirkulierte und einen fast mythischen Ruf hatte, vereinigt seine Vorlesungen an der Harvard University, durch deren Schule eine ganze Generation amerikanischer wie kontinentaler Philosophen gegangen ist. Rawls verbindet darin eine Relektüre der Klassiker der Moralphilosophie mit einer Neubestimmung der Moralphilosophie als solcher. In subtilen Interpretationen kanonischer Texte von Hume, ...
John Rawls ist fraglos der bedeutendste amerikanische Philosoph im Bereich der politischen Philosophie und der Moralphilosophie. Seine Geschichte der Moralphilosophie, die als Manuskript lange unter der Hand zirkulierte und einen fast mythischen Ruf hatte, vereinigt seine Vorlesungen an der Harvard University, durch deren Schule eine ganze Generation amerikanischer wie kontinentaler Philosophen gegangen ist. Rawls verbindet darin eine Relektüre der Klassiker der Moralphilosophie mit einer Neubestimmung der Moralphilosophie als solcher. In subtilen Interpretationen kanonischer Texte von Hume, Leibniz, Kant und Hegel profilieren sich sowohl eine Geschichte der Moralphilosophie als auch eine Perspektive auf aktuelle Fragen und Probleme.