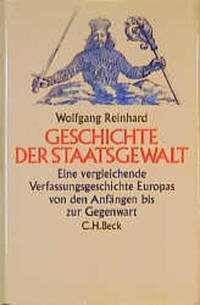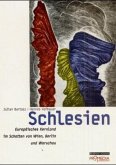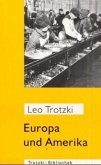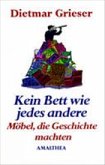Obwohl die Europöer die Erfinder des modernen Staates waren, gab es bisher keine gründliche Untersuchung von dessen europaweiten historischen Grundlagen, vergleichende Verfassungsgeschichte der Länder Europas. Deshalb verläßt dieses Buch die übliche nationalstaatliche Perspektive und versucht, die politischen Strukturen der europäischen Länder als Variante gemeinsamer Grundmuster darzustellen. Der statische, institutionengeschichtliche Verfassungsbegriff wird zu diesem Zweck durch den dynamischen Prozeßbegriff eines Wachstums der Staatsgewalt vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert ersetzt. Das läuft auf eine Historische Anthropologie europäischer Politik hinaus, die den Zusammenhang der Institutionengeschichte mit zahlreichen Feldern der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte herausarbeitet und auch das politische Denken im Kontext der politischen Wirklichkeit behandelt. Im Mittelpunkt steht die europäische Monarchie des Mittelalters und der Neuzeit, ihre Durchdringung des Landes mit Aneignung seiner Ressourcen, ihre Unterwerfung politischer Konkurrenten wie des Adels, der autonomen Gemeinden und der Kirchen, schließlich die Durchsetzung ihres äußeren und inneren Gewaltmonopols mit mancherlei Mitteln. Um 1800 ist der moderne Staat zwar fertig ausgebildet, aber die Staatsgewalt hat dank Demokratisierung und Nationalismus noch eine weitere Steigerung bis zum totalen Staat erlebt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allerdings begannen weltweit ihr Zerfall und ihre Ersetzung durch überstaatliche Einrichtungen. So muß man die Geschichte der Staatsgewalt kennen, um ihre Zukunft im 21. Jahrhundet abschätzen zu können. Das Buch ist deshalb wichtig für ein großes Publikum, das Historiker, Politikwissenschaftler, Juristen und historisch-politisch interessierte Leser umfaßt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Acht Bücher sind es, die in der "Neuen Juristischen Wochenschrift" auch in diesem Jahr wieder ein Kreis von Juristen empfiehlt (Gerhard Dilcher, "Die juristischen Bücher des Jahres - Eine Leseempfehlung", in: Neue Juristische Wochenschrift, Jg. 53, Heft 49. C.H. Beck, München 2000). Am Beginn der Liste steht das Buch eines Historikers: Wolfgang Reinhards "Geschichte der Staatsgewalt" (Verlag C.H. Beck, München 1999). Hervorgehoben wird in der Begründung die ungewohnte Pespektive, aus der hier Staatsbildung und Verfassungsgeschichte betrachtet werden. Nicht der demokratische Verfassungsstaat bilde den Fluchtpunkt der Darstellung: "Vielmehr intensiviert der vor allem von den Monarchien gebildete Staat sein Potential und seine Dynamik noch durch die Verbindung zur ,Nation'". Reinhards Methode erlaube es, heißt es in der Würdigung, die totalitäre Staatsform als Verlängerung der angelegten historischen Linien zu begreifen, nicht als ihre Negation im "Unrechtsstaat".
Einen Gegenpol bildet die Untersuchung "Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform" von Peter Bickle (R. Oldenbourg-Verlag, München 2000). Die ländliche und städtische Gemeinde erscheint in der Darstellung des in der Schweiz lehrenden Historikers als das "Urgestein des Politischen in Europa". Staatsbildung sieht Bickle als dialektischen Prozeß "zwischen Machthabern und Volk über die Vermittlung von Widerstand und Repräsentation". Besonders in der Europäischen Union bedürfe man eines Begriffs der Kommune, die mehr ist als eine Verwaltungseinheit.
Ist soziale Gerechtigkeit in der industriellen Gesellschaft eine Illusion, gar ein trojanisches Pferd des Totalitarismus? Hasso Hofmanns "Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie" (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000) plädiert in der Auseinandersetzung mit klassischen und neueren Gerechtigkeitstheorien zwar gegen eine deduktive Systematik, aber für eine rationale "Ungerechtigkeitsprüfung", um der Verteilungsgerechtigkeit näherzukommen.
F.A.Z.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Peter Blickle lobt das Buch als eine "Leistung ohne Beispiel" in der deutschen Geschichtswissenschaft der letzten Jahrzehnte - obwohl seine Argumentation durchaus manchmal in die Nähe des Stammtischs gerate. Ausführlich zeichnet Blickle nach, wie Reinhard die Entstehung des Staats aus Krieg und Gewalt im Lauf der letzten tausend Jahre vor dem Leser auffaltet. Die eigentliche Existenz des Staates datiere er dann vom 18. Jahrhundert bis ins zweite Drittel des 20. Jahrhunderts. "Beklemmend" findet Blickle allerdings, dass Reinhard, der riesige Stoffmassen bewältige, sozialen und totalen Staat in einem Kapitel zusammenfasst. Überhaupt werde hier "ein Furcht erregendes Europa" rekonstruiert. Blickle hofft, dass Reinhards Buch politiktheoretische Debatten auslösen wird.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH