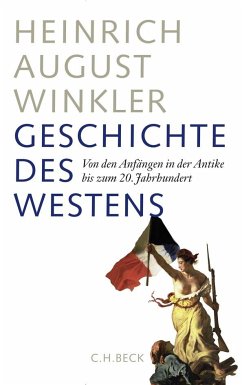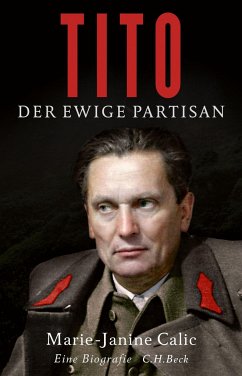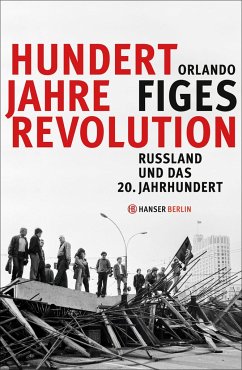Nicht lieferbar

Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert ist durch zwei Perspektiven bestimmt, die zueinander in Widerspruch stehen. Zum einen die großen Kriege und Katastrophen, die das deutsche 20. Jahrhundert in zwei Teile spalten - vor und nach 1945. Deutschland ist das Land, in dem die radikalen Ideologien von links und rechts erdacht wurden, und das einzige, in dem sie jeweils staatliche Form annahmen. Das prägt die erste wie die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Zum anderen der Aufstieg der modernen Industriegesellschaft, der über die verschiedenen politischen Systeme hinweg zu jahrzehntelangen Aus...
Die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert ist durch zwei Perspektiven bestimmt, die zueinander in Widerspruch stehen. Zum einen die großen Kriege und Katastrophen, die das deutsche 20. Jahrhundert in zwei Teile spalten - vor und nach 1945. Deutschland ist das Land, in dem die radikalen Ideologien von links und rechts erdacht wurden, und das einzige, in dem sie jeweils staatliche Form annahmen. Das prägt die erste wie die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Zum anderen der Aufstieg der modernen Industriegesellschaft, der über die verschiedenen politischen Systeme hinweg zu jahrzehntelangen Auseinandersetzungen um die soziale und politische Ordnung führt. Erst 1990 scheinen sie gelöst, als der Sozialismus zusammenbricht. Aber am Ende des Jahrhunderts ist die Debatte um die Leistungen und Defizite des Kapitalismus wieder voll entbrannt.
Diesen gewaltigen Prozess legt Ulrich Herbert mit einer Präzision und Tiefenschärfe frei, wie sie nur selten in der Geschichtsschreibung begegnet. Kriege und Terror, Utopie und Politik, Kapitalismus und Sozialstaat, Sozialismus und demokratische Gesellschaft, Geschlechter und Generationen, Kultur und Lebensstile, europäische Integration und Globalisierung: Wie diese widersprüchlichen Ereignisse und Entwicklungen strukturiert und aufeinander bezogen sind, davon handelt dieses Buch.
Diesen gewaltigen Prozess legt Ulrich Herbert mit einer Präzision und Tiefenschärfe frei, wie sie nur selten in der Geschichtsschreibung begegnet. Kriege und Terror, Utopie und Politik, Kapitalismus und Sozialstaat, Sozialismus und demokratische Gesellschaft, Geschlechter und Generationen, Kultur und Lebensstile, europäische Integration und Globalisierung: Wie diese widersprüchlichen Ereignisse und Entwicklungen strukturiert und aufeinander bezogen sind, davon handelt dieses Buch.