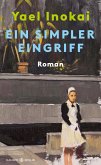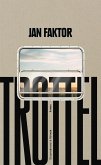In einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Wisconsin bringt im Juli 1953 die zwanzigjährige Telefonistin Carol Truttmann ein Kind zur Welt. Noch in derselben Nacht gibt sie den Jungen zur Adoption frei. Daniel, so sein Name, bleibt in der Obhut eines Sozialdienstes. Bald sehen sich die betreuenden Kinderschwestern mit einem aus ihrer Sicht schwerwiegenden Verdacht konfrontiert: Das Baby scheint, anders als von der Mutter angegeben, nicht »weiß« zu sein, sondern, wie es in der Behördensprache der damaligen Zeit heißt, »indianisch«, »polnisch« oder »negrid« - ein Skandal in einer homogen weißen, den rigorosen Gesetzen der Rassentrennung unterworfenen Gesellschaft. Eine Sozialarbeiterin soll die wahre ethnische Herkunft des Kindes ermitteln. Dazu muss sie allerdings den Vater des Kindes ausfindig machen, dessen Identität die leibliche Mutter nicht preisgeben will ...
In Anna Kims Geschichte eines Kindes geht es um die so wirkmächtige wie fatale Idee von »Rasse«, die bis heute nicht nur die Gesellschaft prägt, sondern auch den privaten Raum durchdringt, Familien entzweit, Karrieren verhindert, Lebenswege bestimmt. Klug und berührend erzählt dieser Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht, wie wir aufeinander schauen und was wir glauben, im anderen zu sehen.
In Anna Kims Geschichte eines Kindes geht es um die so wirkmächtige wie fatale Idee von »Rasse«, die bis heute nicht nur die Gesellschaft prägt, sondern auch den privaten Raum durchdringt, Familien entzweit, Karrieren verhindert, Lebenswege bestimmt. Klug und berührend erzählt dieser Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht, wie wir aufeinander schauen und was wir glauben, im anderen zu sehen.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Wenn Anna Kim die Geschichte eines Pflegekindes erzählt, das durch rassistische Kategorisierungen ausgegrenzt wird, dann ist das Rezensent Eberhard Rathgeb doch zu vorsichtig, zu behutsam. Den Rezensenten stört die allzu große Distanz der Autorin zu einer Geschichte, die in den 1950er Jahren in Wisconsin spielt, sie hätte ihm zufolge von mehr Kraft, mehr Dynamik, mehr Entschlossenheit profitiert. Rathgeb ist das Buch zu berichtend, zu wenig emotional involvierend, ihn kann Anna Kim nicht überzeugen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

FRANKFURT Anna Kim im Literaturhaus
Ein Geheimtipp ist sie nicht mehr. Schließlich stand ihr jüngster Roman auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und der Shortlist des Österreichischen Buchpreises. Dennoch war das Publikum im Frankfurter Literaturhaus sehr überschaubar, als Anna Kim ihren Roman "Geschichte eines Kindes" (Suhrkamp) vorstellte. Im Gespräch mit Jan Wiele, Redakteur im Feuilleton der F.A.Z., nahm die Wiener Autorin mit südkoreanischen Wurzeln kein Blatt vor den Mund. Ihre Geschichte über ein uneheliches, zur Adoption freigegebenes Kind im Amerika der Fünfzigerjahre oszilliert zwischen einem authentischen Bericht aus der damaligen Zeit und autobiographisch grundierter Fiktion. "Negerblut in den Adern" heißt es in dem Bericht der Klinik von Green Bay in Wisconsin. Aber darf man das N-Wort heute überhaupt noch zitieren?
"Es ist notwendig, die Dinge auch auszusprechen", sagte Kim, die den Bericht von ihrem aus Wisconsin stammenden Ehemann erhalten hat. Sie könne den Wunsch verstehen, dieses Vokabular zu verbannen, aber: "Wenn wir die Wörter verbannen, verbannen wir dann auch das Gedankengut? Sind die Traumata damit aufgelöst? Gibt es den Rassismus dann nicht mehr?" Sie hatte sich für die Berichtsform entschieden und wollte das Vokabular nicht verharmlosen: "Wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen, auch wenn es veraltet ist. Es ist nicht Vergangenheit, jedenfalls nicht in Österreich." Die Vereinigten Staaten wiederum seien nach wie vor eine "durch und durch rassifizierte Gesellschaft". Der Begriff der "Rasse" durchdringe und bestimme alles: "Alles ist rassistisch codiert."
Das merkt Danny, die Hauptfigur des Romans, der auf der Suche nach seinem vermutlich farbigen Vater sogar ein Treffen mit seiner weißen Mutter in Kauf nimmt. Zwei Passagen trug die Autorin vor, doch sie warnte: "Mit dem Begriff ,people of colour' übernehmen wir die amerikanischen Rassenkonzepte." Und die hätten zu bestimmten Zeiten unter anderem besagt, dass die Intelligenz schwarzer Kinder um zwei Prozent niedriger liege als bei weißen. So ist es dokumentiert. Babys wurden vermessen und klassifiziert. Wissenschaft und moralische Wertung mischen sich in dem von ihr verwendeten Bericht. "Man muss in der Logik der Fünfziger denken, um so drastisch schreiben zu können", erläuterte Kim, die versucht hat, das anthropologische Fachvokabular abzuschwächen und mehr Menschlichkeit in die berichtenden Passagen zu bringen.
Ihre eigenen Erfahrungen als Asiatin in Wien hat sie ihrer Ich-Erzählerin übertragen. Franziska kann sich an ihre Mutter nicht mehr erinnern, sie nimmt an sich selbst nichts Asiatisches wahr. Dieses "es", das ihr von den Mitmenschen aufgezwungen wird, trennt sie von ihrem Vater. Ein Schelm, wer daran denkt, dass Kim als Zweijährige 1979 nach Deutschland kam. Anders aber als Danny kommt, ja meldet sie sich zu Wort. Ihren Titelhelden macht sie nur in der Rede anderer präsent. Das sei ihre erzählerische "Taktik", um den Rassismus darzustellen, sagte sie jetzt. Sie habe Dannys Geschichte in die Gegenwart überführt: "Dafür habe ich in meinen eigenen Erfahrungen gewildert." Kim, die in Wien-Hietzing aufwuchs, bezeichnet "Geschichte eines Kindes" als ihr "österreichischstes Buch". Das ist harter Tobak. CLAUDIA SCHÜLKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Die Geschichte eines Kindes [wirkt] leise, still, berührend ... Kims Roman ist fern jedes appelativen Aktivismus.« Gerrit Bartels Der Tagesspiegel 20220925