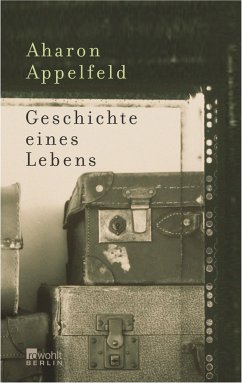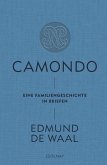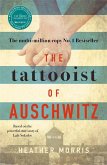wurde 1932 in Czernowitz geboren, der Hauptstadt der Bukowina, damals zu Rumänien, heute zur Ukraine gehörig. Nach sechs Jahren Verfolgung und Krieg, die er zuerst im Ghetto und im Lager, dann in den ukrainischen Wäldern und zuletzt als Küchenjunge der Roten Armee überlebte, kam er nach Palästina. Seine international hochgelobten Romane, u.a. ausgezeichnet mit dem National Jewish Book Award, erschienen in vielen Sprachen, auf Deutsch zuletzt: "Alles, was ich liebte" (2002). Aharon Appelfeld lebt in Jerusalem.
"Durch seine literarische Könnerschaft ist Aharon Appelfeld Autoren wie Primo Levi oder Imre Kertész ebenbürtig." (Der Spiegel)
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Der im Jahr 1932 in Czernowitz geborene Aharon Appelfeld hat unter abenteuerlichen Umständen, etwa in den Wäldern der Ukraine, das Dritte Reich überlebt - während seine Eltern und viele Angehörige von den Nazis ermordet wurden. In mehreren Romanen hat er das Thema in fiktiven Geschichten verarbeitet, nun sind seine Erinnerungen erschienen. Der Rezensent Andreas Breitenstein ist sehr angetan von der Art, wie Appelfeld mit "Lakonik" und "zerbrochen in kurze Kapitel als novellistische Episoden oder poetische Inbilder" die Geschichte seines Lebens erzählt, zu der die schwierige Ankunft in Israel, die mit schlechtem Gewissen verbundene Anhänglichkeit an das Jiddische und die Anfänge als Schriftsteller gehören. Als Person, betont der Rezensent, nimmt sich der Berichterstatter dabei stark zurück, was die Lektüre aber zum umso "bestürzenderen" Erlebnis macht: "Oft ist man versucht niederzuknien."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Über das Leben vor und nach Auschwitz: unsentimental, bewegend, ein großartiges literarisches Zeitdokument.« DIE ZEIT »Es gibt keinen Zweifel: Wer sich eine Bibliothek mit Weltliteratur in Form von Hörbüchern aufbauen möchte, kommt an dieser Edition nicht vorbei.« WDR 3 »Hier wird fündig, wer an Hörbuchproduktionen Freude hat, die nicht schnell hingeschludert sind, sondern mit einer Regie-Idee zum Text vom und für den Rundfunk produziert sind.« NDR KULTUR »Mehr Zeit hätte man ja immer gern, aber für diese schönen Hörbücher [...] besonders.« WAZ »Die Hörbuch-Edition 'Große Werke. Große Stimmen.' umfasst herausragende Lesungen deutschsprachiger Sprecherinnen und Sprecher, die in den Archiven der Rundfunkanstalten schlummern.« SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK