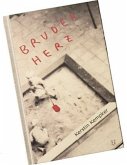Eine beinahe zur Alltäglichkeit gewordene Einsamkeit umgibt Milla und Ritschie, und auch die Vertrautheit zwischen den beiden Geschwistern scheint nicht mehr zu sein als eine Erinnerung an die Kindheit. Erschöpft von den tagtäglichen Unerheblichkeiten, bringen erst der Besuch eines alten Freundes der Familie und die Einladung zu einer Hochzeit von flüchtigen Bekannten die Geschwister einander wieder näher. Milla und Ritschie fangen an zu reden: Darüber, wie es ist, wenn man sich wieder einmal nicht verliebt. Und darüber, wie die Angst vor all dem wächst, was sich im Leben falsch anfühlt. So beginnt eine zarte Annäherung, die darauf beruht, dass nicht alles, was wir übereinander zu wissen meinen, stimmt und nicht jede Erinnerung wahrhaftig ist.

Hanna Lemkes antriebslose "Geschwisterkinder"
Es gibt Bücher, die möchte man nach dem ersten Satz aus der Hand legen. "Milla hörte die Schritte auf der Treppe, langsam und gleichmäßig, sie stand in der Wohnungstür und schaute Ritschie entgegen" lautet dieser erste Satz im Fall von Hanna Lemkes zweiter Buchveröffentlichung "Geschwisterkinder", die als Erzählung untertitelt ist.
Nun wäre dieser Satz so furchtbar schaurig nicht, steckte in ihm nicht jenes Versprechen auf eine im Gleichmaß des Deskriptiven dahinschleichende Geschichte, auf eine Mittzwanziger-Alltagslethargie, die etwas diffus Bedeutungsschwangeres in sich zu tragen vorgibt. Allein das ausgestellte Nennen der Vornamen soll hier Atmosphäre und Charaktere erzeugen. Das ist eine Erzählweise, die vor anderthalb Jahrzehnten funktioniert haben mag, als Judith Hermann sie als neuen Ton in die Gegenwartsliteratur brachte. Heute wirkt dieses Rezept, als habe es sich der Autor ziemlich einfach gemacht.
Nun hält nicht in jedem Fall ein erster Satz, was er verspricht. Und so hat es über manche Strecken dieses schmalen Buches immer wieder den Anschein, als könnte sich aus dem Miteinander der Geschwister Milla und Ritschie etwas entfalten, das über die trübselige Grundstimmung der beiden hinausgeht. Womöglich, so suggeriert hier gerade das Nichtgesagte, verbirgt sich sogar eine unerhörte Begebenheit hinter dem Gleichmaß des Alltäglichen, hinter Millas Arbeiten in einem kleinen Spielzeugladen und hinter Ritschies Job bei einer Online-Redaktion.
Obgleich sich die Geschwister nicht sonderlich nah sind, verbindet sie nämlich etwas: Beide scheinen auf eine verstörte Art unfähig, Liebesbeziehungen zu führen. Bei Milla, die mit Simon zusammenlebt, wird nie ganz klar, ob es sich um eine auseinandergelebte Beziehung handelt oder ob sie aus Einsamkeit hin und wieder mit ihrem Mitbewohner schläft. Ritschie wird von Fabienne, der ehemaligen Praktikantin seiner Redaktion, etwas Beziehungsähnliches aufgenötigt, das er gleichgültig über sich ergehen lässt. Was für die Liebe gilt, gilt für alles andere. Auch in der Arbeit finden Milla und Ritschie weder Erfüllung, noch entwickeln sie Ehrgeiz. Sie lassen alles über sich ergehen. Sie machen das Leben irgendwie so mit.
Überdeutlich, wie am Skizzentisch entwickelt, erscheint deshalb, dass Hanna Lemke die Hochzeit eines ganz offensichtlich von Glück erfüllten Paares zum zentralen Ereignis ihrer Erzählung macht. Ritschie und Milla sind zu dieser Hochzeit eingeladen, was insofern seltsam ist, als sie das Paar nur von einer flüchtigen Begegnung in einem Biergarten kennen. Es ist eines dieser Paare, das sich seit der Grundschule zu kennen scheint, das sich beständig selig anlächelt und ganz und gar aufgeht in seiner Zweisamkeit. Ritschie betrachtet diese Innigkeit mit faszinierter Anteilnahme, Milla stakst in einem unförmigen spießigen Kleid über die Feier, das genauso perfekt zum Anlass passt, wie es Millas Befremden über die Situation zum Ausdruck bringt.
Aber auch dieser Entwurf eines anderen Lebens, dieses zelebrierte Glück, dem Lemke ihre Figuren aussetzt, bringt nichts in Bewegung. Weder macht es den Wunsch nach einer eigenen Beziehung wirklich dringlich. Noch ist das Unwohlsein so groß, dass es zur Sprache bringt, was in der Vergangenheit dazu geführt haben könnte, dass diese beiden Menschen sich innerlich derart zurückgezogen haben. Vielleicht gibt es so einen Anlass aber auch gar nicht.
Natürlich geht es nicht um ein katastrophales Ereignis, um eine Enthüllung um ihrer selbst willen. Es geht schlicht darum, etwas zu erzählen. Bei "Geschwisterkinder" aber bleibt alles im Status einer Behauptung, so dass weder die Charaktere an Tiefenschärfe noch ihre Nöte an Relevanz gewinnen. Deshalb geht es dem Leser mit diesem Buch wie den Figuren mit ihrem Leben: Man legt es dann zwar doch nicht aus der Hand, aber man macht es allenfalls irgendwie so mit.
WIEBKE POROMBKA
Hanna Lemke: "Geschwisterkinder". Erzählung.
Verlag Antje Kunstmann, München 2012. 128 S., geb., 14,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Christoph Haas bescheinigt der Autorin Talent, allerdings, klagt er, fehlten ihr noch Mut und Biss. Beides braucht man wohl als junge Autorin in den großen Fußstapfen Judith Hermanns. An das große Vorbild reicht Hanna Lemke mit ihrem schmalen Roman über eine weitere "lost gerneration" laut Haas nicht heran. Dafür scheinen ihm die Charaktere zu holzgeschnitzt oder direkt dem Leipziger Literatursetzkasten entsprungen, dafür ist ihm auch die Wiederholung hier zu offensichtlich das oberste Erzählprinzip.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH