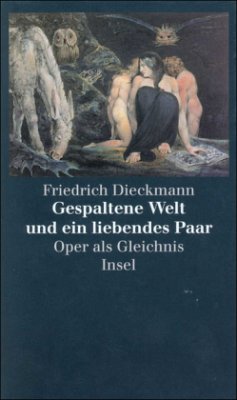Gespaltene Welt, der die liebenden Paare sich entgegenstellen - die Opernbühne zeigt sie uns in vielen Abwandlungen, in der »Zauberflöte« anders als im »Ring der Nibelungen«, in »Fidelio« anders als in Franz Schuberts »Fierabras«. An diesen und anderen Werken der deutschen Oper des bürgerlichen Jahrhunderts zwischen Bastillenturm und Pariser Kommune spürt Friedrich Dickmann den Abwandlungen einer Konfliktsituation nach, die in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts weltpolitisch erstarrte und nur scheinbar in jüngster Zeit aufgehoben wurde. Sein Buch läßt den Leser auf die Bühne der Werkentstehung blicken, dorthin, wo das Zusammenspiel von Textgrund und Vertonung, von Libretto und Komposition Theaterwerke heraufführt, in denen ein Allgemeinbedeutendes sich mit der Prägnanz des Niedagewesenen dargestellt: Oper als Gleichnis.

Friedrich Dieckmanns Aufsätze über "Oper als Gleichnis"
Friedrich Dieckmanns siebzehn Studien begreifen Hauptwerke der deutschen bürgerlichen Oper - zwischen der großen Revolution von 1789 und der deutschen Reichsgründung von 1871 mit dem Gegenstück der Bayreuther Festspielgründung - als Seelenbühne und als Geschichtsbühne. Friedrich Dieckmann, geboren 1937, zwischen 1972 und 1976 Dramaturg am Berliner Ensemble, Autor neuer Textfassungen von Beethovens "Fidelio" und Schuberts "Fierabras", spürt in all den behandelten Werken - von Mozarts "Zauberflöte" über Beethovens "Fidelio" und Schuberts "Fierabras" bis hin zu Wagners "Ring des Nibelungen" und "Parsifal" - einem zentralen Leid-Motiv nach: dem der gespaltenen Welt und dem Geschick des liebenden Paars unter sich wandelnden geschichtlichen Konstellationen.
Aus der besonderen Aufmerksamkeit, die den Libretti zugewendet wird, ergibt sich, dass die Konflikte des liebenden Paars als Spiegel oder als traumatischer Reflex für Entwicklungen der politischen Realgeschichte verstanden werden, auch als Ausdruck der weltanschaulichen Haltung von Komponist und Librettist und nicht zuletzt als Folge einer biographischen Sublimierung wie im Fall Richard Wagners. Selbst bei jenen Opern, die, wie Beethovens "Fidelio", unter ihrem Libretto leiden oder, wie Schuberts "Fierabras" und "Alfonso und Estrella", in der Aufführungspraxis gescheitert sind, gelingt es Dieckmann, das "innere Drama" deutlich zu machen - er legt das politische Thema als Subtext der ins Historische oder Märchenhafte verlegten Handlungen dar. Für den "dramatischen Dilettantismus" gerade in den Opern Schuberts seien "überpersönliche Ursachen" verantwortlich, nicht zuletzt die Tatsache, dass bei einem delikaten Thema wie dem Tyrannensturz der Zensor die Feder des Librettisten mit geführt hat.
Auch die drei Theaterkritiken, die der Autor selber als "episch" bezeichnet, versuchen, "das Kunstwerk Oper in der vergänglichen Gestalt seiner Bühnenerfüllung zu berufen, für die dasselbe Gesetz gilt wie für ihre musikalisch-dramatische Grundlage: sie erlangt ausstrahlende Bedeutung dann, wenn sie im Schnittpunkt epochaler Kraftlinien steht". Dieckmanns lebendig-plastische Beschreibung und tiefenscharfe dramaturgische und ideengeschichtliche Durchleuchtung entsprechen jener Bemerkung Nietzsches, die Größe eines Ereignisses liege darin, dass der große Sinn derer, die es vollbringen, zusammenkommen müsse mit dem großen Sinn derer, die es erleben wollen und begreifen können.
Ein Kunstwerk, heißt es im einleitenden Essay über "Die Zauberflöte", habe eine vertikale und eine horizontale Ebene - oder auch: einen zeitgenössischen und einen geschichtlichen Hintergrund. Jedes "theatrale Wiedererstehen" bedürfe aktueller Erfahrungen. Doch selbst wenn die politische Allegorie - das Hohelied des aufgeklärten Spätabsolutismus und seines Kampfes gegen die feudale und klerikale Reaktion - nicht mehr verstanden werde; selbst wenn die utopische Konstruktion der legalen Umwandlung einer Adels- in eine Ordensmonarchie nicht mehr sinnfällig werde, dann bleibe, so erklärt Dieckmann, auf Peter von Matts "Literatur und Psychoanalyse" zurückgreifend, ein "psychodramatisches Substrat" der Oper, das ihr Weiterwirken sichert.
In einem kürzeren Aufsatz über die Rezeptionsgeschichte - "Die Zauberflöte im Revolutionskrieg" - zeigt Dieckmann, dass die "europaweit phantastisch erfolgreiche" Oper von drei politischen Lagern vereinnahmt wurde: am Rhein von den Befürwortern der Revolution, in Österreich von deren Feinden und im neutralen Preußen von der Philosophie der Aufklärung, die die Figuren geistig-symbolisch interpretierte.
"Jeder Versuch, die Worte einer Vokalkomposition bei der Beurteilung der Musik, zu der sie gesetzt sind, unberücksichtigt zu lassen", heißt es in Georg Kneplers "Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts", "muss scheitern . . . Und wie könnte man von der weltanschaulichen Haltung eines Komponisten, aus der doch seine Musik entspringt, absehen?" In diesem Sinn verfolgt Dieckmann mit Blick auf Beethovens "Fidelio" und die beiden Opern von Franz Schubert jene Nervenbahnen, welche die Sphäre der Kunst mit den Sphären der materiellen Produktion und der Klassenkämpfe verbinden. Er zeigt, welche Gestalt ein Kunstwerk unter sich wandelnden geschichtlichen Bedingungen annimmt - und welchen Sozialcharakter die betroffenen Künstler.
Beethoven, "zwischen Luther und Marx der größte Protestant der deutschen Geistesgeschichte", gelingt, über das Kolportagestück hinweg, ein Freiheitsdrama. Es entbindet einen "Granitgedanken": dass "die Weltgeschichte die Entwicklung des Begriffs der Freiheit ist". Bei "Fidelios Erben", den handlungsohnmächtigen Protagonisten der Schubert-Opern, wird der politische Konflikt in den persönlichen umgeleitet. "Ein hoffnungslos biedermeierliches, ein biedermeierlich hoffnungsloses Bewusstsein vereitelt die Konstruktion von Drama." Umso fesselnder ist Dieckmanns Darstellung, wie Schuberts "Alfonso und Estrella" als politisch-psychologisches Traumstück" der Zensur ein Schnippchen schlug.
Dem knapp dreißigjährigen Autor mochte es 1966 so ergangen sein wie Thomas Mann, als ihm "die Kunst Richard Wagners entgegentrat, diese moderne Kunst, die man erlebt, erkannt haben muss, wenn man von unserer Zeit etwas verstehen will". Auch er musste darum kämpfen, Herz und Hirn in Einklang zu bringen. Durchaus symptomatisch, dass in dem 1966 geschriebenen und von tiefer Irritation und großer Faszination zeugenden Aufsatz über "Siegfrieds Doppelgesicht" noch die politische Kritik an der Wirkung des "Plenipotentarius des Untergangs", wie Wagner sich selber nannte, nachhallt, in erster Linie wohl Adornos "Versuch über Wagner", in dem der Komponist "im Lichte unserer Erfahrung" gesehen wurde. "Die Frage ist müßig", schreibt Dieckmann, "ob Wagner sich im Nazi zur Kenntlichkeit oder zur Unkenntlichkeit verändert habe. Geist und Welt, Idee und Wirklichkeit sind verschiedene Reiche, aber sie stehen in unauflöslicher Wechselwirkung."
Doch ist Dieckmann weit entfernt davon, Wagner auf simplifizierende Weise zu nazifizieren. Unter dem Eindruck von Patrice Chéreaus Bayreuther Inszenierung erfährt er, ohne ihr zu erliegen, die Wagner-Faszination in doppelter Weise: Er erlebt "das Opernmärchen des politisch sich gerade erst entfaltenden Imperialismus" und eine theatralische Kunst, die über konkrete Bilder und wirkliche Bezüge dem Zuschauer ein Phantasiefeld öffnet. In sieben Aufsätzen entfaltet er, in mannigfachen Variationen, dass in Kunstwerke die "Selbstreflexion der geschichtlichen Gesellschaft" eingesenkt sind.
"Sie kommen mir nicht bei", schrieb Wagner 1859 in einem Brief an Mathilde Wesendonck, "ich bin von durchtriebener Schlauheit und habe entsetzlich viel Mythologie im Kopf." Dieckmann kommt dem Mythologen und Mystagogen ebenso bei wie dem Sozialcharakter und dem Erotomanen, der zeitlebens klagte, nie die große Liebe erlebt oder schon gebrauchte Frauen bekommen zu haben. Der Aufsatz über "Rosalie oder Das Liebesverbot" macht deutlich, dass Wagners leidenschaftliche Beziehung zu seiner Schwester sich in die erotischen Konstellationen seiner romantischen Opern einsenkt - und dann in der "Walküre" ausbricht: als "Wunscherfüllung im Werk, der wonnevollen Imagination jenes Verbotenen, das als das zutiefst Erfüllende erscheint, der Liebesvereinigung derer, die ursprünglich zusammengehören. Der freie Mensch ist der, welcher durch die Gebote und Gebräuche, die Setzungen und die Interessen der Gesellschaft durchdringt; das äußerste und dichteste der Verbote aber betrifft eben die Liebe . . . In diesen beiden Gestalten . . schreibt Wagner sich von einem Grundmotiv seines Werk- und Seelenhaushalts frei."
Der Anhang des Aufsatzbandes umfasst neunzig Seiten - ein Fünftel des Buches. Er führt den Leser auf die Bühne - oft auch in das Labyrinth - der Werkentstehung und deren politische und private Voraussetzungen. Weitgehend ausgeklammert bleiben Fragen nach den spezifisch musikalischen Kunstmitteln der Oper, erst recht die nach deren "Sinnenzauber". Dieckmann geht es um anderes. Wer Oper auf die Bühne bringt, sei es ein politisches Traumspiel von Franz Schubert oder der Wahrtraum des "Rings des Nibelungen", bringt Gegenwart auf die Bühne. "Hervorgegangen aus dem Beben seiner Welt, vermag uns das Werk auf der Bühne nur zu ergreifen, wenn wir einen Widerschein eigener Welt und unseres Bebens aus ihm vernehmen."
JÜRGEN KESTING.
Friedrich Dieckmann: "Gespaltene Welt und ein liebendes Paar". Oper als Gleichnis. Insel Verlag, Frankfurt am Main, Leipzig 1999. 500 S., Abb., geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main