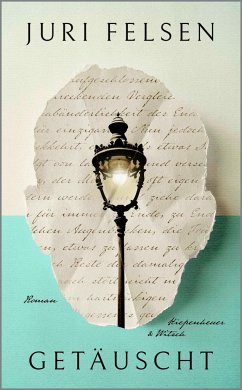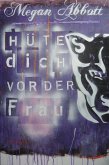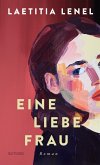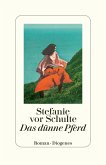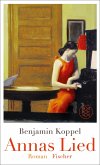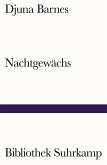Juri Felsen, der einst als »russischer Proust« galt, war einer der führenden Schriftsteller seiner Generation. Beeinflusst von Marcel Proust, James Joyce und Virginia Woolf ist Juri Felsen ein Autor von Weltrang. Juri Felsen wurde von den Nazis ermordet, sein Werk war lange vergessen, bis es in den letzten Jahren wiederentdeckt und nun zum ersten Mal auf Englisch und Deutsch veröffentlicht wird.
Wir treffen unseren namenlosen Erzähler im Paris der Zwanzigerjahre, wo er sich nach der Russischen Revolution als Emigrant wiederfindet. Auf Bitten einer Bekannten lernt er die schöne, kluge und gesellige Ljolja kennen, die ebenfalls gerade aus Russland geflohen ist. Was als lockere Freundschaft beginnt, verwandelt sich schnell in Faszination und Besessenheit, da sie uneindeutige Signale sendet und anderen Männern nachstellt.
Während Ljolja weiterhin ein Leben führt, das nicht von den Kräften der gesellschaftlichen Konvention und der Geschichte beeinträchtigt wird, werden die in Tagebuchform geschriebenen Enthüllungen unseres Erzählers immer schmerzhafter, vertrauter und reich an psychologischer Introspektion.
Wir treffen unseren namenlosen Erzähler im Paris der Zwanzigerjahre, wo er sich nach der Russischen Revolution als Emigrant wiederfindet. Auf Bitten einer Bekannten lernt er die schöne, kluge und gesellige Ljolja kennen, die ebenfalls gerade aus Russland geflohen ist. Was als lockere Freundschaft beginnt, verwandelt sich schnell in Faszination und Besessenheit, da sie uneindeutige Signale sendet und anderen Männern nachstellt.
Während Ljolja weiterhin ein Leben führt, das nicht von den Kräften der gesellschaftlichen Konvention und der Geschichte beeinträchtigt wird, werden die in Tagebuchform geschriebenen Enthüllungen unseres Erzählers immer schmerzhafter, vertrauter und reich an psychologischer Introspektion.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Sehr gerne treibt sich Rezensent Egbert Tholl mit dem Ich-Erzähler dieses Buches im Paris der 1920er Jahre herum. Geschrieben hat das Buch Juri Felsen, ein seinerzeit mit Proust verglichener exilrussischer Autor, und zwar im Jahr 1930, so Tholl, dem das Spiel gut gefällt, das Felsen hier mit seiner Erzählinstanz treibt. Man hat fast das Gefühl, der Autor mache sich lustig über sein Erzähler-Ich, das hier Tagebuch schreibt: In langen Sätzen legt dieser sein Inneres offen, seine "Larmoyanz", auch seinen männlichen Narzissmus, der ihn keineswegs zum Licht der Selbsterkenntnis führt. Inhaltlich geht es um die Liebe, und zwar um die Liebe zu Ljolja, der Nichte einer Bekannten des Erzählers, die Liebe ist unglücklich und realitätsfern, das Ende der Geschichte alles andere als happy, wobei der Erzähler keineswegs vorhat, sich und seine Sicht auf die Welt zu ändern. Toll, wie die Innerlichkeit dieses Erzählers ausgeleuchtet wird, sehr gelungen auch Rosemarie Tietzes Übersetzung, ( "eine silbrig glitzernde Symphonie"). Kurz: der Kritiker ist rundum zufrieden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Wenn man will, kann man in Felsens Erzähler einen an seiner fragilen Männlichkeit leidenden Neurotiker sehen. Und schon hat man sich über die Vergangenheit mitten in die Gegenwart begeben.« Xaver von Cranach Der Spiegel 20250201