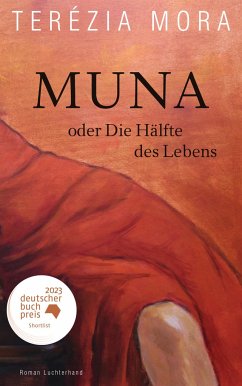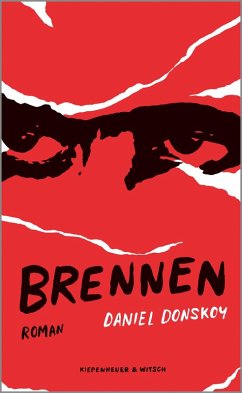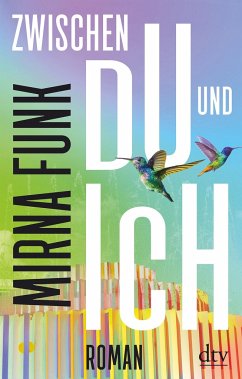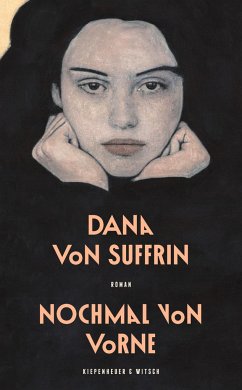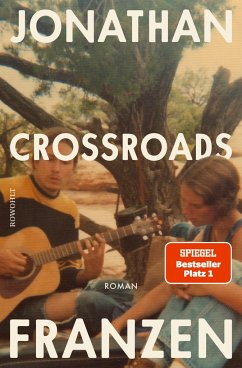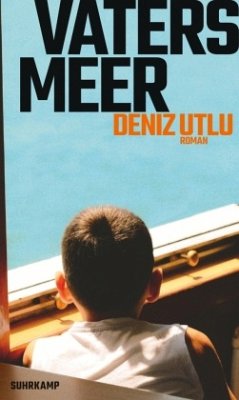Dana Vowinckel
Gebundenes Buch
Gewässer im Ziplock
Roman Ein mitreißendes Porträt jüdischen Familienlebens heute Ein Sommer zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Von großen und kleinen Lügen, Glücksmomenten und Enttäuschungen, von Zuneigung und Schmerz erzählt Dana Vowinckel in ihrem Debütroman. Gewässer im Ziplock ist eine mitreißende Familiengeschichte zwischen jüdischer Tradition und deutschem »Gedächtnistheater«. Eine Geschichte voller Leben und Menschlichkeit.»Dana Vowinckels Roman ist von tiefer Weisheit, er kennt das Wanken, die Sehnsüchte und Zerrissenheit des Weltenwanderns.« Julia Franck, Autorin von Die MittagsfrauEin Sommer zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem. Wie jedes Jahr verbringt die fünfzehnjährige Margarita ihre F...
Von großen und kleinen Lügen, Glücksmomenten und Enttäuschungen, von Zuneigung und Schmerz erzählt Dana Vowinckel in ihrem Debütroman. Gewässer im Ziplock ist eine mitreißende Familiengeschichte zwischen jüdischer Tradition und deutschem »Gedächtnistheater«. Eine Geschichte voller Leben und Menschlichkeit.
»Dana Vowinckels Roman ist von tiefer Weisheit, er kennt das Wanken, die Sehnsüchte und Zerrissenheit des Weltenwanderns.« Julia Franck, Autorin von Die Mittagsfrau
Ein Sommer zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem. Wie jedes Jahr verbringt die fünfzehnjährige Margarita ihre Ferien bei den Großeltern in den USA. Viel lieber will sie aber zurück nach Deutschland, zu ihren Freunden und ihrem Vater, der in einer Synagoge die Gebete leitet. Die Mutter hat die beiden verlassen, als Margarita noch in den Kindergarten ging. Höchste Zeit, beschließt der Familienrat, dass sie einander besser kennenlernen. Und so wird Margarita in ein Flugzeug nach Israel gesetzt, wo ihr Vater aufgewachsen ist und ihre Mutter seit Kurzem lebt. Gleich nach der Ankunft geht alles schief, die gemeinsame Reise von Mutter und Tochter durchs Heilige Land reißt alte und neue Wunden auf, Konflikte eskalieren, während der Vater in Berlin seine Rolle überdenkt. Da müssen sie schon wieder die Koffer packen und zurück nach Chicago, wo sich alle um das Krankenbett der Großmutter versammeln und Margarita eine folgenreiche Entscheidung treffen muss.
»Dana Vowinckel soll bitte weiter und immer weiter erzählen. Ich möchte noch hundert Bücher von ihr lesen.« Daniela Dröscher, Autorin von Lügen über meine Mutter
»Dana Vowinckels Roman ist von tiefer Weisheit, er kennt das Wanken, die Sehnsüchte und Zerrissenheit des Weltenwanderns.« Julia Franck, Autorin von Die Mittagsfrau
Ein Sommer zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem. Wie jedes Jahr verbringt die fünfzehnjährige Margarita ihre Ferien bei den Großeltern in den USA. Viel lieber will sie aber zurück nach Deutschland, zu ihren Freunden und ihrem Vater, der in einer Synagoge die Gebete leitet. Die Mutter hat die beiden verlassen, als Margarita noch in den Kindergarten ging. Höchste Zeit, beschließt der Familienrat, dass sie einander besser kennenlernen. Und so wird Margarita in ein Flugzeug nach Israel gesetzt, wo ihr Vater aufgewachsen ist und ihre Mutter seit Kurzem lebt. Gleich nach der Ankunft geht alles schief, die gemeinsame Reise von Mutter und Tochter durchs Heilige Land reißt alte und neue Wunden auf, Konflikte eskalieren, während der Vater in Berlin seine Rolle überdenkt. Da müssen sie schon wieder die Koffer packen und zurück nach Chicago, wo sich alle um das Krankenbett der Großmutter versammeln und Margarita eine folgenreiche Entscheidung treffen muss.
»Dana Vowinckel soll bitte weiter und immer weiter erzählen. Ich möchte noch hundert Bücher von ihr lesen.« Daniela Dröscher, Autorin von Lügen über meine Mutter
Dana Vowinckel wurde 1996 in Berlin geboren und studierte Linguistik und Literaturwissenschaft in Berlin, Toulouse und Cambridge. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2021 wurde sie für einen Auszug aus Gewässer im Ziplock mit dem Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet. 2023 wurde ihr ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats zugesprochen. 2024 ist sie Stipendiatin bei Art Omi. Dana Vowinckel lebt in Berlin.
Produktdetails
- Suhrkamp Nova
- Verlag: Suhrkamp
- Artikelnr. des Verlages: ST 5360
- 6. Aufl.
- Seitenzahl: 362
- Altersempfehlung: ab 14 Jahren
- Erscheinungstermin: 20. August 2023
- Deutsch
- Abmessung: 213mm x 134mm x 27mm
- Gewicht: 458g
- ISBN-13: 9783518473603
- ISBN-10: 3518473603
- Artikelnr.: 67700613
Herstellerkennzeichnung
Suhrkamp Verlag
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
"Aktuell und nötig" findet Rezensent Tim Caspar Boehme den Debütroman von Dana Vorwinckel, in dem eine Familie nur noch durch ihre jüdische Herkunft verbunden zu sein scheint. Das Verhältnis zwischen Avi, Marsha und deren gemeinsamer jugendlicher Tochter Margarita ist höchst angespannt: Der Kantor Avi und Margarita leben in Deutschland, Marsha in den USA, erfahren wir. Alle drei treffen im Verlauf der Handlung in Jerusalem aufeinander und reisen zusammen durch Israel. Das "bewegte Miteinander" der familiären Dynamik verdeutlicht die Autorin gekonnt mit ihren "Stakkato"-Sätzen, bemerkt Boehm. Außerdem imponiert ihm, dass die Figuren nicht starr bleiben, der gläubige Avi fährt zum Beispiel auch am Schabbat Auto. Das Glossar mit allerhand jüdischen Begriffen findet Boehm hilfreich, wundert sich aber über die Auslassung einiger Wörter. Trotzdem ist der Rezensent angetan von diesem Buch, dass auch das jüdische Leben in Deutschland treffend darzustellen weiß.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»[Das Buch] ist großartig, und alle 15- bis 95-Jährigen sollten es gelesen haben.« ZEIT Campus 20231214
Die 15-jährige Margarita lebt mit ihrem alleinerziehenden Vater Avi in Berlin, die Mutter hat sie verlassen, als Margarita noch ganz klein war. Avi ist strenggläubiger Jude und Kantor in einer jüdischen Gemeinde. Wie jedes Jahr verbringt Margarita den Sommer bei ihren Großeltern …
Mehr
Die 15-jährige Margarita lebt mit ihrem alleinerziehenden Vater Avi in Berlin, die Mutter hat sie verlassen, als Margarita noch ganz klein war. Avi ist strenggläubiger Jude und Kantor in einer jüdischen Gemeinde. Wie jedes Jahr verbringt Margarita den Sommer bei ihren Großeltern mütterlicherseits in Chicago. Früher hat ihr das gefallen, heute langweilt sie sich. Als ihre Großmutter den Vorschlag macht, Margarita könnte ihre Mutter Marsha in Jerusalem besuchen, wo diese einen Lehrauftrag angenommen hat, weigert sich Margarita zunächst. Schließlich hat sie ihre Mutter seit 13 Jahren nicht mehr gesehen und auch sonst keinen Kontakt zu ihr gehabt.
Trotz großer Bedenken fliegt sie. Nach anfänglichen Problemen und Missverständnissen, bei denen Marsha gleich ihre Unzuverlässigkeit beweist, reisen die beiden durch Israel, mal keimt so etwas wie Zuneigung auf, dann streiten sie sich wieder, dass die Fetzen fliegen. Das Ganze kulminiert darin, dass Margarita abhaut und damit Mutter, Vater und Großeltern in Panik versetzt und Avi ebenfalls nach Israel fliegt.
Ich wollte dieses Buch gern lesen, um etwas über den jüdischen Glauben zu erfahren. In der Tat nimmt die Beschreibung der vielfältigen Rituale einen großen Platz in diesem Roman ein. Das lückenhafte Glossar hebräischer Begriffe war zum Verständnis nur bedingt hilfreich. Die Vielzahl an nicht erklärten und oft auch aus dem Zusammenhang nicht hervorgehenden Begriffe ist meine größte Kritik an diesem Roman.
Den Deutschenhass, dem Margarita in Israel ausgesetzt ist, fand ich schlimm. Was kann eine Fünfzehnjährige für den Holocaust? Auch Avi, der sich bewusst für ein Leben in Deutschland entschieden hat, steht Deutschland sehr kritisch gegenüber. Deutsch bezeichnet er als Nazi-Sprache, seine Überlegung, ob es in Auschwitz wohl Handcreme gebe „mit Tote-Juden-Asche“, die wahrscheinlich sarkastisch sein sollte, finde ich in höchstem Maße geschmacklos.
Wir erleben Margarita als verunsicherten Teenager, der seinen Platz in der Welt sucht und einfach nur gesehen werden möchte. Die sich ständig streitenden Eltern machen es ihr nicht leicht. Am Schluss muss sie eine große Entscheidung treffen, jedoch ist nicht ganz klar, wie sie sich auf Dauer entscheidet. Ein durchaus empfehlenswertes, aber nicht einfach zu lesendes Buch über die Sorgen und Nöte eines Teenagers in der Findungsphase, eine schwierige Familienkonstellation und jüdisches Leben in Deutschland, den USA und Israel.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Coming-of-Age Roman, der jüdisches Leben, Heimat und Identität verhandelt
»Es war immer das Gleiche mit ihr [Marsha], dachte er [Avi]. Sie ging, ohne sich zu verabschieden, und kam, ohne sich anzukündigen, und am Ende freute man sich umso mehr über sie, weil sie so …
Mehr
Coming-of-Age Roman, der jüdisches Leben, Heimat und Identität verhandelt
»Es war immer das Gleiche mit ihr [Marsha], dachte er [Avi]. Sie ging, ohne sich zu verabschieden, und kam, ohne sich anzukündigen, und am Ende freute man sich umso mehr über sie, weil sie so unzuverlässig war, dass es immer auch eine Gnade war, wenn sie sich dazu herabließ, sich mitzuteilen. »Yofi.«« S. 286
In ihrem Debütroman »Gewässer im Ziplock« schreibt Dana Vowinckel über eine amerikanisch und deutsch-jüdische Familie. Abwechselnd lesen wir aus Sicht des alleinerziehenden Vaters Avi, der für seinen Job als Chasan aus Israel nach Deutschland gezogen ist, und seiner Tochter Margarita (aka Rita, 15 J.), die als Jüdin in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, die Story rund um diese Familie. Diese beginnt mit dem all-jährlichen Besuch Ritas ihrer Großeltern (mütterlicherseits) in Chicago. Die US-amerikanische Mutter Marsha hat Avi und Rita früh verlassen und ist in die USA zurückgekehrt. Bei ihrem Besuch der Großeltern sieht Rita häufig auch ihre Mutter, dieses Jahr hat diese sie nach Israel für einen Roadtrip eingeladen. So spannt sich eine Story mit nicht wenig Drama vor den Lesenden auf, die sich aus Ritas Sicht wie ein Coming-Out-Of-Age Roman liest. Der Schmerz über die Trennung der Eltern wird immer wieder auf beiden Seiten - Rita & Avi - deutlich und gibt dem Roman eine weitere Nuance.
»»There is no such thing as poetic justice«, sagte Marsha, »and, my darling, that is the cruelest and the kindest thing about our lives.« Dann ging sie.« S. 317
Besonders an dem Buch hat mir der Blick auf jüdisches Leben, Kultur und Traditionen in Berlin, Chicago und Israel gefallen. Auch wie unterschiedlich, Glaube und Religion interpretiert werden können, fand ich sehr stark beschrieben. Kunstvoll wird dies mit der Story verwoben, ebenso wie jüdische Wörter selbst. Was mir nicht gefallen hat, war der ‚Good Parent - Bad Parent‘-Part, bei dem zeitweise die Mutter überhaupt nicht gut davon kommt, dann aber der Vater zu streng ist und Margarita nicht nur zwischen den umabgestimmten Eltern zerrissen ist, sondern sich gefühlt ständig auf eine Seite schlagen muss. Das fand ich sehr anstrengend, ebenso wie der nicht gelöste Konflikt zwischen den Eltern, der mal mehr mal weniger schlummert.
Insgesamt ist »Gewässer im Ziplock« ein spannender und schön geschriebener Roman, der gekonnt Themen wie jüdische Identität, Traditionen und der Suche nach Heimat verhandelt, aber dennoch einige Längen hat und mich damit in Gänze leider nicht ganz so überzeugen konnte. Empfehlung gibt es aber natürlich trotz der Längen ♡
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Jüdisches Leben zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem
Eine jüdische Familiengeschichte zwischen drei Generationen in verschiedenen Settings: Deutschland, die USA und Israel. Im Zentrum des Romans stehen jüdisches Leben, ihre Kultur und Traditionen, die Suche nach Heimat und …
Mehr
Jüdisches Leben zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem
Eine jüdische Familiengeschichte zwischen drei Generationen in verschiedenen Settings: Deutschland, die USA und Israel. Im Zentrum des Romans stehen jüdisches Leben, ihre Kultur und Traditionen, die Suche nach Heimat und Sicherheit. Für die junge, sehr trotzköpfige Margarita wird es mit ihren 15 Jahren zu einer Suche nach Identität als Jüdin und Deutsche, besonders auf ihrer unerfreulichen Reise durch Israel. Die Beschreibung des Zusammenlebens mit ihrem Vater Avi, Kantor in einer Berliner Synagoge, ist gelungen, auch wenn jüdische Fachbegriffe trotz des Glossars zu Langatmigkeit führen. Avis Gedanken, Gefühle bzgl. seiner Tochter Margarita und seiner Frau Marsha lassen ihn schwach, ernst und unsicher erscheinen, dabei immer tief verwurzelt in seine religiöse Tätigkeit, was das Lesen in seinen Parts etwas sperrig macht für Ungläubige. Die Problematik der Mutter tritt klar hervor. Kleine und große Geheimnisse in der Familie und Sorge um die Großeltern schaffen im 2. Teil mehr Spannung. Die derzeitige Problematik als deutscher Jude sowohl in Deutschland als auch in Israel wird nur knapp angesprochen. Eine eher dysfunktionale Familie findet etwas mehr zueinander.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Ich muss zugeben, dass ich das Buch, hätte ich es in der Buchhandlung gesehen, wahrscheinlich übersehen hätte, da das Cover trotz des schönen Designs doch recht unscheinbar ist und der Titel mich auf den ersten Blick auch nicht unbedingt angesprochen hätte. Leider wäre …
Mehr
Ich muss zugeben, dass ich das Buch, hätte ich es in der Buchhandlung gesehen, wahrscheinlich übersehen hätte, da das Cover trotz des schönen Designs doch recht unscheinbar ist und der Titel mich auf den ersten Blick auch nicht unbedingt angesprochen hätte. Leider wäre dann aber ein absolutes Highlight dieses Lesejahres an mir vorbei gegangen!
In ihrem Debütroman erzählt die Autorin Dana Vowinckel sehr gekonnt und überraschend ausgereift eine Familiengeschichte zwischen Kontinenten und Kulturen, die sich auf moderne Art und Weise mit Tradition und Glaube auseinandersetzt und die mir eine Fülle an neuen Perspektiven und Denkweisen aufgezeigt hat. Zu Beginn hatte ich etwas Bedenken, ob mir der Roman nicht zu „jugendlich“ ist, da vieles aus der Perspektive der 15-jährigen Margarita erzählt wird, aber dem war zum Glück nicht so. Beim Lesen war ich in einem richtigen Flow, was wahrscheinlich auch daran lag, dass verschiedene Orte und Perspektiven in die Handlung einfließen; das hat den Text für mich sehr abwechslungsreich und interessant gemacht.
Wie die Autorin die Zerrissenheit Margaritas zwischen den Kulturen darstellt, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wer oder was eigentlich unsere Herkunft und unsere Heimat definiert. Toll und spannend fand ich auch, welch große Rolle die Sprache(n) spielt. Wie drückt man sich aus, wenn man zwischen verschiedenen Sprachen steht? Was bleibt dabei auf der Strecke?
Der Roman bietet auf jeden Fall viel Stoff zum Nachdenken und Diskutieren und ich wünsche mir, dass noch viele Leser*innen dieses wunderbare Buch entdecken.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Margarita lebt mit ihrem Vater zusammen in Berlin. Der Vater ist jüdischer Kantor, die Mutter hat die Familie verlassen, als das Kind drei Jahre alt war. Nun ist Margarita 15 und fährt in den Sommerferien nach Chicago zu ihren Großeltern mütterlicherseits. Dort fühlt sie …
Mehr
Margarita lebt mit ihrem Vater zusammen in Berlin. Der Vater ist jüdischer Kantor, die Mutter hat die Familie verlassen, als das Kind drei Jahre alt war. Nun ist Margarita 15 und fährt in den Sommerferien nach Chicago zu ihren Großeltern mütterlicherseits. Dort fühlt sie sich als Teenager nicht mehr wohl und so wird sie weitergereicht zu ihrer Mutter, die ein Auslandssemester in Jerusalem verbringt. Und dort geht dann alles schief.
Das Buch ist eine Mischung aus Coming-of-age-Roman, Familiengeschichte und Roadmovie. Dadurch wird es sehr abwechslungsreich und manchmal auch spannend. Margarita steckt voll in dem Ablösungsprozess von ihren Eltern, wobei die Mutter keine gute Rolle spielt. Sie ist gegenüber ihrem Kind sehr nachlässig, "vergisst" sie am Flughafen abzuholen, es findet kaum Kommunikation zwischen den beiden statt und dadurch gibt es Missverständnisse, die eine Lawine in Gang setzen. Aber auch das Verhältnis zu dem religiösen Vater ist nicht unbelastet. In der Familie gibt es Konflikte auf allen Ebenen, zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern und sie werden nicht ausgesprochen, sondern totgeschwiegen. Dazu kommen die Belastungen der älteren Generation in Bezug auf die Shoah.
Ich war überrascht, dass das Buch ein Erstling ist, denn es ist hervorragend geschrieben, sehr sensibel und in einem sehr differenzierten Stil. Ich habe ganz nebenbei viel über das Judentum gelernt, auch über die Sicht der Israelis auf Deutschland.
Das Buch ist ein Roman für ältere Jugendliche, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, zuerst aber würde ich es Erwachsenen jeden Alters empfehlen.
Weniger
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für