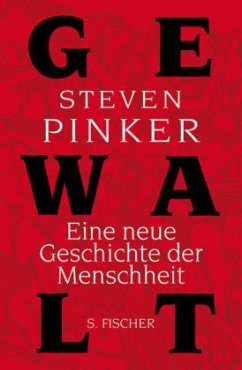Die Geschichte der Menschheit eine ewige Abfolge von Krieg, Genozid, Mord, Folter und Vergewaltigung. Und es wird immer schlimmer. Denken wir. Doch ist das richtig?
In einem wahren Opus Magnum, einer groß angelegten Gesamtgeschichte unserer Zivilisation, untersucht der weltbekannte Evolutionspsychologe Steven Pinker die Entwicklung der Gewalt von der Urzeit bis heute und in allen ihren individuellen und kollektiven Formen. Unter Rückgriff auf eine Fülle von wissenschaftlichen Belegen beweist er anschaulich und überzeugend, dass die Menschheit dazulernt und Gewalt immer weniger als Option wahrgenommen wird. Pinkers Darstellung verändert radikal den Blick auf die Welt und uns Menschen. Und sie macht Hoffnung und Mut.
In einem wahren Opus Magnum, einer groß angelegten Gesamtgeschichte unserer Zivilisation, untersucht der weltbekannte Evolutionspsychologe Steven Pinker die Entwicklung der Gewalt von der Urzeit bis heute und in allen ihren individuellen und kollektiven Formen. Unter Rückgriff auf eine Fülle von wissenschaftlichen Belegen beweist er anschaulich und überzeugend, dass die Menschheit dazulernt und Gewalt immer weniger als Option wahrgenommen wird. Pinkers Darstellung verändert radikal den Blick auf die Welt und uns Menschen. Und sie macht Hoffnung und Mut.

Verschwindet die Gewalt tatsächlich, wie Steven Pinker behauptet? Oder wird sie nur unsichtbar?
Man kann sie ja nicht mehr hören, all die Verfallsgeschichten über kulturelle Errungenschaften, Ideen, Standards. Ständig geht etwas unter oder verloren, die Werte, die Hirne, die Orientierung, das Festnetz, jetzt sogar: die Gewalt. Nie waren die Zeiten friedlicher als heute, sowohl im Alltag als auch im internationalen Miteinander: Das ist die These, die der kanadische Evolutionspsychologe Steven Pinker in seinem neuen Buch all jenen Universalapokalyptikern entgegenhält, welche vor lauter Untergangsbesessenheit oft gar nicht mehr erkennen können, dass es auch segensreiche Formen des Verfalls gibt und Traditionen, die der Teufel erfunden hat.
Pinkers monumentaler Versuch, den Rückgang der Gewalt empirisch zu belegen, ist schon deshalb erst einmal sympathisch, weil er den zeitgenössischen Kulturpessimismus gewissermaßen mit dessen eigenen Waffen schlägt. Gegen die chronisch schlechtgelaunten Thesen der Niedergangsdiagnostiker nämlich helfen Utopien nur schlecht; sie klingen halt dann doch immer ein wenig wie aus der Trendwerkstatt von Matthias Horx. Und immerhin, es ist nicht irgendwer, der da spricht: Der Harvard-Professor Pinker ist der derzeit vielleicht erfolgreichste Vertreter jenes amerikanischen Modells von Akademikern, die als Bestsellerautor funktionieren, ohne dabei ihr wissenschaftliches Renommee einzubüßen. Die "Süddeutsche Zeitung" hat ihn vor ein paar Tagen zum "wichtigsten Intellektuellen" der Vereinigten Staaten erklärt.
Auch Pinkers "Neue Geschichte der Menschheit", die der deutsche Untertitel ausruft, ist also zunächst einmal eine Geschichte des Verlustes. Dass es sich auch bei der Ausübung gewalttätiger Praktiken um eine Form der Kultur handelte, das kann man kaum bestreiten angesichts der Ernsthaftigkeit und Raffinesse, mit welcher Folterknechte und Waffentechniker noch bis ins 19. Jahrhundert die Spielarten der Brutalität betrieben. Es reichte eben nicht, zu töten.
Stiere und Bomben
Der Einfallsreichtum der Gewaltkünstler von den römischen Gladiatorenkämpfen bis zum Mittelalter ist bekannt: Körper wurden gepfählt, gestreckt, gehängt und gehäutet, gekreuzigt, gevierteilt, gerädert. Lebendige Leiber wurden von Adlern zerhackt, von Maden zerfressen oder in einem eisernen Stier gekocht, bis aus dem Maul die Schreie des Opfers zu hören waren. Und die Literatur der Vormoderne, von der Ilias bis zu "King Lear", müsste man heute eigentlich nahezu komplett unter der Rubrik "Splatter" einordnen.
Natürlich weiß auch Pinker, dass solche Drastik allenfalls als Kulisse auf seiner Geisterbahnfahrt durch die Weltgeschichte dienen kann. Gegen die nüchternen Zahlen der phantasielosen Gasmorde der Nazis oder der stillen Monstrosität der Atombombe hilft solche Folklore wenig. Um die verbreitete Einschätzung auszuräumen, das 20. Jahrhundert sei das blutigste der Menschheitsgeschichte gewesen, fährt Pinker daher ein ganzes Arsenal von Statistiken auf, Diagramme über Dauer, Häufigkeit und Opferzahlen von Kriegen und Konflikten. Zwar findet auch Pinker kein Ereignis, das insgesamt mehr Opfer hervorbrachte als der Zweite Weltkrieg mit seinen 55 Millionen Toten; dass dieser am Ende doch nur auf dem achten Platz der Liste der furchtbarsten Kriege landet, liegt daran, dass Pinker die Opferzahlen in Beziehung zur jeweiligen Weltbevölkerung setzt. Das mit Abstand tödlichste Ereignis der Geschichte war demnach der Aufstand, bei dem der chinesische General An Lushan im achten Jahrhundert 36 Millionen (oder nach heutigen Proportionen eben 429 Millionen) Menschen niedermetzelte.
Pinkers Korrekturen sind durchaus plausibel, um so etwas wie die "gefühlte Gewalt" der Zeit zu ermitteln, die Alltäglichkeit der persönlichen Erfahrung von Krieg und Mord. Ihr Problem ist ein anderes: Wer im Zeitalter immer effektiverer Massenvernichtungswaffen die Abnahme der Gewalt per Bodycount beweisen will, ist immer nur einen Atombombenabwurf vom Einsturz der These entfernt.
Trotzdem sind Pinkers Statistiken nicht ohne Charme, weil sie ganz gut als Gegengift gegen die mediale Präsenz der Gewalt wirken, welche von ihrem Verschwinden so gar nichts wissen will, gegen die Präsentation der Gegenwart als einer Welt voller U-Bahn-Schläger, Straßenkämpfer, Kindermörder und Amokläufer. Dass es immer genug Gewalt geben wird, um die Abendnachrichten zu füllen, wie Pinker schreibt, ändert nur nichts an seiner ermutigenden Diagnose. All die Phänomene, die wir heute meinen, wenn wir über Gewalt sprechen, Probleme wie Jugendgewalt, Kindersoldaten oder Drogenkriege, sie schrumpfen in Pinkers Tour de Force auf vergleichsweise marginale Manifestationen zusammen.
Erdnüsse und Terror
Selbst der Terrorismus, dem immerhin ein eigenes Unterkapitel gewidmet ist, ist so gesehen nicht viel mehr als eine "Belästigung". "Sogar durch Blitzschlag, Elche, Erdnussallergien, Bienenstiche und ,in Brand geratene oder geschmolzene Schlafanzüge' starben in jedem Jahr mit Ausnahme von 1995 und 2001 mehr Amerikaner als durch Terroranschläge", schreibt Pinker. Selbst vermeintlich besonnene Gegenmaßnahmen haben deshalb katastrophale Folgen: Rund 1500 Amerikaner starben in dem Jahr nach dem 11. September 2001, weil sie aus Angst vor einer Flugzeugentführung lieber mit dem Auto fuhren - sechsmal so viele, wie am 11. September in den Flugzeugen ums Leben kamen.
Pinkers Blick für solche erhellenden Zusammenhänge ist es, der die Lektüre nie langweilig werden lässt. Sein Buch ist vollgestopft mit prägnanten ökonomischen Effekten, biologischen Hypothesen, psychologischen Experimenten und spieltheoretischen Modellen. Nur leider trägt der unterhaltsame interdisziplinäre Ansatz nicht unbedingt zur argumentativen Präzision des Buches bei. Auch die Suche nach den Gründen für den Niedergang der Gewalt, um deren willen Pinker vorgeblich die ganze Rechnerei unternommen hat, endet in einem unentschlossenen Medley der Gassenhauer zivilisationstheoretischer und politikwissenschaftlicher Theorie von Hobbes über Kant bis Norbert Elias, und zwar im Remix aktueller neurowissenschaftlicher Instrumente. Am Ende klingt das in etwa wie ein Ergebnis, das auch bei einer Straßenumfrage herausgekommen wäre: Wir haben halt gelernt, uns zu benehmen, dank Handel und Literatur, Leviathan und Gefangenendilemma, Vernunft, Moral und Völkerverständigung.
Was Pinker dabei leider völlig fehlt, ist der Blick für alles, was auch nur von weitem nach Dialektik aussieht, für all die Widersprüche und Ambivalenzen, die Vielfalt der Formen, Muster und Motive der Gewalt. Aufklärungskritische Einwände von Adorno bis Foucault meint er, in einer Fußnote erledigen zu können, weshalb sich sein Optimismus am Ende leider vor allem der Tatsache verdankt, dass er zentrale Einwände einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Dazu kommt ein humanistischer Ekel gegen die Praktiken seines Themas, der dazu führt, dass Pinker sein Untersuchungsgegenstand leider auch erkenntnistheoretisch fremd bleibt. Nicht nur ist es ihm unmöglich, wie er einmal bei der Schilderung einer Hinrichtung im alten Rom erwähnt, "sich in einen Menschen der Antike hineinzuversetzen, der sich eine solche Orgie der Grausamkeit ausdachte", er ist auch blind für die Transformationen, die die Gewalt im 20. Jahrhundert kennzeichnen, für Phänomene psychischer, politischer oder symbolischer Gewalt. Und deshalb wirken all seine fröhlichen Tabellen, in welchen er die Gewalt zum Verschwinden bringt, so überzeugend wie die Taschenspielertricks der Arbeitsmarktpolitiker, die Arbeitslose einfach so lange zu Ein-Euro-Jobbern machen, bis sie in der Statistik nicht mehr auftauchen.
Engel und Zombies
Am Ende bleibt der Verdacht, dass es sich beim Rückgang der Gewalt gar nicht um ein Verschwinden handelt, sondern nur um eine Verlagerung. Sie hört nicht auf, sie wird nur allmählich unsichtbar - was wohl genau der Grund ist für ihre anhaltende Präsenz und Popularität in medialer oder fiktionaler Form. In einem ebenfalls soeben erschienenen Buch beschreibt der südkoreanische Philosoph Byung-Chul Han, Professor an der Karlsruher Hochschule für Gestaltung, genau diesen topologischen Wandel. Gewalt, behauptet Han, kommt lediglich der "Schau-Platz abhanden". Sie wird nicht mehr als "Theater der Grausamkeit" öffentlich aufgeführt, sondern "weicht einer blutlosen Gaskammer". "Sie ist nun nicht mehr ein Teil politischer und gesellschaftlicher Kommunikation. Sie zieht sich in subkommunikative, subkutane, kapillare, innerseelische Räume zurück. Sie verlagert sich vom Sichtbaren ins Unsichtbare, vom Direkten ins Diskrete, vom Physischen ins Psychische, vom Martialischen ins Mediale und vom Frontalen ins Virale."
Die historische Verbreitung der "Selbstbeherrschung", einer jener "Besseren Engel", der für Pinker wesentlich zur Eindämmung der Gewalt beiträgt, bleibt nicht ohne Konsequenzen für die Psyche: Das Ich richtet den Kampf gegen sich selbst. Burn-out und Depression, die psychischen Krankheiten der spätmodernen Leistungsgesellschaft, sind demnach nicht länger die Folge äußerer Repressionen (wie noch die Hysterie oder die Zwangsneurose), sondern ein Resultat autoaggressiver, positiver Zwänge. "An die Stelle der fremdverursachten Gewalt tritt eine selbstgenerierte Gewalt, die fataler ist als jene, denn das Opfer wähnt sich in Freiheit."
Das Ende der Gewalt ist für Han nur um den Preis der Lebendigkeit zu haben; ein Leben ohne Tod ist das der Untoten. Pinker dagegen hat vor solchen Zombies offensichtlich keine Angst. Sie tauchen ja auch in keiner Statistik auf.
HARALD STAUN
Steven Pinker: "Gewalt". Verlag S. Fischer, 1178 Seiten, 26 Euro
Byung-Chul Han: "Topologie der Gewalt". Matthes & Seitz, 191 Seiten, 19,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Gewalt ist im Laufe der Menschheitsgeschichte zurückgegangen - so Steven Pinkers aufwändig illustrierte, dabei provozierend optimistische These. Eva Illouz, Soziologin der Liebe, zählt zunächst Pinkers Verdienste auf: Er ist belesen, faktenreich, sogar unterhaltsam. Aber sie ist dennoch alles andere als zufrieden mit Pinkers Buch. "Schlechte Wissenschaft" so lautet ihr vernichtendes Urteil am Ende, schlichte Thesen und keine emprirische Grundlage. Pangloss ist ihr Vergleich, also der lächerliche Optimist aus Voltaires "Candide". Und sie zitiert den dunklen Prinzen der jüngsten Philosophie, John Gray, der Pinker vorgeworfen habe, dass er den Export der Gewalt durch den Westen in kolonisierte Länder übersehe, obwohl sie durchaus zugesteht, dass auch die Mongolen nicht ganz ohne waren. Unbehagen empfindet Illouz bei Pinkers Verteidigung der Säkularisierung und Aufklärung. Und der religiös gestimmten Zeit-Redaktion wird ihre Erinnerung an die friedliche Botschaft des Christentums, die Pinker unterschlage, wohlgetan haben. Am Ende hat man trotzdem Lust, Pinker zu lesen. Schon weil er, wie Illouz selbst betont, so "erfrischend unmodisch" ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Die Argumente von Steven Pinker, die haben wirklich Gewicht, im wahrsten Sinne des Wortes [...] sehr überzeugend, ausdauernd, aber auch unterhaltsam Ralf Krauter Deutschlandfunk 20111218