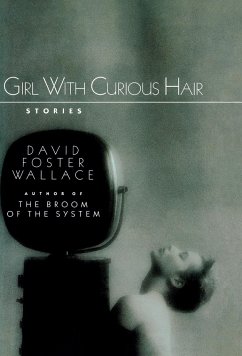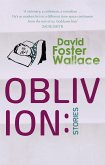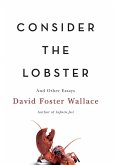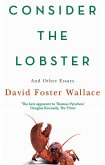Im Sprachlabor der Metafiktion: Fünf frühe Erzählungen von David Foster Wallace zeigen den Schriftsteller als Autor mit unbegrenzten Möglichkeiten.
Von Paul Ingendaay
Mit Ausnahme von William Gaddis hat es bei keinem der bedeutenden amerikanischen Postmodernisten so lange gedauert wie bei David Foster Wallace, bis seine Bücher auf Deutsch erschienen. Das lag nicht nur am manchmal gewaltigen Umfang; sein Hauptwerk "Unendlicher Spaß" kostete den Übersetzer Ulrich Blumenbach zwar sechs Jahre, doch zwischen dem Erscheinen der Originalausgabe 1996 und der Veröffentlichung der deutschen Version 2009 lag gut die doppelte Zeit. Leichter wurde es mit den teils erzählenden, teils essayistischen kürzeren Texten, auf die Wallace sich nach Abschluss seines Megaromans verlegt hatte. Nach dem Freitod des Schriftstellers 2008 im Alter von sechsundvierzig Jahren änderte sich die Lage noch einmal. Jetzt war es unvermeidlich, das Selbstmordmotiv im Werk des Autors und die düsteren Visionen eines Amerika, das sich besinnungslos dem Entertainment überlässt, autobiographisch zu lesen.
Man kann selbst die Probe machen. In Videos der seltenen Gelegenheiten, zu denen Wallace sich vor der Kamera äußerte, erlebt man einen scheuen, sensiblen und seiner eigenen Prominentenrolle gründlich misstrauenden Mann, der innezuhalten vermag und sich immer wieder fragt, ob das, was ihm aus dem Gehirn stürzt, überhaupt eine verständliche Antwort darstellt. Selten sieht man einen Künstler, der sich in Gesellschaft so unwohl fühlt. Gelegentlich rückt er nervös die Brille zurecht oder fasst sich an das Piratenkopftuch, das er trug, um seine Schweißausbrüche zu verbergen. Ja, er sei Mathematiker, sagt er in der Talkshow von Charlie Rose, und sein Roman "Unendlicher Spaß" sei gebaut wie ein "einfaches Fraktal". Nein, mit der Postmoderne könne er nichts anfangen, der Begriff sei verbraucht. Und nein, Bücher könnten kaum direkten Einfluss auf ihre Leser ausüben, weil es so lange dauere, einen dicken Roman zu lesen, und wenn der Autor zu Ruhm komme, helfe ihm das auch nicht, die wesentlichen Probleme seines Lebens zu lösen, man bleibe doch immer derselbe. Nur dass wir, seine Leser, seit seinem Todesjahr 2008 nicht mehr dieselben sind.
Jetzt hat sein deutscher Verlag frühe Erzählungen vorgelegt, genau die fünf, die beiseiteblieben, als 2001 fünf der zehn Geschichten des Originalbandes "Girl With Curious Hair" (1989) unter dem Titel "Kleines Mädchen mit komischen Haaren" auf Deutsch erschienen. "Alles ist grün", so der Titel, ist eine sehr gemischte Lieferung, nicht nur vom Umfang her, der von drei Seiten bis knapp zweihundert reicht, sondern auch in Bezug auf Themen, Stil und die erzählerischen Mittel. Die Eröffnungsstory ist stark: Zwei Manager lange nach Büroschluss in der riesigen Tiefgarage, einer droht zu sterben, der andere probiert Herz-Lungen-Wiederbelebung, sie sind allein, und Wallace nimmt das alles auf, als wäre er Mensch, Luchs und Spinne in einem. Ulrich Blumenbachs Übersetzung ist nicht nur brillant, sondern eine sprachschöpferische Leistung von eigenem Witz.
Obwohl Wallace' frühreife Begabung in jeder Geschichte anders pulsiert, hat man immer das Gefühl, einen Autor mit unbegrenzten Möglichkeiten zu lesen, den buchstäblich die Angst vor Langeweile und Konventionalität hinderte, massenmarkttauglicher zu schreiben. Dabei hätte er sie alle in die Tasche stecken können, seinen Freund Jonathan Franzen eingeschlossen. Wallace besaß eine wilde Phantasie, war fähig zum Kammerton, zur Stimmenimitation, zur Bauchrednerei, er konnte Dialoge schreiben und mit drei Zeilen durch eine Szene segeln, er hatte einen Blick für junge Menschen, alte Menschen, alte Sachen (wie in der anrührenden Story "Sag nie"), vorüberhuschende Landschaften und hinter der Mülltonne aufblitzende Epiphanien, und natürlich mochte er auch den Klamauk der Popkultur, nicht immer zu seinem Vorteil. In diesen frühen Erzählungen ist die Nähe zu Thomas Pynchon mit Händen zu greifen, den Hang zur Naturwissenschaft haben ja beide, doch Wallace wirkt wärmer und verletzlicher, als wäre sein persönlicher Einsatz noch etwas höher. Wenn das nicht schon eine rückwärtsgerichtete Projektion ist.
In "Hier und dort", einer dreißigseitigen Erzählung über eine gescheiterte Liebesbeziehung, ruft Wallace nicht die gemeinsame Geschichte des Paares auf, sondern schneidet die nachträglichen Rechtfertigungsmonologe der beiden so geschickt gegeneinander, dass sich beim Lesen die Empfindung von Schmerz und Vergeblichkeit einstellt. Der Zank der beiden Liebenden über den Wert von Gedichten gleicht in einer Nussschale dem Problem des Mathematikers Wallace gegenüber seinem Material. Während die Frau auf den Gefühlen besteht, die Lyrik in ihr wecke, redet der Mann von Axiomen, Zeichen und Funktionen. Wie überhaupt noch etwas darstellen, wenn die künstlerischen Darstellungsmittel durch Fernsehblödsinn und Konsumkultur längst absorbiert sind? "Er sagt, eine Epoche sterbe und er könne das Röcheln hören." Solche Verzweiflungssätze ragen immer wieder aus Wallace' Texten hervor und überstrahlen viel Begriffsgerümpel, das der damals jugendliche Autor im Überschwang in seine Bücher gekippt hat.
Das gilt besonders für die lange Erzählung "Westwärts geht der Lauf des Weltreichs", die drei Viertel des Bandes ausmacht und von der Wallace selbst sich später distanzierte, was uns wiederum nicht zu kümmern braucht. Schon in der grotesken Konstellation - ein PR-Mann will alle 44 000 Menschen, die jemals Fernsehwerbung für McDonald's gemacht haben, in einem Ort namens Collision in einem "Juxhaus" versammeln - liegt eine Auseinandersetzung des ehemaligen Creative-Writing-Studenten David Foster Wallace mit "Lost in the Funhouse", einem programmatischen Text des Schriftstellers und Postmoderne-Theoretikers John Barth. Die in die Story gestreuten Debatten über Realismus oder Metafiktion können schon damals nicht mehr taufrisch gewesen sein und sind es heute noch weniger; oft wirkt die bizarre Handlung um drei Studenten, die mit dem Werbemenschen und seinem Sohn durch die Maisfelder von Illinois reisen, bemüht und von nervigem College-Humor durchzogen.
Doch dann kommen Sätze wie diese: "Ein Winternachmittag in Illinois, der Schnee auf den Stoppelfeldern ein gutgebügeltes Laken, der Himmel blau wie brennendes Benzin, flach und weit wie alles im Freien, eine Untertasse mit unsanft geschwärzten Rändern." Es ist, als strömte eine Erinnerung herein und brächte die Seiten zum Leuchten; vielleicht hat Wallace auch nur dem getraut, was man mangels eines besseren Wortes poetische Eingebung nennen könnte, seinem hyperempfindlichen Sinn für Bilder, in denen lässiges Beobachten und äußerste Verletzbarkeit zusammenfinden. Gewiss ist, dass sein Produktionsrhythmus schon damals hoch war und unterschiedslos Banales wie umstürzend Schönes ausgestoßen hat. David Foster Wallace war ein Schriftsteller des Exzesses im anstrengenden und beflügelnden Sinn des Wortes, und es wäre einfältig, nur den einen der beiden haben zu wollen. So schaufelt man das Heu beiseite, um an die Diamanten zu kommen, und sagt sich: Es ist in Ordnung.
David Foster Wallace: "Alles ist grün". Storys.
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ulrich Blumenbach. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011. 268 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
This collection of ten tales provides ample proof of his virtuosity for the uninitiated... This is not a writer for the squeamish... but his satirical mastery of speech patterns and his eye for the grotesque can astonish. DAILY TELEGRAPH