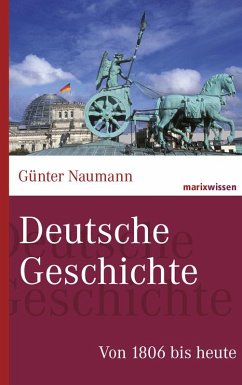Nicht lieferbar
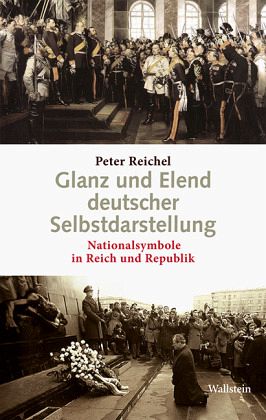
Glanz und Elend deutscher Selbstdarstellung
Nationalsymbole in Reich und Republik
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Nationalsymbole als Spiegelbild einer Nation: über Denkmäler, Bauten, Hymnen, Farben und Feiertage.Als eine sinnliche Nation ist Deutschland kaum auffällig geworden. Aber auch mit der SinnBILDlichkeit tut man sich hierzulande schwer, zumal in der Politik. Sie spiegelt in zeichenhaft verdichteter Weise, wovon hier berichtet werden soll: von Glanz und Elend der Selbstdarstellung einer Nation, die erst in jüngerer Zeit ein neues Verhältnis zu ihren politischen Farben, Festen und Liedern findet.Der kriegerische Kampf Deutschlands um seine national-staatliche Einheit hat den Deutschen viel und...
Nationalsymbole als Spiegelbild einer Nation: über Denkmäler, Bauten, Hymnen, Farben und Feiertage.Als eine sinnliche Nation ist Deutschland kaum auffällig geworden. Aber auch mit der SinnBILDlichkeit tut man sich hierzulande schwer, zumal in der Politik. Sie spiegelt in zeichenhaft verdichteter Weise, wovon hier berichtet werden soll: von Glanz und Elend der Selbstdarstellung einer Nation, die erst in jüngerer Zeit ein neues Verhältnis zu ihren politischen Farben, Festen und Liedern findet.Der kriegerische Kampf Deutschlands um seine national-staatliche Einheit hat den Deutschen viel und der Welt noch mehr zugemutet. Fünf verschiedene politische Systeme sind in gut einhundert Jahren ausprobiert und verschlissen worden. Revolutionen, Weltkriege, Gewaltverbrechen, Besatzungsherrschaft und Teilung waren der Preis, unser Land aus expansionistischer Aggression und politischer Regression herauswachsen zu lassen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland ein zivilisierter und fest integrierter Partner der Staatengemeinschaft geworden. In der Geschichte der symbolischen Selbstdarstellung Deutschlands sehen wir in das Spiegelbild einer Nation, die mehr als drei Generationen gebraucht hat, in diesem Sinne politisch erwachsen zu werden.