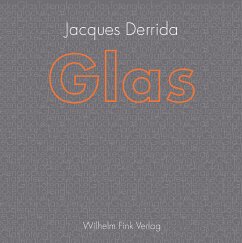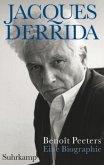Glas (Totenglocke), im Original 1974 erschienen, nimmt in Derridas Werk eine besondere Stellung ein; es ist eines seiner wichtigsten und enigmatischsten Bücher, das lange Zeit keinen Übersetzer im Deutschen gefunden hat und sich dennoch allen späteren, mittlerweile recht schnell ins Deutsche übertragenen Büchern immer schon paradigmatisch eingeschrieben hat. 'Schon die Form von Glas weicht ab; sie folgt - ohne erkennbaren Anfang, ohne Ende, ohne Kapiteleinteilungen - allein einem durchlaufenden Doppelspaltenprinzip, vielfach auch noch unterbrochen durch die Eröffnung weiterer kleiner 'Fenster' im Text, der also aus zwei Kolumnen, zwei Säulen, zwei simultanen Texten besteht, die zwei Autoren gewidmet sind, die auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben, und die zugleich zwei ganz unterschiedliche Diskurse, Genres repräsentieren: nämlich Philosophie und Literatur. Es handelt sich um Hegel und um Genet, den Denker der Familie und den Poeten der homosexuellen Liebe, die aber mit dieser Porträtierung schon einen gemeinsamen Nenner haben: die familiäre Strukturierung des Begehrens und vor allem die Liebe von Vater und Sohn. Im Kontext dieser Genealogie geht es auch und zentral um die unterschiedlichen Weisen der Trauerarbeit: um eine monumentale Aufrichtung des Gedächtnisses einerseits im System der hegelschen Dialektik und um eine nie zu Ende zu bringende Zeremonie des Abschieds, um das Totenfest, wie die deutsche Übersetzung von Genets Roman Pompes funèbre lautet.' Michael Wetzel
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Michael Wetzel schäumt vor Freude fast über, dass dieses zweite Hauptwerk von Jacques Derrida nun endlich auch auf Deutsch vorliegt. Lange genug hat es gedauert, "Glas" ist im Original bereits 1974 erschienen und stammt damit aus der "wilden Zeit des Denkers", was nicht nur inhaltlich, sondern auch formal ins Auge springt. Derrida macht sich hier daran, Hegel zu dekonstruieren, genauer gesagt seinen Begriff der "Aufhebung", den der französische Denker als Verneinung und Verleugnung betrachtet, wie der Rezensent erklärt. Dabei stellt Derrida seinen Reflexionen zu Hegel Betrachtungen zum poetischen Werk von Jean Genet gegenüber: Zwei Textkolumnen, die durch keine weiteren Kapitel untergliedert sind, stattdessen durch Zitate mehrmals unterbrochen werden und vergeblich nach einem festen Bezug suchen lassen. Wetzel wundert es daher nicht, dass die "Theoretiker des Hypertextes" in diesem Buche einen Meilenstein sahen, gleich neben James Joyces "Finnegans Wake". Ganz "kolossal" findet Wetzel dieses auf zwei Säulen ruhende Werk und schließt in seine Begeisterung auch die Übersetzung von Hans-Dieter Dondek und Markus Sedlaczek ein, die "eine schier wahnsinnige Arbeit gründlicher Recherche mit sprachlicher Eleganz" verbinden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH