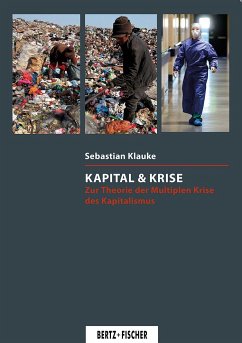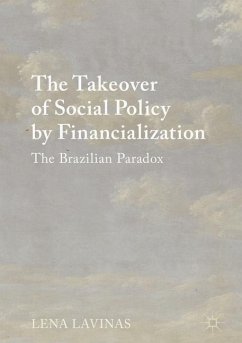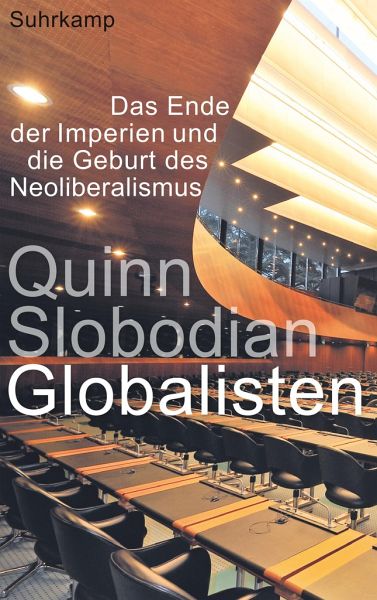
Globalisten
Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus
Übersetzung: Gebauer, Stephan

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nachdem Handelspolitik lange eine Sache spezialisierte Juristen war, ist sie heute ein Feld heftiger politischer Auseinandersetzungen: Beim Brexit steht der freie Warenverkehr auf dem Spiel, Donald Trump droht deutschen Autobauern mit Schutzzöllen.In seinem Buch, das in der englischsprachigen Welt für Furore sorgt, wirft Quinn Slobodian einen neuen Blick auf die Geschichte von Freihandel und neoliberaler Globalisierung. Im Mittelpunkt steht dabei eine Gruppe von Ökonomen um Friedrich von Hayek und Wilhelm Röpke. Getrieben von der Angst, nationale Massendemokratien könnten durch Zölle ode...
Nachdem Handelspolitik lange eine Sache spezialisierte Juristen war, ist sie heute ein Feld heftiger politischer Auseinandersetzungen: Beim Brexit steht der freie Warenverkehr auf dem Spiel, Donald Trump droht deutschen Autobauern mit Schutzzöllen.
In seinem Buch, das in der englischsprachigen Welt für Furore sorgt, wirft Quinn Slobodian einen neuen Blick auf die Geschichte von Freihandel und neoliberaler Globalisierung. Im Mittelpunkt steht dabei eine Gruppe von Ökonomen um Friedrich von Hayek und Wilhelm Röpke. Getrieben von der Angst, nationale Massendemokratien könnten durch Zölle oder Kapitalverkehrskontrollen das reibungslose Funktionieren der Weltwirtschaft stören, bestand ihre Vision darin, den Markt auf der globalen Ebene zu verrechtlichen und so zu schützen.
Slobodian begleitet seine Protagonisten durch das 20. Jahrhundert. Er zeigt, wie sie auf neue Herausforderungen - die Entkolonialisierung etwa oder die europäische Integration - reagierten und auseiner Außenseiterposition heraus die Deutungshoheit eroberten.
In seinem Buch, das in der englischsprachigen Welt für Furore sorgt, wirft Quinn Slobodian einen neuen Blick auf die Geschichte von Freihandel und neoliberaler Globalisierung. Im Mittelpunkt steht dabei eine Gruppe von Ökonomen um Friedrich von Hayek und Wilhelm Röpke. Getrieben von der Angst, nationale Massendemokratien könnten durch Zölle oder Kapitalverkehrskontrollen das reibungslose Funktionieren der Weltwirtschaft stören, bestand ihre Vision darin, den Markt auf der globalen Ebene zu verrechtlichen und so zu schützen.
Slobodian begleitet seine Protagonisten durch das 20. Jahrhundert. Er zeigt, wie sie auf neue Herausforderungen - die Entkolonialisierung etwa oder die europäische Integration - reagierten und auseiner Außenseiterposition heraus die Deutungshoheit eroberten.