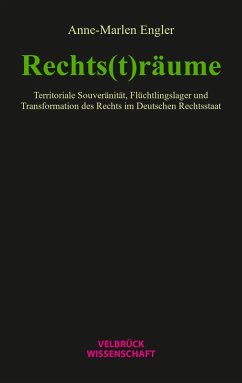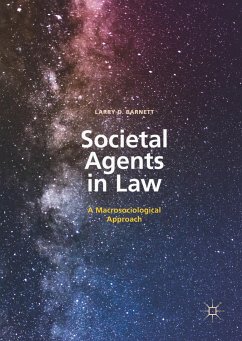Globalverfassung
Die Geltungsbegründungder Menschenrechte im postmodernen ius gentium
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
38,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Andreas Fischer-Lescano befasst sich mit den Geltungsgrundlagen des Weltrechts. Im Zentrum seiner rechtssoziologischen Untersuchung steht die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit eines globalen Menschenrechts. Er zeichnet die Binnendifferenzierungen dieses Weltrechts und seine strukturelle Kopplung an die Weltpolitik nach. In der Tradition rechtspluralistischer Theorien beschreibt er globale Skandalisierungsprozesse, in denen Menschenrechtsbewegungen und NGOs auf Verletzungen aufmerksam machen, und betont die weltrechtsetzende Dimension der zivilgesellschaftlichen Rechtskommunikationen,...
Andreas Fischer-Lescano befasst sich mit den Geltungsgrundlagen des Weltrechts. Im Zentrum seiner rechtssoziologischen Untersuchung steht die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit eines globalen Menschenrechts. Er zeichnet die Binnendifferenzierungen dieses Weltrechts und seine strukturelle Kopplung an die Weltpolitik nach. In der Tradition rechtspluralistischer Theorien beschreibt er globale Skandalisierungsprozesse, in denen Menschenrechtsbewegungen und NGOs auf Verletzungen aufmerksam machen, und betont die weltrechtsetzende Dimension der zivilgesellschaftlichen Rechtskommunikationen, die das Geltungssymbol des Rechts transportieren können, wenn sie das Skript einer colère publique mondiale annehmen.Fischer-Lescano verbindet in seiner Untersuchung zum transnationalen Recht gesellschaftstheoretische und juristische Beschreibungsformen. Er setzt an der Beobachtung einer Diversifizierung globaler Akteure und dem Diskurs über globalen Konstitutionalismus an und zeigt auf, dass globale Rechtsentwicklungen keineswegs durch die traditionellen Völkerrechtssubjekte, die Staaten, getragen werden, sondern durch die Weltgesellschaft selbst. Die im Völkerrecht langsam Raum gewinnende Erkenntnis partialer Völkerrechtssubjektivität nicht-staatlicher Akteure ist somit zwar eine begrüßenswerte Reaktion des Weltrechts auf eine komplexer gewordene außerrechtliche Umwelt. Diese partiale Öffnung reicht allerdings nicht aus, sondern ist erst dann weltgesellschafts-adäquat, wenn sie die weltgesellschaftlichen Rechtssetzungsmechanismen, das weltgesellschaftliche Gewohnheitsrecht, das Fischer-Lescano als lex humana des postmodernen ius gentium reformuliert, anerkennt. Er zeigt, dass sich trotz dieser defizitären Umweltadäquanz auf der Ebene der Weltgesellschaft ein Rechtssystem ausdifferenzieren konnte. Dieses hat sein Zentrum in den heterarchisch organisierten Weltgerichten, den global remedies nationalstaatlicher und internationaler Provenienz. Aufgrund der Permeabilität der Staaten und der weltrechtlichen Normierung von Individualpflichten und -rechten ist dieses Weltrecht kein lediglich zwischenstaatliches Recht mehr, sondern steht dem stoischen ius gentium näher als dem Post-Victorianischen ius inter gentes. Das postmoderne ius gentium ist mit dem weltpolitischen System über die politische Globalverfassung strukturell gekoppelt, auch wenn in dieser der genetische Rechtspluralismus in der Weltgesellschaft bislang nur zögerlich berücksichtigt wird und die größte Herausforderung für den globalen Konstitutionalismus in der Ausweitung des Jurisdiktionsbereichs der Weltgerichte liegt.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.