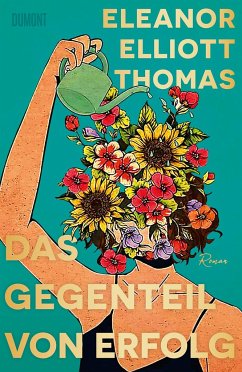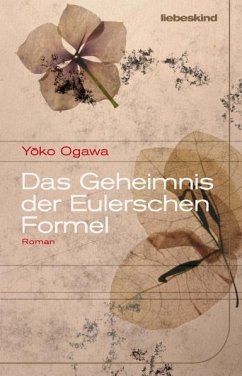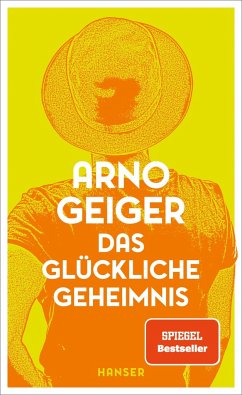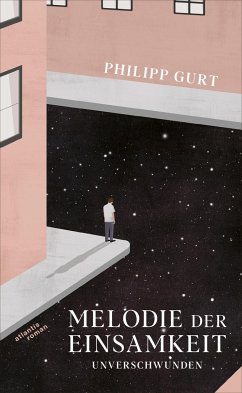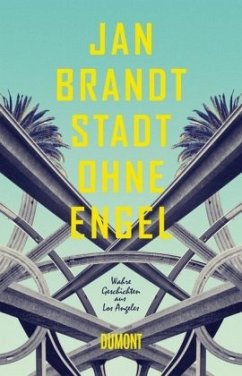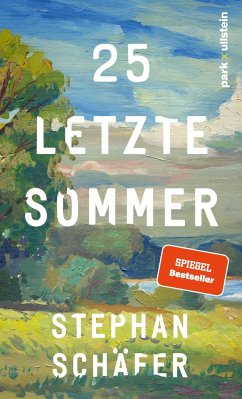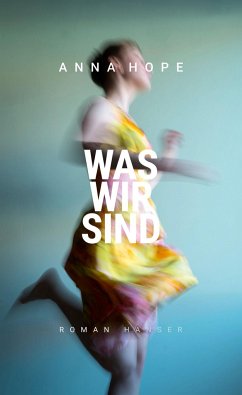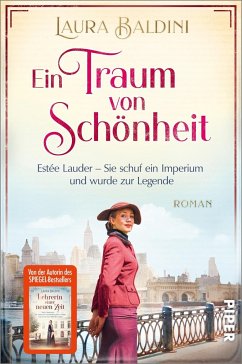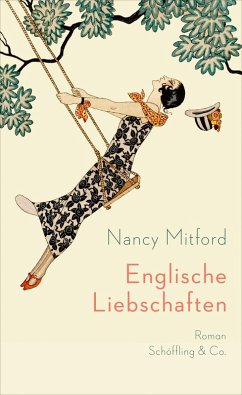Goethe ruft an
Roman

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Es gibt zwei Sorten von Schriftstellern: die strahlenden Zauberer und die erfolglosen Zweifler. Der Erzähler von John von Düffels neuem Roman gehört zweifellos zu den Erfolglosen. Seit Jahren schon sitzt er "an etwas Größerem". Doch er hat einen Förderer: Goethe. Der heißt natürlich nicht wirklich so - doch wenn irgendjemand heute Goethes Format hat, dann er. Ein Klassiker zu Lebzeiten, ein Literaturgott. Seine Lesungen gleichen Messen. Oder Rockkonzerten. Goethe überredet den Freund, ihn bei einer Veranstaltung in der Lausitz zu vertreten. Seine Assistentin bringe ihm den Ordner mit ...
Es gibt zwei Sorten von Schriftstellern: die strahlenden Zauberer und die erfolglosen Zweifler. Der Erzähler von John von Düffels neuem Roman gehört zweifellos zu den Erfolglosen. Seit Jahren schon sitzt er "an etwas Größerem". Doch er hat einen Förderer: Goethe. Der heißt natürlich nicht wirklich so - doch wenn irgendjemand heute Goethes Format hat, dann er. Ein Klassiker zu Lebzeiten, ein Literaturgott. Seine Lesungen gleichen Messen. Oder Rockkonzerten. Goethe überredet den Freund, ihn bei einer Veranstaltung in der Lausitz zu vertreten. Seine Assistentin bringe ihm den Ordner mit den Unterlagen gleich vorbei, der alles enthalte, was zum erfolgreichen Schreiben nötig sei. Aber Vorsicht: Es ist sein einziges Exemplar. So kommt der Erzähler in den Besitz der Goethe-Formel. Und macht gleichzeitig die Bekanntschaft von Frau Eckermann. Sind Formel und Frau bei ihm in guten Händen?
"Goethe ruft an" erzählt die ebenso rasante wie charmante Jagd nach dem Geheimnis des Erfolgs - und nähert sich darin auf augenzwinkernde Weise dem Schnittpunkt von Lesen und Leben.
"Goethe ruft an" erzählt die ebenso rasante wie charmante Jagd nach dem Geheimnis des Erfolgs - und nähert sich darin auf augenzwinkernde Weise dem Schnittpunkt von Lesen und Leben.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.