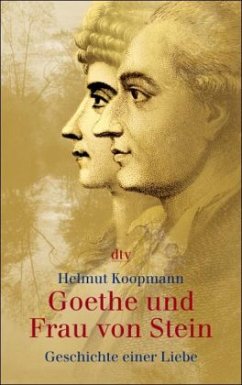Die Liebe zu Charlotte von Stein war wohl die einzig wirklich große Liebesbeziehung im Leben Goethes. In ihrer Intensität ist sie unvergleichlich: Fast 1800 Briefe hat Goethe an Charlotte gesandt, fast zwölf Jahre hatte ihre Liebe Bestand.
Am Anfang stand nur ein Schattenriss, den er von ihr sah - am Ende zerbrach die Beziehung, aus Gründen, über die der Briefwechsel zumindest in Andeutungen Auskunft gibt. »Ich konnte mich nicht satt an Dir sehen«, schreibt Goethe einmal. Was an dieser Liebe ist Fiktion, Traum, Wunsch, Sehnsucht, was ist Wirklichkeit?
Selten sind Liebesbriefe in einer schöneren Sprache geschrieben worden, fast nie hat Goethe sich sonst in seinen Gefühlen so enthüllt wie in den Botschaften an Charlotte von Stein. Helmut Koopmann erzählt in diesem Buch die Geschichte einer Liebe, eines Liebesverrats, einer Liebeskatastrophe.
Eine Liebesgeschichte, gepflegt mit »einer exzessiven Diskretion, die noch nach so langer Zeit die Phantasie mehr beflügelt als alle wilden Gerüchte.« Süddeutsche Zeitung
Am Anfang stand nur ein Schattenriss, den er von ihr sah - am Ende zerbrach die Beziehung, aus Gründen, über die der Briefwechsel zumindest in Andeutungen Auskunft gibt. »Ich konnte mich nicht satt an Dir sehen«, schreibt Goethe einmal. Was an dieser Liebe ist Fiktion, Traum, Wunsch, Sehnsucht, was ist Wirklichkeit?
Selten sind Liebesbriefe in einer schöneren Sprache geschrieben worden, fast nie hat Goethe sich sonst in seinen Gefühlen so enthüllt wie in den Botschaften an Charlotte von Stein. Helmut Koopmann erzählt in diesem Buch die Geschichte einer Liebe, eines Liebesverrats, einer Liebeskatastrophe.
Eine Liebesgeschichte, gepflegt mit »einer exzessiven Diskretion, die noch nach so langer Zeit die Phantasie mehr beflügelt als alle wilden Gerüchte.« Süddeutsche Zeitung

Helmut Koopmann deutet Goethes Briefe an Frau von Stein
Ein Handschuh als Zeichen, Pfirsiche und Birnen, die man sich schenkt, eine vergebens gesuchte Blume - davon sprechen die beiden Zettelchen Goethes an Charlotte von Stein, die gerade im Nachlaß der Familie Stein entdeckt worden sind (F.A.S. vom 26. Mai), die letzten aus einer wahren Flut. Fern allen Sensationen fügen sie sich in das uns bekannte Bild. Einfacher, unprätentiöser und inniger kann es nicht zugehen. Auf Anhieb wird der Charme einer großen Liebe wach.
Es trifft sich gut, daß kurz vor diesem Fund die Geschichte dieser Liebe neuerlich dargestellt worden ist, als jüngstes Glied einer Kette, die über hundertfünfzig Jahre zurückreicht. Als Gustav Adolf Schöll 1848/51 die damals auffindbaren Briefe Goethes an Frau von Stein an die Öffentlichkeit brachte, kam ein Geheimnis zutage, das gleichwohl seine Rätsel auch weiterhin hütete. Die Liebesgeschichte des Genies mit einer sieben Jahre älteren verheirateten Frau und ihr katastrophales Ende setzte die Gemüter fortab in Wallung. Die Schuldfrage fochten "edle Stein-Ritter" (Edmund Hoefer) und Stein-Ankläger aus; die möglicherweise heiklen Umstände der Liaison fielen in die Hände von "platten Gesellen" mit "Auskunftei-methoden und Lakaien-psychologie". Friedrich Gundolf, der solchermaßen drastisch befand, scherte sich deshalb nicht weiter um die Empirie, machte Frau von Stein zum Weimarer "Urerlebnis" Goethes, das Italien präfigurierte und in Iphigenie wie in Tassos Prinzessin Gestalt annahm. "Nur das symbolisch Fruchtbare, nicht das zufällig Passierte hat Wirklichkeit."
Daß solche hochgemuten Machtsprüche auf Dauer nicht geholfen haben, zeigt der Fragenkatalog - er füllt beinahe zwei Seiten -, mit dem Helmut Koopmann die neueste Darstellung dieser Liebesgeschichte eröffnet. "Wie war die Wirklichkeit dahinter?" - darauf läuft jetzt wieder alles hinaus. Allerdings erhält die Neugierde rasch einen Dämpfer: "Was wirklich geschah, wird sich nie genau ermitteln lassen." Fragen über Fragen und doch keine definitiven Antworten, damit fällt dem redlichen Biographen die nicht ganz leichte Aufgabe zu, "ahnungsweise" nachzuzeichnen, was geschehen sein könnte.
Er beschränkt sich dabei, notgedrungen, denn Charlotte von Stein hat ihre eigenen Briefe von Goethe zurückgefordert und vernichtet, auf die weit über 1600 Zettelchen, Botschaften, Billetts, Briefe, die Goethe, manchmal mehrfach an einem Tag, der Geliebten geschrieben hat, zehn oder, rechnet man das italienische Reisetagebuch mit, zwölf Jahre lang. Noch kein Leser hat sich der Faszination dieser unerhörten Zeugnisse entziehen können, für die Goethe-Beschämungs-Fraktion sind sie das reinste Gift. Auch Koopmann hält mit seiner Bewunderung nicht zurück: ein Brief "eindringlicher und großartiger als der andere", kaum zu überbietende "Liebesprosa", geweckt vom "ungeheuerlichen" Zauber dieser Frau, und dies alles in inständiger, unpathetischer Alltäglichkeit.
Die Suche nach den Geheimnissen "dahinter" hält Koopmann am kurzen Zügel. Andeutungen erlaubt er sich - "Nur Tanz? Einiges mehr schon . . .", um sie doch gleich mit einem "Wir wissen es nicht" in den Schwebezustand zu versetzen. Sensationen und Enthüllungen haben also einen schweren Stand, ihretwegen ist das Buch glücklicherweise nicht geschrieben worden.
Das Nachzeichnen geht lange so fort, sensibel, geduldig und nobel, bis Koopmann mit seiner Generalthese herausrückt und sich nun doch als Ankläger zu erkennen gibt. Denn mit der Flucht nach Italien begeht und offenbart Goethe einen "Liebesverrat", der nachträglich die ganze Liebesgeschichte ins Zwielicht rückt. Literarisch ist dieser Verrat, weil Goethe, vom Verschweigen der Reisepläne ganz abgesehen, sein Tagebuch für die Geliebte jetzt unverhohlen als literarisches Werk konzipiert, "kommunikabel", also eigentlich "für Verlag und Öffentlichkeit" bestimmt. Formeln, Floskeln, Lügen, "schlimm", "schamlos", "unglaubwürdig" - mit der Zurückhaltung des Biographen ist es vorbei. Goethe "interessiert sich für sich selbst", nur für sich selbst, und dies als Autor - endlich hat Koopmann zu einer Pointe gefunden, die ihn der Rolle des affirmativen Liebeskommentators enthebt, endlich wird Goethe belangbar. Rasch tut Koopmann die Liebeskatastrophe und die Nachbilder der Frau von Stein, die immerhin bis zur Makarie der "Wanderjahre" reichen, ab, um statt dessen in einer "abschließenden Würdigung" seine Pointe zu befestigen. Von der zehnjährigen Liebesmagie bleiben nur noch "Lebenstrümmer" übrig, allerdings literarisch wertvolle.
Als hätte ihn Frustration zu dieser Konsequenz getrieben, verhandelt Koopmann zunächst aber noch einmal das beliebte "Wie intim war es?", in einem Hin und Her, das mit der Kleistschen Auskunft "Kann sein -, auch nicht" und mit einer nur vom Leser auszufüllenden Leerstelle schließt: "Das mag sich der Leser selbst zusammenreimen." Festeren Halt soll hingegen die Formel "monologische Kunst" geben, mit der Koopmann nun zu seiner Deutung der Liebesgeschichte ausholt. Alles, also die anderthalbtausend Briefe, war Literatur, so ist jetzt zu hören, war womöglich nur "Sprachkunst", "Kunstwerk", waren "Schreibübungen amoris causa", "Schreibübungen also in eroticis, eine Liebe in litteris", mit deren Hilfe der schreibende Goethe die "ungeheuerliche Herausforderung" des schlichten Satzes "Ich liebe dich" zu bewältigen suchte.
Kaum mehr als ein "Stimulans" oder gar ein "Liebesphantom" war dann die Empfängerin, letzteres freilich mit dem Zusatz: "Natürlich nicht, und dennoch, Goethe hat oft von ihr geträumt, und alle seine Liebesbriefe sind ein einziger Traum." Daß dieser Traum mit einer "unio mystica" zu tun habe, rettet den desaströsen Befund so wenig wie die stilistischen Vorsichtsmaßnahmen, die ihn abschwächen möchten. Wohl soll die "wirkliche Liebe" angesichts der Liebe in Briefen nicht ganz ausgeschlossen werden. "Aber es macht sie, gemessen an der Intensität dieser Sprache, zwar nicht gerade bedeutungslos, aber vielleicht doch fast schon ein wenig zweitrangig." Da drängen sich die Kautelen und helfen doch nicht, so wenig wie in der Frage: "Sind diese Briefe an Charlotte von Stein nicht doch hin und wieder und dann fast ausschließlich monologische Schreibkunst?" Unglücklicher kann man eine große Liebesgeschichte, vielleicht die größte der deutschen Literatur, schwerlich entkernen. "Monologisch" ausgerechnet soll sie gewesen sein - hat der Verfasser vergessen, daß er es nur mit einem halbierten Briefwechsel zu tun hat? Gerät er da nicht in eine Falle, die ihm die Quellenlage stellt?
Walter Hof, dem wir die wohl beste Darstellung über Goethe und Frau von Stein verdanken, hat Gundolf gerügt, weil der aus dem Erlebnis "Charlotte von Stein" das dichterische Erlebnis "Lida" gemacht habe, auf Kosten von Goethes Humanität. Doch schon der ganz unprätentiöse Stein-Biograph Wilhelm Bode hält vor beinahe hundert Jahren ähnlichen Versuchen die seltsame Fehleinschätzung Goethes vor: "Ich glaube nicht, daß der Erzrealist Goethe . . . mehr als ein Dutzend Jahre ein Erzphantast gewesen sei, sobald nämlich Frau v. Stein in's Spiel kam, und daß dieser wahrhaftigste Diener der Wahrheit so viele Jahre vor einem selbstgemachten Götzenbilde gekniet habe."
Ebensowenig kann man, darin sind sich alle Zeitgenossen einig, am Rang der Charlotte von Stein zweifeln. Der Weimarer Knebel, der sie gut kannte, hat über sie gesagt: "Reines, richtiges Gefühl bei natürlicher, leidenschaftsloser, leichter Disposition haben sie bei eigenem Fleiß und durch den Umgang mit vorzüglichen Menschen . . . zu einem Wesen gebildet, dessen Dasein und Art in Deutschland schwerlich oft wieder zustande kommen dürfte." Koopmann hat die Protagonisten seiner Liebesgeschichte entschieden unterschätzt.
HANS-JÜRGEN SCHINGS
Helmut Koopmann: "Goethe und Frau von Stein. Geschichte einer Liebe". Verlag C.H. Beck, München 2002. 282 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main