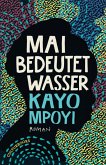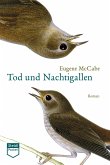China, Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine christliche Aufstandsbewegung überzieht das Kaiserreich mit Terror und Zerstörung. Ein junger deutscher Missionar, der bei der Modernisierung des riesigen Reiches helfen will, reist voller Idealismus nach Nanking, um sich ein Bild von der Rebellion zu machen. Dabei gerät er zwischen die Fronten eines Krieges, in dem er am Ende alles zu verlieren droht, was ihm wichtig ist. An den Brennpunkten des Konflikts - in Hongkong, Shanghai, Peking - begegnen wir einem Ensemble so zerrissener wie faszinierender Persönlichkeiten: darunter der britische Sonderbotschafter, der seine inneren Abgründe erst erkennt, als er ihnen nicht mehr entgehen kann, und ein zum Kriegsherrn berufener chinesischer Gelehrter, der so mächtig wird, dass selbst der Kaiser ihn fürchten muss.
In seinem packenden neuen Buch erzählt Stephan Thome eine Vorgeschichte unserer krisengeschüttelten Gegenwart. Angeführt von einem christlichen Konvertiten, der sich für Gottes zweitenSohn hält, errichten Rebellen in China einen Gottesstaat, der in verstörender Weise auf die Terrorbewegungen unserer Zeit vorausdeutet. Ein großer und weitblickender Roman über religiösen Fanatismus, über unsere Verführbarkeit und den Verlust an Orientierung in einer sich radikal verändernden Welt.
In seinem packenden neuen Buch erzählt Stephan Thome eine Vorgeschichte unserer krisengeschüttelten Gegenwart. Angeführt von einem christlichen Konvertiten, der sich für Gottes zweitenSohn hält, errichten Rebellen in China einen Gottesstaat, der in verstörender Weise auf die Terrorbewegungen unserer Zeit vorausdeutet. Ein großer und weitblickender Roman über religiösen Fanatismus, über unsere Verführbarkeit und den Verlust an Orientierung in einer sich radikal verändernden Welt.

Stephan Thomes Roman aus dem alten China: "Gott der Barbaren"
Ein Schriftsteller kann sich kein größeres Thema wünschen als die Taiping-Rebellion und die Opiumkriege. Ein Volksaufstand, der fünfzehn Jahre dauert und zwanzig bis dreißig Millionen Tote kostet; eine Kette von Schlachten, Belagerungen, Verträgen, die bis heute Chinas Verhältnis zum Westen prägt. Es ist ein Stoff von "Krieg und Frieden"-Dimensionen, ein epischer Brocken, und wer ihn anpackt, muss vorher tief Luft holen.
Also hat sich Stephan Thome einen Plan gemacht. Vier Hauptfiguren, zwei davon als Ich-Erzähler, zwei weitere in allwissender Er-Prosa von oben und innen beleuchtet, das ist seine Strategie in "Gott der Barbaren". Das erste Ich gehört dem deutschen Missionar Philipp Neukamp, genannt Fei Lipu, der aus der gescheiterten Revolution von 1848 nach Hongkong geflohen ist; durch seine Missionsarbeit hat er einen der Köpfe der Taiping-Rebellen kennengelernt, dem er bald quer durch Südchina nach Nanking folgt, ins Zentrum des Aufstands. Die zweite Ich-Stimme ist das Mädchen Huang Shuhua, das durch den Bürgerkrieg obdachlos geworden und bei einem reichen Gönner untergekommen ist; auch sie will sich nach Nanking durchschlagen, wo ihre Familie lebt und ihr Vater eine Druckerei betreibt.
Zwei Opfer also, zwei Getriebene, die versuchen, im Chaos den Kopf über Wasser zu halten. Daneben zwei Stimmen von der anderen Seite, zwei Mächtige, ein General und ein Diplomat: Zeng Guofan, der Anführer der Hunan-Armee, einer privaten Söldnertruppe, auf die der Kaiserhof in Peking nach der Niederlage seiner eigenen Heere seine Hoffnungen auf Niederschlagung des Aufstands setzt; und James Bruce, der achte Earl of Elgin, der die britisch-französischen Expeditionen der Jahre 1858 und 1860 anführt und so zu einer Zentralfigur der Kolonialgeschichte Chinas und Europas wird. Dazu kommen, über fünfundzwanzig Kapitel des Buches verstreut, weitere Zeitzeugen und -zeugnisse: Briefe, Zeitungsberichte, Parlamentsprotokolle, zwei Schnappschüsse der verwirrten Seele des Hong Xiuquan, eines christlich inspirierten Sektierers, der sich für den Bruder Jesu hält und als "Himmlischer König" die Aufständischen in Nanking anführt. Aus all den Puzzleteilen - und den Leerstellen dazwischen - entsteht ein Panorama der Jahre um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als das China der Qing-Dynastie kurz vor dem Zusammenbruch stand und das Invasionsheer des Westens wie eine Klinge in seinen geschwächten Körper eindrang.
Aber es bleibt ein Puzzlespiel. Der Ton, der Schauplatz, die Perspektive, die Kostümierung des Geschehens wechseln von einer Buchseite zur nächsten. Es ist wie bei einer der Fantasy- und History-Serien von Netflix oder HBO, wo man höllisch aufpassen muss, um den Faden der Ereignisse nicht zu verlieren: hier die militärische Lage vor der Festung Anqing, dort eine Audienz beim Qing-Kaiser; hier eine Sektentaufe, ein Liebesritual, ein diplomatisches Duell, dort eine Flussfahrt auf dem Jangtsekiang. Ein Buch zum Verschlingen also, zum binge reading, zum atemlosen Konsum. Nur dass es für diese Art des Lesens zugleich seltsam ungeeignet ist, seltsam gelehrt, vergrübelt - und stellenweise, allen äußeren Höhepunkten zum Trotz, seltsam flach. Ein großer Stilist war Stephan Thome schon in seinen früheren, zu Recht gelobten Romanen "Grenzgang", "Fliehkräfte" und "Gegenspiel" nicht, eher ein kluger Zeichner von Seelen und Situationen. Hier, in "Gott der Barbaren", handhabt er den Pinsel der Sprache, als wäre es ein Schablonenstempel. Eine Stadt, die Neukamp auf seiner Reise durchquert, besteht aus "soliden" Häusern an "lauschigen" Kanälen, ihre Gärten haben "schmucke" Pavillons, ringsum erheben sich "grüne Hügel", und der Himmelskönig Hong stammt aus der Augsburger Puppenkiste: "Der sandfarbene Bart fiel ihm bis auf die Brust, die Augen saßen tief in den Höhlen und funkelten wie feuchte Kohlenstücke." Bei solcher Beschreibungsdichte muss man sich über plötzliche Blackouts nicht wundern: "Hier bin ich, dachte er und spürte die Zäsur, die genau darin lag: dass er hier war." Kann man so eine Zäsur auch als Wellness-Zutat buchen?
Ein Vorzug des Romans ist, dass er sich an keinem Ort festbeißt. Die Umwälzungen, die er schildert, reißen seine Figuren mit sich fort, nach Kanton, Tianjin, Peking oder Schanghai, quer über die Landkarten, die in der vorderen und hinteren Umschlagklappe zu sehen sind. Dabei übt sich der Erzähler in der Kunst des Auslassens: Eine Schlacht wird beschrieben, eine andere übersprungen, ein Massaker ausgemalt, das andere in einer Rückblende versteckt. Die wichtigste Episode des Zweiten Opiumkriegs, die Zerstörung des kaiserlichen Sommerpalasts bei Peking, dessen Ruinen heute als Mahnmal der nationalen Schande gepflegt werden, erledigt Thome in einem Nebensatz. Umso ausführlicher beschwört er die Palastkulisse vor dem Untergang: "Mit den Augen folgte Lord Elgin den Linien der gestutzten Hecken bis zur Mitte, wo in einem Pavillon mit Kuppeldach ein leerer Thron stand. Dort musste der Kaiser gesessen haben. In den Gängen lagen zerbrochene Fächer und Flakons herum, vollgepisste Schals und seidene Schuhe . . . Staub geriet ihm in den Hals, er spuckte aus und war völlig außer Atem, als er sein Ziel erreichte. Ein Thron aus Rosenholz. ,Rule, Britannia!' hatte ein tapferer Engländer in die Sitzfläche geritzt."
Es ist eine Vision, ein Moment, den es nie gegeben hat, genauso wie die andere zentrale Szene des Buchs, in der Elgin in seiner Schiffskajüte über eine namenlose Chinesin herfällt, um ihren "goldenen Lotus", ihren Schnürfuß, zu sehen. ",Mein Lotusengel', keuchte er und zog an ihrem Schuh." Da bricht die Erzählung ab. Drei Jahre später, auf dem Totenbett, kann Elgin sich nicht mehr erinnern, was wirklich geschah. Vielleicht ist es das Beste, was man über diesen 700-Seiten-Roman sagen kann: dass er um eine Leerstelle kreist, dass er nicht so tut, als könnte er das Geheimnis der chinesischen Seele wirklich enthüllen.
Aber diese Zurückhaltung hat ihren Preis. Er besteht darin, dass Stephan Thome eben keinen schmissigen, serientauglichen Großroman abgeliefert hat, sondern ein heikleres, fragileres Konstrukt. Den Lesefutterknechten wie Ken Follett, dessen Romanmanufaktur immer neue Riesenschwarten produziert, wollte Thome nicht nacheifern, aber eine historische Skizze war ihm auch nicht genug. So hat er ein Zwischending gewählt: ein Patchwork aus Episoden, durch die man wie durch ein Fenstergitter in einen Hexenkessel blickt. Man sieht darin so einiges. Aber man bleibt draußen.
ANDREAS KILB
Stephan Thome: "Gott der Barbaren". Roman. Suhrkamp, 719 Seiten, 25 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Stephan Thomes Roman erzählt gekonnt die turbulente und hochkomplexe Geschichte Chinas aus der Perspektive unterschiedlicher Akteure. ... Aufgrund seiner exzellenten China-Kenntnisse gelingt es dem in Taipeh beheimateten Sinologen ... , ein Kapitel der chinesischen Geschichte erlebbar zu machen, dessen Beschreibung auch für Historiker eine enorme Herausforderung darstellt.« Alexis Schwarzenbach NZZ am Sonntag 20181209