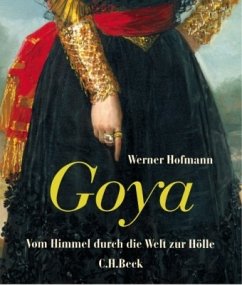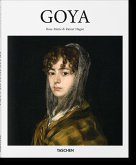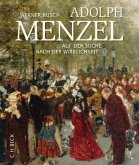Die Bahnbrecher des Neuen am Ende des 18. Jahrhunderts, und Francisco Goya y Lucientes (1764-1828) ist einer von ihnen, sind bestürzend zweideutig - moralisch wie ästhetisch. So lautet Werner Hofmanns Fazit seines hier vorgelegten Bandes, der in einem brillanten Bogen Leben und Werk des spanischen Malers nachzeichnet.
Der Bilderkosmos Goyas reicht von den frühen Teppichkartons und ihrer delikaten Formenvielfalt des Rokokos bis zu den Schwarzen Gemälden seiner späten Jahre und den graphischen Serien der Caprichos, Desastres und Proverbios, vom Gesellschaftsportrait über die Sittenchronik bis zur "Welt als Tollhaus", in dem diesseitige und jenseitige Hölle sich verschränken. Auch die religiösen Bilder geraten Goya zum Traditionsbruch: "... in der Malerei gibt es keine Regeln."
Folgt man den hellsichtigen Visionen des Malers, so erfüllen Absurdes und Irrationales die Welt. Goya benennt deren Abgründe in ihrer teuflischen Schönheit. Aber er zügelt die barbarischen Schrecknisse nicht, sondern bannt sie und steigert sie formal. In diesem rationalen Gestaltungsakt einer absurden Welt liegt die unerhörte und verstörende, bis heute andauernde Modernität seiner Schöpfungen.
Der Bilderkosmos Goyas reicht von den frühen Teppichkartons und ihrer delikaten Formenvielfalt des Rokokos bis zu den Schwarzen Gemälden seiner späten Jahre und den graphischen Serien der Caprichos, Desastres und Proverbios, vom Gesellschaftsportrait über die Sittenchronik bis zur "Welt als Tollhaus", in dem diesseitige und jenseitige Hölle sich verschränken. Auch die religiösen Bilder geraten Goya zum Traditionsbruch: "... in der Malerei gibt es keine Regeln."
Folgt man den hellsichtigen Visionen des Malers, so erfüllen Absurdes und Irrationales die Welt. Goya benennt deren Abgründe in ihrer teuflischen Schönheit. Aber er zügelt die barbarischen Schrecknisse nicht, sondern bannt sie und steigert sie formal. In diesem rationalen Gestaltungsakt einer absurden Welt liegt die unerhörte und verstörende, bis heute andauernde Modernität seiner Schöpfungen.

Werner Hofmanns Goya rückt ab vom Bild des verzweifelten Aufklärers und verherrlicht den Künstler als Exorzisten einer Welt, die von Grausamkeit und Leiden gezeichnet ist / Von Henning Ritter
Kaum in Bordeaux angekommen, reist Goya Ende Juni 1824 nach Paris weiter. Nachdem König Ferdinand ihm im Zuge einer Amnestie für Sympathisanten der Verfassung von 1820 die Ausreise nach Frankreich gestattet hat, ist der Künstler, der bis zum Ende seiner Laufbahn als Hofmaler für das Königshaus tätig war, zum ersten Mal ein freier Mann. Er ist sozusagen Hofrentner, mit fast vierzig Dienstjahren. In Paris soll er nicht nur die Ausstellung der jüngsten Werke des in Belgien im Exil lebenden ehemaligen Revolutionskünstlers Jacques-Louis David besucht haben, sondern auch den Salon des Jahres 1824. Wir können uns den achtundsiebzigjährigen Maler mit seinem Zylinder, dem Abzeichen der Freiheitsfreunde, vor dem dort ausgestellten Bild "Das Massaker von Chios" von Delacroix vorstellen, das ein Ereignis aus dem griechischen Freiheitskampf darstellt, aber nicht das Ereignis selbst zeigt, sondern die toten und erschöpften Opfer. Vor dem Bild von Delacroix stehend, konnte Goya glauben, im Fatalismus des Grauens die Spuren seiner eigenen Kunst wiederzuerkennen. Delacroix kannte Goyas "Caprichos" und hat ihnen für seine Faust-Illustrationen Anregungen entnommen.
Neben Goya tritt vor das Bild von Delacroix ein anderer Herr, fast vierzig Jahre jünger, auch er mit abgewetztem Zylinder. Er hat sich in die Besucherliste unter dem Namen Van Eube de Molkirk eingetragen, damit er sich nicht über Unhöflichkeiten gegenüber einem nicht gesellschaftsfähigen Franzosen ärgern muß. Es ist Stendhal, der David-Bewunderer und unerschütterliche Bonapartist, der über diesen Salon eine, wie es in der Überschrift heißt, "herbe Kritik" verfaßt, in der das Bild von Delacroix nicht gut wegkommt: "Dieses Bild erscheint mir mittelmäßig durch die Unvernunft anstatt, wie so viele klassische Bilder, mittelmäßig durch Bedeutungslosigkeit zu sein."
Stendhals Vorbehalt war ein grundsätzlicher, und er könnte ihn auch Goya gegenüber erhoben haben: "Nach meinen Vorstellungen, die in diesem Jahrhundert vielleicht ein wenig wunderlich wirken, sollten die schönen Künste nie versuchen, das unvermeidliche Elend der Menschheit zu malen." Das unvermeidliche Elend der Menschheit - dies ist das Thema der Kunst Goyas, die Stendhal nicht kannte. Wären die beiden Männer vor dem Bild von Delacroix ins Gespräch gekommen, hätte sich die merkwürdige Situation ergeben, daß der Vierzigjährige wie ein Überlebender des vergangenen Jahrhunderts und der fast Achtzigjährige wie ein Künstler der Zukunft gesprochen hätte. Stendhal ahnte jedenfalls, daß der Malerei des Elends der Menschheit die Zukunft gehören würde.
Nach diesem imaginären Augenblick im Salon werden einige Jahrzehnte vergehen, ehe Goya seine seither nicht erschütterte Stellung als erster moderner Künstler einnehmen wird. Goya als Präfiguration der Moderne gilt auch Werner Hofmanns große Monographie. Die Figur des Spaniers, in dessen Werk sich die neue Freiheit der Kunst zuerst verkörperte, obwohl er noch fest in den Bindungen des alten Kunstsystems verankert war, ist die exemplarische Gestalt des Epochenumbruchs, der in Europa die Emanzipation des Hofkünstlers ratifizierte. Hofmann legt die Summe einer lebenslangen Beschäftigung mit Goya und jener Epoche vor, die er vor einem Vierteljahrhundert in dem legendären Hamburger Ausstellungszyklus "Kunst um 1800" - unter anderem mit Füßli, Blake, Friedrich, Runge - erkundete und mit "Goya und das Zeitalter der Revolutionen" abschloß. Goya wurde hier mit seinem graphischen Werk in die Revolutionskunst eingebettet und konnte, zwischen Flugblättern und Karikaturen der Zeit, als Verkünder eines neuen Menschenbildes gesehen werden.
Goyas Bild vom Menschen zu entziffern bemüht sich Werner Hofmann auch in seinem neuen Buch, das als reichillustrierte Monographie erscheint, in Wahrheit aber ein großer essayistischer Monolog über Goyas Künstlertum ist. Das Buch enthält kaum biographische Erkundungen, wenig zur Laufbahn des Hofkünstlers und beschäftigt sich nur am Rande mit den politischen Ansichten Goyas. Hofmann geht es ausschließlich darum, den Schlüssel zu finden zu jenen rätselhaften Bilderfindungen, die Goya in einem von ihm selbst geschaffenen Raum künstlerischer Freiheit geschaffen hat - in den großen graphischen Zyklen der "Caprichos", der "Desastres de la guerra", der "Disparates" und in den Zeichnungsalben. Hier sieht Hofmann zu Recht das unaufgelöste Rätsel der Modernität Goyas.
Für jeden Interpreten ist es ein Wagnis, den Schlüssel, den er gefunden hat, auch vorzuweisen. Hofmann findet ihn in dem an Goyas Bildunterschriften angelehnten Aphorismus: "Der Mensch lebt, indem er stürzt" und erläutert ihn: "Er zeichnet und malt Parabeln, in denen er die menschliche Existenz in ihren unausweichlichen Verstrickungen, in ihrer schicksalhaften Fallsüchtigkeit aufzeigt. Der Begründung dieser These ist mein Buch gewidmet." Dazu verbindet der Verfasser eine minutiöse Lektüre der Blätter (und einiger Gemälde) Goyas mit einer weit ausholenden interpretierenden Geste, mit der er das Gelände der "Kunst um 1800" noch einmal durchkämmt und einen reichen Ertrag an eindrucksvollen literarischen Zitaten einbringt. Im Prolog des Buches wird eine Konjunktion vorgestellt, die ihm auch den Titel gegeben hat: Goya und Goethe. Andere wahlverwandte Zeitfiguren gesellen sich mit eindrucksvollen goyesken Zitaten hinzu: Beaumarchais, Chamfort, Schiller, Jean Paul, Tieck.
Es kann aber nicht um wechselseitige Einflüsse gehen. Denn Goya betritt die europäische Bühne erst um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, als Manet ihn entdeckt. Allenfalls handelt es sich um Analogien, um Strukturähnlichkeiten, um Symptome. Dazu gehören die Motive des Maskierens und Demaskierens, des Verkleidens und Enthüllens, des Rollentausches - Gemeinplätze der europäischen Gesellschaftskritik im ständischen Zeitalter und sicherlich auch ein Türöffner zu Goyas "Caprichos", die nach seinen eigenen einleitenden Worten von Extravaganzen und Torheiten handeln, die allen menschlichen Gesellschaften gemeinsam seien. Der eigenwillige Umgang Goyas mit diesem Repertoire deutet sich in dem an, was Hofmann den "Doppelblick" des Malers nennt, der Gegensätzliches in dasselbe gestische und körperliche Substrat hineinsieht und zu bildlicher Explosion bringt. So lehrt Goya, im Märtyrer nicht nur den Verklärten, sondern den Gepeinigten zu sehen und umgekehrt in der Erschöpfung des Leidenden auch eine Verklärung. So entstehen Gleichungen zwischen dem Heiligen und dem Verworfenen. Die "Caprichos" zeigen eine allgemeine Komplizität der menschlichen Dinge, die drastisch aus den gesellschaftlichen Gewißheiten herausführt. Eine Zentralfigur ist für Hofmann deswegen der Rollentausch zwischen Täter und Opfer, der Täter wird zum Opfer und umgekehrt. An dieser Bildfigur wird deutlich, daß Goyas Welt keine moralischen Einsprüche kennt, die nicht sofort wieder in Frage gestellt würden. Moralskepsis geht vor Vernunftskepsis. Die Vieldeutigkeit und Mehrsinnigkeit der Bildschöpfungen Goyas schließt zwar deren ikonographische Stabilisierung und Aufladung nicht aus, aber die traditionelle Ikonographie hat, wie die Moral, ihre Verbindlichkeit eingebüßt.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Kunst malt Goya einen Bauarbeiter, der vom Gerüst gefallen ist und fortgetragen wird. Er greift dabei offensichtlich auf die Ikonographie der Kreuzabnahme zurück. Doch ihm liegt nichts an dem bildlichen Topos, auch der blasphemische Akzent erscheint eher beiläufig. In der Überblendung von Christus und dem Bauarbeiter liegt auch kein egalitäres Menschheitspathos. Vielmehr regiert hier im Bereich des Heiligen wie des Profanen eine souveräne körperliche Pathosformel: der Gestürzte. Nicht die gelehrte oder kritische Übertragung interessiert den Künstler, sondern die existentielle Formel, die er in das Repertoire seiner Welt aufnimmt. In ihr hat die Unterscheidung des Heiligen und des Profanen keine Geltung mehr. Hofmanns Goya ist kein Kritiker der Konventionen, kein Aufklärer, er denunziert die Unvernunft nicht, allenfalls egalisiert er, ohne zu untergraben. Sein oft als boshafte Satire aufgefaßtes Bild der Königsfamilie ist ein eindrucksvolles Beispiel für eine Strategie der nicht kritischen Entlarvung, die sogar das Einverständnis der Dargestellten findet.
Soviel dürfte deutlich sein: Goya entfernt sich von jener Umgebung, in die die Hamburger Ausstellung von 1982 ihn gerückt hatte: Aufklärung und Revolutionspropaganda. Er entfernt sich aber auch von dem Bild des verzweifelten Aufklärers, das durch das berühmte Blatt 43 der "Caprichos" angeregt ist. Die Beobachtung, daß das spanische Wort "sueño" nicht zwischen Schlaf und Traum unterscheide, hat die Diskussionslage ohne Not kompliziert, als könnte man den "Traum der Vernunft" vom "Schlaf der Vernunft" isolieren und zur Entscheidung zwischen beiden auffordern. Die schlafende oder die träumende Vernunft - in beiden Fällen handelt es sich jedenfalls nicht um die Vernunft, die Aufklärungsutopien entwirft. Auch hier, wie oft in den "Caprichos", dürfte Sprichwörtliches im Hintergrund wirksam sein: "Das Nichtstun gebiert Ungeheuer", heißt es in Rousseaus "Lettre à d'Alembert", ein erhobener Zeigefinger des Genfer Kalvinismus. Goya dagegen erhebt keinen Zeigenfinger, er warnt allenfalls ironisch, denn er braucht die entfesselten Monstren, um das Tor zu einer Welt aufzustoßen, die zwischen Realität und Traum nicht unterscheidet und wo der Künstler dennoch Herr im Hause ist. Der Aufklärer Goya wird jedenfalls in seinem Werk nicht greifbar. Hofmann ist vorsichtiger - und verwegener. Denn er räumt die Abdankung der Vernunft in Goyas Universum zwar ein, aber nicht ohne im Künstler eine neue Über-Figur erstehen zu lassen. Der Künstler, so Hofmann, ist Träumer und Exorzist zugleich. Diese Verklärung des Künstlers, der sich über das Drama der Vernunft beugt und dessen Herr bleibt, ist ein Relikt des Vernunftglaubens, dem Goya zwar nicht abschwört, dessen Dementi er aber vor den Augen des Betrachters ausbreitet. Goyas Drama ist nicht das von Vernunft und Unvernunft, er ist nicht der Illustrator der Dialektik der Aufklärung, er ist auch nicht der souveräne Erzeuger und Lenker seiner Träume und Albträume. Er ist vielmehr der Zuschauer, der Augenzeuge des Dramas. Sein Werk legt Zeugnis ab für die grausamen Zumutungen der menschlichen Existenz.
Dem entspricht ein reportagehafter Zug, der selbst Blättern mit den bedrückendsten und exorbitantesten Phantasmen eigen ist, als wollte der Künstler sagen: Ich war da. Im Spätwerk wird dieser Zug, die Augenzeugenschaft, noch deutlicher hervortreten. Die Kriegsgreuel und die Hungerkatastrophe, die Goya in den "Desastres de la guerra" aufs Blatt fixiert, suggerieren seine Augenzeugenschaft auch dort, wo er nachweislich nicht dabei war - nur die Hungersnot und die Berge der elend Verhungerten hat er selbst gesehen. Goya der Augenzeuge unterscheidet nicht zwischen Realem und Imaginärem. Möglich wird ihm dies durch eine radikale Desillusionierung des Vernunftglaubens. Alles ist ein ewiges Lernen im Durchmustern der Erscheinungen von Monstrosität und Leiden. Am Ende wird die Erkundung des Grauens überwiegen, das keine Weltanschauung beschwichtigen kann. Zu Recht rückt Hofmann Goya in die Nähe von Chamfort, dessen Aphoristik die entschlossenste Desillusionierung der Vernunft dokumentiert, ein Denken, das von der Melancholie zerfressen ist. Ausdrücklich findet man bei Chamfort die Feststellung: "Das Denken verletzt und heilt nicht."
Doch im letzten Satz seines Buches beschwichtigt Hofmann: "Der Künstler heilt, indem er bewußtmacht. Mehr vermag er nicht." Vermag er so viel? Und ist Bewußtmachen schon Heilen? Nach der Reise durch die Nacht, zu der Goya den Betrachter entführt, muß die Legende vom bewußtmachenden Künstler ebenso wohlfeil wirken wie die vom idealisierenden. Auch das negative Ideal bleibt ein Ideal. Goyas Pakt mit dem Betrachter ist nicht auf Belehrung aus, sondern fordert nur unerschrockenes Mitgehen. Bewußtmachen? Weniges ist gegen dessen heilende Kräfte, gegen ein ausgleichendes Verstehen so verriegelt wie es Goyas graphische Zyklen sind, zumal die "Desastres de la Guerra".
Am Anfang der "Caprichos" hatte der Künstler von einem "Ydioma universal" gesprochen, einer Universalsprache, als wären seine Blätter in einer fremden, aber gleichwohl universalen Sprache zu lesen. Man muß diesen Hinweis ernst nehmen und die Tatsache heranziehen, daß Goya seine Blätter mit Unterschriften versieht, die oft genauso rätselhaft bleiben wie die Bilder selbst. Sicherlich wollen sie nicht erklären. Vielmehr muß man alle Stimmen hören und zu erraten suchen, woher sie kommen und wer spricht. Zweifellos sind es Kommentare - aber von wem? Sie sind vieldeutig wie die Bilder. Aber in diese Vielstimmigkeit kann der Betrachter sich mit dem Gemurmel einmischen, das er in sich selbst vernimmt. Wenn unter den Greueln der "Desastres" zu lesen ist: "Man kann gar nicht hinsehen", dann kann dies ebenso der erschreckte Ausruf des Betrachters sein wie die hysterische Stimme von jemandem, der nicht hinsehen will. Die Wahrheit der Blätter Goyas zeigt sich in dieser Vielstimmigkeit, die freilich die eindeutige Richtung seines Werkes nicht übertönen kann: eine immer radikaler werdende Hinwendung zu Erscheinungen des Leidens und der Grausamkeit, ja zu Greueln. Das ist seine Botschaft.
Werner Hofmann: "Goya". Vom Himmel durch die Welt zur Hölle. C. H. Beck Verlag, München 2003. 336 S., 253 Farb- und 24 S/W-Abb., geb., 78,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
"Noch nie", beschwört der Kunsthistoriker Martin Warnke diese Goya-Monografie von Werner Hofmann, "ist die deutende Sprache diesen eigentlich unbeschreiblichen Bilderwelten und den ihnen zugrunde liegenden Angst- und Schreckenserfahrungen so nahe gekommen." Gelegentlich, gesteht Warnke, habe er sich sogar bei dem Eindruck ertappt, die - brillant reproduzierten - Bilder in dem Band seien für diesen so eindringlichen Text in Auftrag gegeben. Im Mittelpunkt der Monografie, erläutert Warnke, stehen nicht die Familienbildnisse, mit denen Goya die spanischen Adelskreise bediente, sondern die Radierungen der "Caprichos" und der "Desastres de la Guerra". Hofmann gehe es also nicht um den Goya, der sich um adlige Salons und höfische Privilegien bemühte, sondern um den Goya, der den Schrecken nachspürte, denen die menschliche Kreatur ausgeliefert ist. Es geht Hofmann aber auch um Goya als "Prototypen des modernen Künstlers", der "Ordnung mit Regie" verwechselt und "mit plakathaften, bravourösen Effekten auf sich aufmerksam machen muss".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH