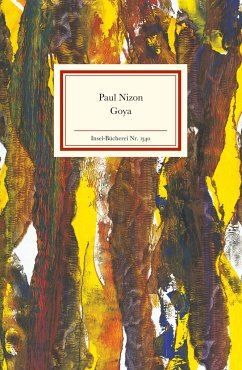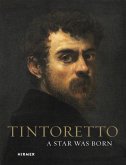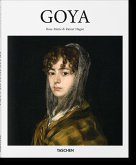Es gibt Bilder, die nichts anderes als ein Ereignis sind - Bilder, die beim Betrachter einen Sturz in die tiefste Erinnerung auslösen, die Erinnerung an den erschütternden Traum, den man hatte und eben verliert; Bilder, die einer Offenbarung gleichkommen, uns in einen Zustand der Beteiligung versetzen, der mit Erleuchtung, mit Liebe zu tun hat. Francisco Goya hat viele dieser Art Bilder gemalt. Aus welchem Stoff ist ein Künstler gemacht, der solches vermag? Paul Nizon, »der Verzauberer« (Le Monde), erzählt Goyas Leben: als Magier der Maskerade und Meister der Entlarvung, als Schwarzmaler und schönheitstrunkener Hellseher. Und in seinen ebenso verblüffenden wie berückenden Bildbeschreibungen zeigt Nizon, wie dieser »Fürst der Schöpfung, der alles, was seine Hand berührte, zum Leben erweckte«, zuletzt reine Existenz, reine Essenz auf die Leinwand bannte: »ein Donnerhall der Ewigkeit in der Schwindsucht der Gegenwart«.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Christopher Schmidt freut es, dass der Goya-Essay, den der Schweizer Schriftsteller Paul Nizon bereits 1991 auf Französisch veröffentlichte, nun in einem schönen Insel-Bändchen vorliegt. Der Rezensent sieht gar eine innere Verwandtschaft zwischen dem spanischen Hofmaler, der in seinen Texten als solitäre Erscheinung das Hofleben darstellte und zugleich karikierte, mit dem Autor, der ebenfalls ein erratisches Pathos pflegt, wie der Rezensent findet. Beide interessiert in ihrer Arbeit das "Verhältnis zwischen Sein und Schein", meint Schmidt, der Nizons Interpretation von Goyas Werk als Reflexion über die Rolle des Künstlers in einer untergehenden Monarchie sehr erhellend findet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Eine luzide Annäherung an Goyas Künstlertum und speziell an den Porträtisten darin stellt Paul Nizons Essay dar, der ... endlich als schönes Bändchen aus der Insel-Bücherei mit zahlreichen vorzüglich reproduzierten Abbildungen auch hier zu haben ist.«