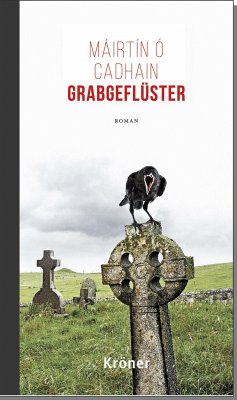Stellen Sie sich vor, Sie sind tot, und das ganze Elend geht einfach weiter. In Máirtín Ó Cadhains »Grabgeflüster« (»Cré na Cille«) sind sämtliche Protagonisten tot und begraben, doch unter der Erde treffen sie sich wieder - und jammern, lästern, schimpfen, fluchen und intrigieren, dass es eine wahre Lust ist. Die Hölle? Vielleicht. Vor allem aber ein sprachliches Feuerwerk, dessen Autor nicht zu Unrecht als der irischsprachige Joyce gilt.Ó Cadhains Kultroman von 1949 ist das Buch der Bücher des gälischsprachigen Irland, ein Mythos im übrigen Land - bis sich Alan Titley an die erste englische Übersetzung wagte, erschienen im Mai 2015 als The Dirty Dust; etliche Sprachen folgen. Ins Deutsche übertragen hat den Roman die bekannte Übersetzerin Gabriele Haefs. »Ein Meisterstück der literarischen Moderne«, urteilt Jan Wilm in der FAZ. »Dieser Autor ist eine veritable Entdeckung«, meint Denis Scheck.

Máirtín Ó Cadhain ist ein Klassiker der irischen Literatur. Jetzt ist sein sprachtrunkener Roman "Grabgeflüster" auf Deutsch erschienen.
Roland Barthes schrieb einmal: "Alles vergeht: Auch die Gräber sterben." Ist man am Leben, dann ist das ein Schrecken. Ist man am Trauern, dann ist das ein Trost. Ist man eine Figur in Máirtín Ó Cadhains "Grabgeflüster", dann ist das einfach falsch.
In diesem Roman ist jeder mausetot, mucksmäuschenstill ist aber keiner. Das Setting ist ein Dorffriedhof irgendwo in Connemara im Westen Irlands. Die Zeit, informiert der irische Originaltext, ist die Ewigkeit. Die Bürger des Dorfes sind einfache Leute, Bauern, Arbeiter, ein Schulmeister, ein Priester, ein französischer Immigrant. Alle sind sie komplex gezeichnete, tiefgründige Charaktere, und das, obwohl sie ausschließlich aus Stimmen bestehen, die sich unsichtbar über Gräbern erheben. Über 400 köstliche Seiten wird keine einzige Figur jemals sichtbar oder auch nur visuell konturiert.
Auch aus diesem Grund ist der Roman ein Meisterstück der literarischen Moderne. Die große Romantradition des 19. Jahrhunderts entwickelte ein Genre, das die Visualität oft fetischisierte. Beschreibungen von Landschaften und Witterungen haben symbolisches Potential, die Kleidung und die Physiognomie, die die Figuren ummanteln, sollen Bericht über ihr Innenleben geben. Der Roman der literarischen Moderne - mittlerweile haben Fotografie und Film der Gattung die Möglichkeiten von realistischer Bildsprache erweitert, aber auch abgesprochen - ist gekennzeichnet durch eine Kehrtwende nach innen. Besonders die irische Literatur hat mit den Bewusstseinsströmen von James Joyce und den Kopfkammerspielen von Samuel Beckett erheblich dazu beigetragen, der romanhaften Vorherrschaft des Visuellen die Linse zu trüben. Und während es bei Joyce kracht und knirscht und mit lautmalerischen Mitteln am äußersten Rand des Realismus doch noch die Welt nachgeformt wird, gibt es in der irischen Literatur diesen einen Autor, der in seinem größten Roman einen ganz eigenen fulminanten Weg ging - auch wenn hierzulande kaum einer je von ihm gehört, geschweige denn seinem "Grabgeflüster" gelauscht hat.
Máirtín Ó Cadhain (gesprochen Martin O Kine) wurde 1906 - im selben Jahr wie Beckett - geboren und starb bereits 1970. Er verbrachte sein Leben zwischen dem eher englischsprachigen Dublin und dem eher irischsprachig geprägten, ländlichen Westen des Landes: seine Literatur, die größtenteils auf Irisch verfasst wurde, ist ein Monument für seine Muttersprache. War das Irische historisch häufig totgeglaubt, so ließ Ó Cadhain es in immer neuen Spielereien aufraunen, und sein "Grabgeflüster" wurde zum erfolgreichsten und populärsten Roman dieser Sprache.
Das geisterhafte Stimmengeflecht erschien in Irland schon 1949. Eine fulminante Übersetzung ins Englische besorgte Alan Titley erst über sechzig Jahre später und erregte ganz zu Recht Aufsehen damit. Ähnliches Aufsehen erregen sollte auch die von Gabriele Haefs gezauberte Übertragung dieses irischen Klassikers, den es endlich auf Deutsch zu entdecken gilt. Die Hauptstimme des Romans ist die frisch beerdigte Caitríona Pháidín, die für Leser als Orientierung in dem Totenchor fungiert, denn auch sie muss sich zunächst mühsam im Dunkel zurechtfinden. Dabei stößt sie auf ihre alte Nachbarin Muraed, die auch hier im Nebengrab liegt: "Erinnerst du dich an mich, Muraed, oder verliert man hier alle Erinnerungen an das Leben? Ich habe meine jedenfalls noch . . ."
Nein, das ist hier gewiss Programm, denn die spezielle Ontologie dieser Friedhofswelt besagt: Alles geht gerade so weiter wie im Leben. Mit irischer Schnodderigkeit wird so die katholische Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod zur erdigen Groteske ausgebreitet. Jeder alte Zwist, jedes Gespött und Gerücht, ist zwar begraben, aber lange nicht vergeben und vergessen. Muraed erklärt das neue Dasein im Staub: "Das Leben hier ist dasselbe, Caitríona, wie in der Alten Heimat, nur sehen wir eben nur das Grab, in dem wir liegen, und können unseren Sarg nicht verlassen. Du hörst die Lebenden auch nicht und weißt nicht, was bei denen passiert, nur das, was die Frischbeerdigten erzählen können."
Weil das Leben immer Tote macht, kommt ständig frischer Wind in die statische Totengesellschaft unter Tage - und mit den neuen Toten kommt immer mehr Zoff und Zank ins Cömeterium. Die Streitigkeiten sind bewusst als Lappalien ausgeformt: Wer hatte das meiste Ansehen im Leben, wer hat mehr Ansehen im Tod ("Hier auf diesem Friedhof bin ich bekannter als du und genieße mehr Respekt!"), wer hatte das schönere Haus im Leben, wer bekommt endlich ein Kalkstein-Kreuz auf seine letzte Ruhestätte, denn "ein Kreuz auf dem Grab ist hier so gut wie oben ein Haus mit Schieferdach, mit einem Namensschild über der Tür"?
Während die Figuren über Nichtigkeiten keifen, erkennt man rasch den komischen Kern dieses Romans. In modernistischer Tradition steht im Zentrum nicht etwa der Plot, auch wenn kleinere Spannungsbögen durchaus zum Humor dieses Texts beitragen. Doch Sinn und Spaß liegen in der Sprache, im febrilen Fluchen, das beinahe jede Seite durchzittert, besonders wenn Caitríona über ihre noch lebende Schwester Nell herzieht und endlich ihren Tod herbeisehnt, vermutlich, um sie weiter beschimpfen zu können. Aber die Toten haben ja auch allen Grund zum Fluchen. Manchmal wird es dabei auf dem Friedhof so laut, dass Caitríona sich beklagt über diesen Ort, "wo es keine Privatsphäre gibt", denn "hier kannst du ja nicht mal deinen eigenen Finger im Ohr hören!" Doch meistens ist Caitríona selbst die größte "Quasselstrippe" und "Klatschbase" und wird in einem einschneidenden Moment vom restlichen Kadaverensemble mit Schweigen gestraft, wenn sie erkennt, dass "hier auf diesem Friedhof Ruhe und Frieden geherrscht hat, bis ich aufgekreuzt bin".
Die irische Literatur ist eine Literatur des Sprachspiels, erfindungs- und klangreich: Der Wortwitz eines Flann O'Brien (in der irischen Sprache) oder eines James Joyce (in der englischen) ist besonders dann heimtückisch schwer zu übersetzen, wenn die irische Liebe zum Lästern und Schimpfen in Rage gerät. Auch hier sind diese Schwierigkeiten erkennbar, ist Ó Cadhain doch ein Meister der wahnwitzigen Beleidigungen. Gleichwohl macht Gabriele Haefs aus Ó Cadhains Klangroman auch im Deutschen ein kakophonisches Gepolter, das dem Sinn fürs irische Geplapper treu bleibt und dem Deutschen dabei einige wunderbare Sprachgeschenke bereitet: "Einohrbrut", "Moderarsch", "Entenmelkerin".
Ein fulminant eigensinniger Roman in sehr glücklicher Übersetzung, die man am besten laut lesen sollte. Aber zunächst bitte Ruhe, wir sind auf einem Friedhof: "Das hier ist kein Ort, an dem man indiskret sein darf. Gräber haben Ohren . . ."
JAN WILM
Máirtín Ó Cadhain: "Grabgeflüster".
Aus dem Irischen von Gabriele Haefs. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2017. 461 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main