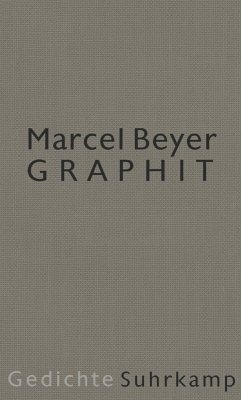Endlich: Marcel Beyer legt einen neuen Gedichtband vor. Mit dem Titel ist der Hinweis auf die motivische Klammer gegeben: Materialität. Dinge, ob Blume, ob Feder, ob Scheiße oder Abendland, die sich bei den Kollegen aus allen Zeiten finden und neu integrieren lassen; die Körnung der unterschiedlichsten alltäglichen wie politischen Stimmen. Solche Mehrstimmigkeit ist für Marcel Beyer das einzig wirksame Gegengift gegen den ganzen monolithischen, den fanatischen, den faschistischen und chauvinistischen Schwachsinn in der Poesie und das Reden darüber. Materialität als unterscheidendes Merkmal der anderen Künste, deren Echowirkung diese Gedichte einfangen: das von Photographien angeregte Schreiben, das Schreiben mit der Perspektive, dass ein entstehendes Gedicht von einer fremden Stimme vorgetragen werden wird, und dazu gesungen. Materialität als besondere Konstellation einer Kunstgattung: Die bis in das Jahr 2001 ausgreifenden Gedichte (»Tigerschminke«) haben etwas Szenisches: Eine Figur erhält Materialität durch ihre Verkörperung im Bühnenraum. Marcel Beyers Souveränität im Umgang mit seinem Material, mit den Kollegen, mit der Zeitgeschichte, dem Zeitgeist und den in ihm hampelnden Menschen ist unvorsehbar-überwältigend: Der Materialist unter den Lyrikern kombiniert das Gewesene und Anwesende zu Nie-Dagewesenem.

Vom Indikativ der Geschichte: Marcel Beyers Gedichte führen zurück in die Tiefen der Erinnerung und steigern die Welt zur Konkretheit.
Von Hans-Ulrich Gumbrecht
Lyrik ist heute nicht mehr die Gattung, in deren Tiefe wir nach einem von den Wörtern verschlüsselten Sinn suchen und nach einer entscheidenden Auslegung unserer Existenz. Wir lesen Gedichte kaum als Metapher der Wirklichkeit oder als Orientierung für unser Leben. Eher hoffen wir, in ihnen der Konkretheit einer Welt neu zu begegnen, die uns ferngerückt ist - und zerfallen in eine überwältigende Vielfalt der Möglichkeiten. Denn alles soll ja möglich sein in unserem Alltag, nichts scheint notwendig oder unmöglich, wir leben hinter den Vorzeichen von Konjunktiv und Kontingenz, so dass wir uns nach dem Indikativ des Konkreten sehnen und nach einer Sprache, deren Verbindlichkeit die Dinge präsent macht. Der Lyrik - und oft auch den Erzählungen - von Marcel Beyer gelingt es in der Mitte seines Lebens und in der Reife seines literarischen Werks immer wieder, eine solche Sprache zu finden.
Unter dem Titel "Mein Blauhäher" setzt gegen Ende des neuen Gedichtbandes "Graphit" eine Folge von sechzehn Texten ein: "Mein Blauhäher hört auf den / Namen Ezra. So hab ich ihn / genannt, wie mich", lauten die ersten beiden Sätze, und bevor man sich noch im Lesen die Spezialistenfrage beantworten kann, wohin denn die Anspielung auf den großen Dichter Ezra Pound als Selbstverweis wohl führen soll, wird der Blauhäher gegenwärtig - im Indikativ und den Variationen eines Wochen-Programms:
Am Montag
füttere ich ihn mit Brot
von gestern. Am Dienstag gebe
ich ihm seine Medizin.
Am Mittwoch will er seine
Lieblingsplatte hören.
Und jeden Donnerstag verlangt
er nach Salat. Am
Freitagmorgen fülle ich ihn
ab. Dann bringe ich ihn rüber
zu den Schwestern. Am Samstag
gibt es endlich ein paar
Blätter. Am Sonntagnachmittag
Besuch. Am Sonntagabend
wird der Kerl von mir geduscht.
Die Nacht auf Montag - schwierig.
Jeden Wochentag und jede der angekündigten Szenen füllen die folgenden Texte aus, mit vielen Ungewissheiten, Varianten und Details, aber immer im Indikativ: "Den einen / Dienstag will er partout / ein alter Sänger sein, den / anderen niemand außer dem / Duce." Bis der Eichelhäher endlich am Sonntagabend geduscht wird, ist seine Gegenwart beim Lesen bunt und vertraut geworden: "Sie können / sich ja vorstellen: Das geht nicht / gut. Ich singe ihm was von / Neapel, aus der Bucht." Und: "spätestens beim Frottieren hat er / sich beruhigt. Er plustert sich. Ich / streiche ihm den Scheitel glatt."
Diese gelassene und eher freundliche Stimme des "Ich" klingt durch die meisten Gedichte von "Graphit", und sie wendet sich gestisch an jemanden, der hört oder liest, an "Sie" oder "Du". Dabei nimmt die Sprache des "Ich" verschiedene Rhythmen an, deren Regelmäßigkeit nur selten durch Reime vervollständigt wird. Die lyrische Sprache von Marcel Beyer vollzieht sich in diesen Prosarhythmen, betont und verstärkt von den Strophenformen, mit denen sie auf die Seiten kommt. Als rhythmische Sprache bleibt seine Lyrik immer eine Sprache der Wiederholungen, welche die linear fortschreitende und alles verändernde Zeit unseres Alltags durchbricht. So bildet sie für jedes einzelne Gedicht - und am Ende für den ganzen Band - eine eigene Gegenwart außerhalb der Alltags-Zeit, eine eigene Gegenwart, in der all die beschriebenen Dinge aus ganz verschiedenen Zeiten und Orten nebeneinandertreten, um uns präsent zu werden, greifbar nahe und verbindlich.
Es mag diese Emphase des Nebeneinanders und der Variationen sein, die Marcel Beyer zum poetischen Meister der Komposita gemacht hat, zum Meister jenes besonderen Potentials der deutschen Sprache für die Erfindung immer neuer komplizierter Wörter: Knackelverse und Knochenlicht, Fleischerhund, Polsterhimmel und Slawenglück. Weil die Dinge in seinen Wörtern und Gedichten so greifbar werden und anscheinend verbindlich, verwandeln Beyers Texte eine Welt, in der alles möglich und nichts notwendig ist, in eine Gegenwart des Indikativs, in eine eigene Gegenwart, wo ganz individuelle Vorstellungen so konkret und real sein können wie die Beschreibung von Wirklichkeiten.
Die erste Textfolge des neuen Gedichtbands "Graphit", die diesem auch seinen Titel gegeben hat, führt durch Szenen von Schnee und Eis, "künstliche", fiktionale und wirkliche. Am Beginn steht die Fiktion eines Schneehangs auf den "Runkelrübenäckerweiten" von Neuss. Danach erscheint unversehens der Regisseur Sergei Eisenstein, wie er im "Hochsommer '38" einen "zugefrorenen See, / verschneit" für seinen neuesten Film braucht und deshalb "die halbe Landschaft asphaltieren" lässt, um zuletzt den "Schneeauftrag, ein / lichtaufsaugendes Gemisch / aus Naphtalin und Kreide", auf den Asphalt zu legen.
Die nächsten Bilder sind eine "Skihalle" mit "Windstille / dreihundertfünfundsechzig / Tage im Jahr", dann die "Winterschlachten" des Zweiten Weltkriegs mit "Guderians Panzerdivisionen" und auch eine "Salzburger Hochalm". Im letzten Gedicht der Sequenz erscheint der Schnee als "ein schwindendes Objekt", weil man "zu spät / kommt, jedesmal zu spät, wenn / man ihn filmen will". Doch am "Pistenrand" ist sichtbar "eine Schattenspur: Graphit". Wie Graphit unter schmelzendem Schnee, so wird die indikativische Gegenwart der Gedichte von Beyer zur Kontur des Konkreten in unserer Welt aus Kontingenz und Konjunktiven.
Es sind Namen, Daten, spezifische Orte, Dialekte oder auch Schriften, welche diese verbindliche Gegenwart heraufbeschwören. In der zweiten der neun Textsequenzen von "Graphit" nähern sich die Gedichte dem "Rheinland", von dem "Jungfrau" genannten alpinen Bergmassiv aus bis nach Köln, von der "oberdeutschen Mundart, / Handschrift vermutlich / in der Schweiz entstanden" hin bis zur "Mundart vorwiegend ripuarisch. / Sehr schöne zierliche Schrift". Später ruft "Sankt Petersburg, im Juli, gegen / zwei Uhr früh, 2007", einen Strom von Bildern aus der sowjetischen Geschichte auf, in dem Eisenstein wiederkehrt (solch meist unverhoffte Effekte der Wieder-Erscheinung von Namen und Bildern binden die zentrifugalen Teile dieses Bandes zusammen), dann die frühesten Satelliten, die ersten Kosmonauten und auch noch die Mode, welche ihre Uniformen nachahmte: "Kosmonautenjäckchen, -traum mit / Reißverschluss, doch kaum / von Dauer".
Die Konkretheit steigert sich bis zur Drastik von bestimmten Extremmomenten in den verschiedenen Stimmungen und Welten. Einer der extremen Momente ist die Tötung des SS-Obersturmführers Heydrich: "Prag / zweiundvierzig, der / Wagen kommt mit / offenem Verdeck, die / Waffe in der Tür / ist nicht geladen. Heydrich / hat Polsterfüllung in / der Milz." Ein anderes extremes Datum verweist, ebenso historisch genau, auf Jamaika, fünfunddreißig Jahre später:
Don Drummond, der Posaunist von
Weltbedeutung, den man hier nur Don
Cosmic nennt, ersticht am ersten
Januar Neunzehnhundertfünfundsechzig
Vor Tagesanbruch, gegen drei
Seine Geliebte, Margarita,
Die Limbotänzerin, und stellt
Sich kurz darauf der Polizei.
Es gibt Passagen in "Graphit", wo das "Schlachtgemälde" als Bildgattung einen Fluchtpunkt für Gedichte abzugeben scheint, deren Aggressivität offenbar keine Grenzen kennt: "Gedichte / müssen wie ein Schuss ins / Auge sein." Doch am Ende und insgesamt macht die Drastik bloß eine von den ganz verschiedenen Stimmungen aus, in denen Marcel Beyer die Welt konkret werden lässt. Zwischen den Bildern von Blut und zerfetzten Organen aus den Ereignismomenten historischer Wirklichkeit weckt ein Gedicht, nur wenige Seiten entfernt, einen Kindheitsmoment in einer ganz und gar anderen Modalität von Konkretheit. Er kommt mit einer Erinnerung an den Sandmann des DDR-Fernsehens, ironischerweise an die vielleicht einzige Ikone der ostdeutschen Medienproduktion, welche die Wiedervereinigung überlebt hat: "der Sandmann, der nachts / neben deinem Kissen lag und / dich ansah, mit tiefschwarzen / Augen, als wisse er seine / Reime nicht mehr, die er jeden / Abend im Fernsehen aufsagte". Und käme der Sandmann in Marcel Beyers Gedicht zur Sprache, dann klängen seine Wörter gewiss sächsisch: "Heute / weißt du, sein Zungenschlag / hätte dich befremdet / Ein / undurchsichtiger Kerl - doch sein / Spitzbart hat ihn verraten. Er / kam aus dem Nachbarland."
Nicht alle Texte des Gedichtbands "Graphit" haben diese - goldige oder drastische - Intensität. Es gibt Seiten, wo ich dachte, die Kraft seiner Imagination hätte Marcel Beyer verlassen. Vielleicht war das aber auch nur die Wirkung eines Spiels mit dem Leser, das ich naiv mitgespielt habe, Zum Beispiel tragen die harmlosesten Texte dieser Sammlung den Titel "Die letzten tödlichen Gedichte". Aber das bedeutet wenig angesichts der Präsenz und Konkretheit, zu der so viele Fragmente aus einer Wirklichkeit der Kontingenzen und Konjunktive durch diese Texte versammelt werden. In einem bemerkenswerten Anhang von einer halben Seite nennt Marcel Beyer Texte, Bilder, Postkarten, Gespräche, Fragmente der Wirklichkeit also, die einzelne seiner Gedichte inspiriert haben. Statt eine bloße Erinnerung oder eine verblassende "Darstellung" jener Alltagsfragmente zu sein, haben sie ihre Wirklichkeit fast immer gesteigert.
Marcel Beyer: "Graphit". Gedichte.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2014. 203 S., geb., 21,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Groove attestiert Helmut Böttiger den Gedichten von Marcel Beyer. Das liegt für Böttiger an Beyers Fähigkeit, Geschichte, Schrift und Zeiten mit leichter Hand, alltagsnah zu verzahnen. "Kulturarchäologische Suchbewegung" nennt Böttiger das. In dieser Bewegung tauchen dann laut Rezensent Gottfried Benn und sein Freund Oelze auf, Ezra Pound und Karl May, das Rheinland, Dresden und Eisenstein. Niedriges wird in die Höhe gehoben, Verbindungen in der Historie und in der Literatur sichtbar, erklärt Böttiger, der empfiehlt, die Texte laut zu lesen, um ihre Wortverbindungen, ihren Rhythmus, Beyers raffiniertes musikalisches Verfahren zu entdecken und seine feine Selbstironie, die sich in Titeln wie "Bin ich der Mann vom History Channel?" oder "Endreimstimmung" niederschlägt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein großes Lesevergnügen« Roman Bucheli Neue Zürcher Zeitung 20150106