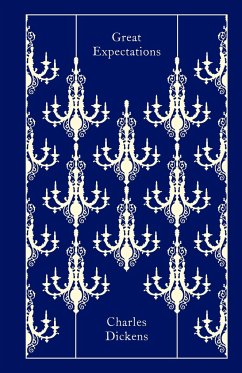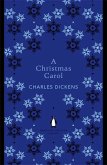Pip doesn't expect much from life... His sister makes it clear that her orphaned little brother is nothing but a burden on her. But suddenly things begin to change. Pip's narrow existence is blown apart when he finds an escaped criminal, is summoned to visit a mysterious old woman and meets the icy beauty Estella.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.