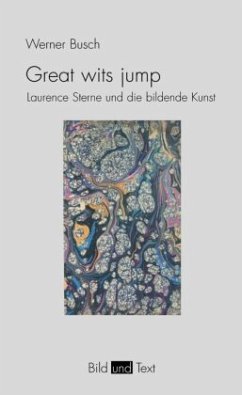"Great wits jump" - Originelle Geister vollführen Gedankensprünge: Für Sterne ist dieser Anspruch zugleich seine ästhetische Grundüberzeugung, denn ungewöhnliche Assoziationen können verschüttete oder schamhaft verschwiegene Gedanken blitzartig erhellen.Die sternesche Zitierpraxis agiert auf ebendiesem Felde: Seine Romane zeichnen sich besonders durch ihre vieldeutige Sprache aus, sie sind aufgeladen mit einer Fülle von Anspielungen, die sich nicht endgültig entschlüsseln lassen.Dass Laurence Sterne in seinen Werken unzählige Passagen aus der literarischen Überlieferung zitiert, ist zwar seit Langem bekannt. Werner Busch kann nun aber zeigen, dass Sterne auch zahlreiche Werke der bildenden Kunst aufgreift und seinem Werk radikal einverleibt. Laurence Sterne vermeidet folgerichtiges Erzählen zugunsten zahlloser Abschweifungen und montiert seine Texte aus einer unüberschaubaren Vielzahl von Bausteinen, die er sich aus der gesamten literarischen Überlieferung borgt und nur minimal verändert. Gerade dieses Montageverfahren macht Sternes Modernität aus: James Joyce und Virginia Woolf oder auch Thomas Mann und Arno Schmidt beziehen sich auf ihn als einen Autor der literarischen Moderne. Neben dieser Textmontage zitiert Sterne - vor allem in geradezu absurd ausführlichen Beschreibungen von Gesten und Situationen - zahlreiche Werke der bildenden Kunst. Dabei eignet sich Sterne in seinem Schreiben zumeist Werke aus der Vergangenheit an, bezieht sich aber auch auf die Kunst seiner Zeitgenossen.Werner Busch gelingt es nicht nur nachzuweisen, welche Bilder Sterne auf diese Weise zitiert. Er kann sogar darlegen, woher Sterne diese Bilder gekannt haben wird. Das führt ihn zu der Frage, aus welchem Grund Laurence Sterne Szenen aus Zeichnungen, Gemälden, Radierungen und häufig sogar Karikaturen für seine Texte verwendete.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Anspielungen muss man zu genießen wissen: Werner Busch hat ein exzellentes Buch über Laurence Sterne und die bildende Kunst geschrieben.
Sollen wir denn immer nur neue Bücher machen, grad wie die Apotheker neue Mixturen, indem wir aus einem Gefäß in ein andres gießen? - Müssen wir denn immer nur denselben Strang drehen und aufdröseln? immer nur im selben Gang - immer nur im gleichen Trott?" Das sind natürlich rhetorische Fragen, natürlich müssen wir. Aber andererseits ist eine Mixtur eben doch noch etwas anderes als die verwendeten Wässerchen und auch die Form des verwendeten Gefäßes im literarischen Vergleichsfall wohl nicht ohne Belang
Wofür das Buch, in dem sich diese melancholisch gefärbte Invokation findet, nämlich Laurence Sternes "Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman", im Übrigen ein ganz vorzügliches Beispiel liefert. Und nicht nur die neun Bände zusammen mit ihren unzähligen Entlehnungen. Auch diese Passage selbst, die - ihrem Gegenstand angemessen - selbst an einem Strang dreht, den ein anderer geflochten hat, nämlich Robert Burton in seiner von Sterne immer gern herangezogenen "Anatomy of Melancholy".
Aber auf die Variationen kommt es eben an: Sterne übernimmt zwar den Apothekervergleich so gut wie wörtlich, doch aus Burtons resignierter Feststellung wird bei ihm die melancholisch grundierte Frage. Und weil der Leser, wenn er bei dieser Stelle angekommen ist, schon weidlich Erfahrung gesammelt hat mit dem erratischen Gang des Autors Sterne - die berühmte graphische Illustration im sechsten Band eingeschlossen -, ist auch der "gleiche Trott" sofort eingeklammert. Variationen der Gangart sind schließlich Sternes Spezialität, gerade auch dann, wenn er mit seinen Vorlagen operiert.
Welche literarischen Quellen er dabei benutzte, das hat die Sterne-Forschung geduldig zusammengetragen. Dass Sterne sich auch gern bei der bildenden Kunst und der zugehörigen Kunsttheorie bediente, ist allerdings weitgehend unberücksichtigt geblieben: So lautet die Diagnose des emeritierten Berliner Kunsthistorikers Werner Busch, der mit seinem neuen Buch diese Lücke zu schließen in Angriff nimmt. Man hätte freilich ahnen können, es bei Busch auch mit einem exzellenten Kenner Sternes zu tun zu haben. Der Abschnitt über dessen Porträt von Joshua Reynolds in seinem magistralen Buch über die Kunst im achtzehnten Jahrhundert, "Das sentimentalische Bild", war dazu ein Wink.
Reynolds' Bildnis, kurz nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten zwei Bände des "Tristram" 1760 entstanden, begegnet man auch jetzt wieder: Es gibt Sterne auf dezente und doch unübersehbare Weise Züge eines Rubensschen Satyrs, was man Lesern des fast über Nacht berühmt gewordenen Autors nicht erst erläutern musste. Sterne spann das dabei mit ins Spiel kommende Motiv der leicht verrutschten Perücke seinerseits in der nächsten Lieferung des "Tristram" weiter; und diese Passage führt Busch nun zu anderen Bildern, für die Sterne Verwendung hatte.
Diese absurde Perückengeschichte - rund um den Slapstick, dass Tristrams Vater Walter höchst ungraziös mit der linken Hand nach einem Taschentuch auf der anderen Rockseite gräbt, weil er mit der rechten seine Perücke abgezogen hat - ist eine jener Stellen, in denen Sterne mit irritierender Ausführlichkeit bestimmte Posen und auch den Wechsel zwischen ihnen beschreibt. Gar nicht selten mit Verweis auf bestimmte Maler, stilistische Manieren oder auf diese Weise parodierte kunsttheoretische Maximen. Reynolds wird denn hier auch aufgerufen, hätte er doch, meint der Erzähler, einen etwas geschickter agierenden Walter Shandy ohne weiteres malen können - was als Pointe zu Lasten von Reynolds geht, der selbstverständlich nie auf die Idee gekommen wäre, auf einem seiner Porträts einen Gentleman mit abgezogener Perücke zu zeigen.
Bei einem Gesellschaftsporträt war das selbst einem Maler wie William Hogarth nicht zuzutrauen, der als Spezialist dafür gelten konnte, die hohen Stillagen zu unterlaufen - und den Sterne für Titelillustrationen des "Tristram" gewann. Aber auf einem der zeitkritischen Stiche von Hogarth ist Busch fündig geworden: Dort sieht man tatsächlich einen Geistlichen in einer Pose, die exzellent zu Tristrams Erwägungen passt, was sein Vater noch so hätte anstellen können, um ein "verhenkertes" Bild abzugeben. Und weil man mit ein wenig gutem Willen die Posen der rings um diesen feisten Pfarrer Tafelnden mit Leonardos Abendmahl abgleichen kann, so hat man auch gleich ein hübsches Beispiel von Hogarths Spiel mit klassischen Vorlagen vor sich.
Aber faszinierender ist wohl noch, wo Busch die Vorlage für Walters tatsächliche Pose findet, nämlich in Annibale Carraccis Gemälde "Der große Schlachterladen", das der von der High Society umworbene Sterne wohl bei einem reichen Londoner Kunstliebhaber gesehen hat. Zumal sich Carraccis Bild selbst wiederum als Variation über die Plausibilität von Posen lesen lässt, die an ihre Grenzen getrieben werden - und ein Klassikerzitat, diesmal aus Michelangelo, fehlt auch bei ihm nicht.
Ein wenig riskanter und doch überzeugend verfährt Busch, wenn er hinter einer anderen auffälligen Beschreibung - des über die Nasenverstümmelung seines Tristram erschüttert vornüber auf das Bett sinkenden Walter Shandy - einen im Schoß Dalias liegenden Samson auf einem Gemälde van Dycks ausmacht. Womit die mehrdeutige Figur des Samson - dem bösen Trieb erliegender Berserker, aber über die typologische Lektüre auch auf Christus verweisend - ihren Teil zur Anspielungstechnik Sternes beitragen kann, bei der es subkutan immer wieder um das eine geht, für das die großen wie zerdrückten Nasen stehen.
Das Bild im Hintergrund drängt dabei so wenig zur Eindeutigkeit wie Sternes Text. Es erweitert vielmehr, folgt man den mit seiner literarischen Transposition gegebenen Winken, das Spektrum der Anklänge und Verweise. Die bildlich eindeutige Verwendung, die Goya in einigen seiner Blätter vom Motiv der Nase macht, sticht dagegen als eher banale Variante ab. Ausschließen kann man deshalb nicht, was Busch als Spekulation anfügt, dass Goya nämlich den "Tristram" in der französischen Übersetzung vor Augen gehabt haben könnte.
Buschs Buch ist eine wunderbare Gelegenheit, Sterne wiederzulesen. Und es ist eine überaus elegant - und grundgelehrt ohnehin - geschriebene Abhandlung über raffiniertes Zitieren: von Bildern in Bildern und Bildern in Texten. Und auch die von Sterne selbst, insbesondere in der "Sentimentalen Reise", angestoßenen Bildfindungen werden von Busch nicht vergessen.
Hat man diesen spielerischen Umgang mit Vorlagen, bei denen oft nur leichte Verrückungen die neuen Akzente hervorbringen, Revue passieren lassen, nimmt man Burtons melancholische Klage über die immer wieder abgeschrittenen Wege erst recht leicht. Zumal ja Sterne auch zeigt, dass für Umwege immer Platz ist. Selbst die Buchmesse hat da für einen Augenblick nichts Drohendes mehr.
HELMUT MAYER
Werner Busch: "Great wits jump". Laurence Sterne und die bildende Kunst.
Wilhelm Fink Verlag, München 2011. 236 S., Abb., br., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Helmut Mayer macht in seiner Besprechung von Werner Buschs Studie mehr als deutlich, dass die Vorliebe des 18. Jahrhunderts für Zitate, Anspielungen und Verweise ein ebenso komplexes wie faszinierendes Beziehungsgeflecht hinterlassen hat. Selbstvergessen folgt der Kritiker den verschlungenen Pfaden, die den Kunsthistoriker Busch von Laurence Sternes "Tristram Shandy" zu dessen mutmaßlichen bildlichen Vorlagen und Inspirationsquellen führen. Bei Joshua Reynolds sei Busch fündig geworden, erfahren wir; außerdem bei William Hogarth und Annibale Carraci, wobei von den Letztgenannten wiederum Spuren zu Leonardo und Michelangelo führten. Dabei findet Mayer die Studie auch dort, wo sie eher auf Indizien als auf eindeutige Beweise abstellt, noch plausibel. In jedem Fall rechnet er es Busch hoch an, von kunsthistorischer Seite nachzutragen, was die Sterne-Philologie bereits mit Akribie für die literarischen Vorlagen des "Tristram Shandy" geleistet habe. Zu guter Letzt empfiehlt Mayer dieses "elegante" und "grundgelehrte" Buch nicht nur als "Abhandlung über raffiniertes Zitieren", sondern auch und vor allem als Gelegenheit, sich erneut in Sternes Klassiker zu versenken.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH