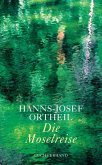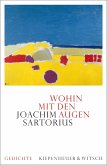Ein alter Mann zieht aus der Hauptstadt in eine entlegene Ortschaft im Grenzland, dort will er die letzten Jahre verbringen. Welche geistigen Eindrücke bleiben, fragt er, aus einem Leben, das der Betrachtung gewidmet war und dem Lesen? Die sehnsüchtige Anmutung einer dunkelhaarigen Frau? Der Familiensitz in einer kargen Landschaft? Die gelenkige Schönheit eines gewissen Rennpferdes? Die Farbigkeit durchscheinender Glasfenster? Eine Zeile Proust? Und so beginnt der Mann, im Zwielicht seiner Tage, diesen seinen Schatz zu katalogisieren, kaum ahnend, wohin sein »Bericht« ihn führen wird und welche Geheimnisse dabei ans Licht kommen.
Grenzbezirke ist eine Geste des Abschieds. In Bildern gespenstischer Tiefe erzählt Gerald Murnane das Leben eines leidenschaftlichen Lesers, strauchelnden Liebhabers und praktizierenden Gläubigen - ein Glauben nicht an die Gemeinplätze der Religion, sondern an die unwiderlegbare Leuchtkraft des Erinnerns und der Literatur.
Grenzbezirke ist eine Geste des Abschieds. In Bildern gespenstischer Tiefe erzählt Gerald Murnane das Leben eines leidenschaftlichen Lesers, strauchelnden Liebhabers und praktizierenden Gläubigen - ein Glauben nicht an die Gemeinplätze der Religion, sondern an die unwiderlegbare Leuchtkraft des Erinnerns und der Literatur.

Warum werden manche Menschen am Schreibtisch plötzlich zu Exzentrikern? Der australische Autor Gerald Murnane befragt in "Grenzbezirke" sich selbst, die Vergangenheit und die ganze Welt.
Gerald Murnane, der am kommenden Montag achtzig Jahre alt wird, ist mit Sicherheit einer der sonderbarsten Schriftsteller unserer Zeit. Er lebt in großer Bescheidenheit in Goroke, einem winzigen Ort im Bundesstaat Victoria, nördlich von Melbourne, den er nach eigener Aussage fast nie verlassen hat - er findet die Vorstellung, dies zu tun, sogar abwegig. Er liebt Pferderennen und die ungarische Sprache, hat in den letzten Jahrzehnten nicht länger als dreißig Minuten ferngesehen und noch nie, wie er sagt, eine E-Mail verschickt. In Hängeregistraturen sammelt er nach einem ausgefeilten System alle seine Notizen, Briefe und Schriften und tippt seine Bücher, von denen bisher seit 1974 mehr als fünfzehn erschienen sind, auf einer alten Schreibmaschine in einer winzigen, sehr aufgeräumten Bürobaracke, die in krassem Gegensatz zu seinem "untidy mind", seinem unaufgeräumten Geist, steht, den er unverhohlen eingesteht. Wenn das Sonnenlicht im australischen Hinterland zu stark durch die Fenster strahlt, zieht er die Vorhänge zu, knipst eine Leselampe an und tippt mit zwei Fingern im, wie er sagt, perfekten Einklang mit dem Aufkommen seiner Gedanken.
All das wissen wir aus nicht sonderlich stilisiert wirkenden Filmbeiträgen, meist für das australische Fernsehen, in denen Murnane regelmäßig als aussichtsreicher Kandidat für den Literaturnobelpreis vorgestellt wird. Wobei der Schriftsteller in einem dieser Beiträge ohne weitere Begründung sagt, dass er nach der Verleihung desselben "sicher" nicht mehr schreiben könne. Kurioserweise ist Murnane außerhalb Australiens vor allem in Schweden bekannt; in Deutschland sind bisher erst zwei seiner Bücher erschienen, beide im letzten Jahr. Erst der Band "Die Ebenen", im englischen Original 1982 herausgekommen, dann vor wenigen Monaten "Grenzbezirke", das in Australien 2017 erschien.
Muss man das alles wissen, wenn man "Grenzbezirke" aufschlägt? Jedenfalls ist man nach den ersten Seiten dieses "Berichts", der sich mit "scheinbar fiktionalen Stoffen" beschäftigt, wie der Autor schreibt, dankbar für jeden Strohhalm, der einem eine Richtung weist. Wie ernst nimmt dieser Autor selbst seine Gedanken und Beobachtungen, die er an einer frühen Stelle im Buch als "langweilig", "banal" und "kindisch" beschreibt, wie ironisch ist er?
Liest man sich in Murnanes Bücher ein, muss man sich von Beginn an nicht nur über den Autor, sondern auch über die Abschweifungsfähigkeit des menschlichen Geistes wundern. Und eigentlich am meisten darüber, dass dieser Geist sein Potential ausgerechnet an einem liebenswürdigen älteren Herrn beweist, der vor dem Mainstream in die australische Provinz geflüchtet ist, um die Schilderung von allerlei Alltäglichkeiten derart mit überzeitlicher Bedeutung aufzuladen, dass man als Leser das recht schmale Buch gedanklich erschöpft zwar ein Dutzend Mal weglegen muss, jedes Mal aber zufrieden zurückbleibt. Dabei gehen Murnanes Gedankengänge selten in einer direkten Erkenntnis oder Pointe auf.
Es stehen Sätze darin, die einen kurzzeitig verwirren, einem zugleich aber so vertraut und substantiell vorkommen, dass man sie im Grunde als den wahren Mainstream bezeichnen könnte: einen Gedankenstrom voller innerer Fragen und Antwortversuche, den zu hören sich die meisten Menschen abgewöhnt haben, der aber möglicherweise die Grundlage des Allgemein-Menschlichen darstellt. Man staunt bei der Lektüre der "Grenzbezirke" ebenso oft darüber, in welch abenteuerliche Abseitigkeiten sich Murnane zu verlieren traut, wie man sich fragt, warum so etwas nicht viel öfter gewagt wird und wie verarmt doch letztlich die Vorstellungswelt vieler Autoren (und auch die eigene) im Vergleich zu jener Murnanes ist.
Worum geht es in diesem Buch, dem eine lineare Handlung im klassischen Sinne fehlt? Zunächst einmal um nicht mehr und nicht weniger als einen in die Jahre gekommenen Mann, der in einem abgelegenen Grenzgebiet "Absätze" schreibt - vor allem über Erinnerungen, die von Gegenständen (Buntstiften, Murmeln, Pop-Songs) ausgelöst werden, wobei Murnane betont eigenständig Marcel Prousts "Recherche" fortführt. Es gibt aber auch Passagen über brisante und aktuelle Themen wie die Frage: Was geht im Glauben eines Priesters vor, der Kinder missbraucht?
Faszinierend naheliegende Fragen wie diese schüttelt Murnane nur so aus dem Ärmel: Warum ist es so schwierig, beim Meditieren den Geist zu leeren; warum bedauert man bei einer Schwarzweißfotografie so selten, dass sie keine Farbe hat; warum werden manche Menschen am Schreibtisch plötzlich zu Exzentrikern?
Murnane wird zu einem solchen vor allem durch die Regeln, die er sich in seinem Schreibexperiment auferlegt. So nimmt er sich vor, "sämtliche Bilderfolgen aufzuzeichnen, die mir in den Sinn kommen, nachdem ich meine Aufmerksamkeit auf die signalisierende oder zuzwinkernde Einzelheit gerichtet habe", nach der er vor allem an den "Rändern" seines "Gesichtsfeldes" Ausschau hält. Mit einer ähnlichen Aussage, allerdings weniger abstrakt, hatte er bereits den Roman "Die Ebenen" begonnen.
An einigen wenigen Stellen führt das Experiment zu leblosen Passagen, ansonsten aber sitzt man als Leser staunend vor einem Gedankenbild-Lichtspieltheater, das seinen Sog aus einer Art literarischen 3D-Technik mit räumlichen und zeitlichen Überlagerungen gewinnt, die wie in der folgenden Passage elegant durch ein taktiles Moment verbunden werden und den Übersetzer Rainer Schmidt vor größte Herausforderungen gestellt haben: "eine einzelne Murmel konnte an mehr erinnern, als ich suchte: an einen ganzen Nachmittag in meiner Kindheit oder an eine Baumreihe in einem Hinterhof, wo ich doch nur ein paar bestimmte Augenblicke zurückgewünscht hatte, in denen mein Geist von ein paar bestimmten Blättern gestreift wurde".
Am faszinierendsten aber sind Murnanes Gedanken über das Lesen und die Theorie der Wahrnehmung, welche die Hauptfigur anhand von farbigen Fensterbildern entwickelt. Dabei stellt Murnane das Lektüreerlebnis als eigene Welt hinter der literarischen vor. Mindestens ebenso wichtig wie das Gelesene sind für ihn all jene Wahrnehmungen, die die Lektüre begleitet haben: Ort, Zeit, Lebenssituation und natürlich Fragen. In welchen Räumen siedeln wir unsere Lektürevorstellungen an; wie genau stellt man sich beim Lesen eine Landschaft vor? Zentral für das gesamte Buch aber ist das Leitmotiv der bunten Glasfenster, in denen sich sowohl die Wirklichkeit als auch die fiktive Welt einfärben und die, wie der Ich-Erzähler betont, ihn zum Abfassen seines Berichts veranlasst haben.
Darum schreibt Gerald Murnane wohl Bücher, weil bei einem Buntglasfenster der äußere Betrachter nicht nachvollziehen kann, was der innere sieht. Und es wäre keine Verständigung zwischen beiden möglich, wenn Murnane nicht versuchte, aller Schwierigkeit zum Trotz, die eigene Wahrnehmung mit seinen Lesern zu teilen. Auf den Schlussseiten der "Grenzbezirke" bemüht er zu diesem Zweck sogar religiöse Bilder, zu denen er schon vor langer Zeit den Glauben verloren hat.
UWE EBBINGHAUS
Gerald Murnane: "Grenzbezirke".
Aus dem Englischen von Rainer G. Schmidt. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 231 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Dorothea Dieckmann legt sich für den australischen Autor Gerald Murnane ins Zeug, der in Australien erst spät, hierzulande nur ansatzweise entdeckt wurde. Murnane führt ein zurückgezogenes Leben, weiß Dieckmann, er reist kaum, fliegt nicht. Aber er hegt eine Obsession für Pferderennen, die auch in seinem neuen Buch "Grenzbezirke" eine große Rolle spielen. So viel kann Dieckmann immerhin über den Inhalt des Buches sagen, denn Murnane entwerfe eher eine "geistige Bildwelt", als dass er im konventionellen Sinne erzähle, erklärt die Rezensentin: Leitmotive, Bilder und Wahrnehmungen verbinden sich in Murnanes Literatur zu einem fiktionalen Universum, in dem Wirklichkeit und Möglichkeit zusammenfallen. Für die Rezensentin ist das nicht weniger als die "Neuerfindung des Erzählens".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
» ... einer der merkwürdigsten Autoren, die ich je gelesen habe. Sich dem Merkwürdigen zu nähern, ist immer nicht so ganz einfach, aber wenn man es dann hat, dann denkt man: 'An welch magischer Kraftquelle sitzt man denn da?'« Ijoma Mangold SWR 20190523