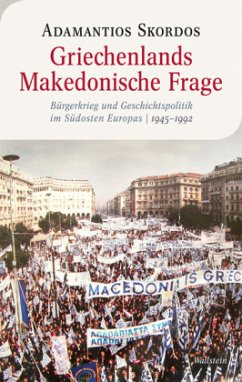Der Namensstreit mit der Republik Makedonien vor dem Hintergrund der griechischen Nachkriegsgeschichte. Die Unabhängigkeitserklärung der Sozialistischen Republik Makedonien von Jugoslawien 1991 löste im benachbarten Griechenland eine Protestwelle aus. Die angrenzende griechische Region Makedonien beanspruchte den Namen für sich. Die Makedonische Frage dominierte seitdem die Innen- und Außenpolitik Griechenlands und beeinflusste dessen Haltung in der Jugoslawien-Krise stark. Bis heute verlangt Athen von der Republik Makedonien eine Änderung ihres offiziellen Namens. Angesichts der zunehmenden makedonischen Anstrengungen, Mitglied der NATO und der EU zu werden, gewinnt der Namensstreit erneut an Brisanz. Adamantios Skordos beleuchtet die Rolle des Griechischen Bürgerkriegs in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre sowie seiner späteren geschichtspolitischen Vereinnahmungen für die Haltung der Griechen 1991. Auf breiter Quellengrundlage analysiert er, wie die Makedonische Frage die unmittelbare Bürgerkriegswahrnehmung beeinflusste, welche Stellung sie in der antikommunistisch und antislawisch geprägten Erinnerungskultur der Sieger einnahm und wie im Zuge des politischen Umbruchs von 1974 eine folgenreiche De-Makedonisierung des kollektiven Bürgerkriegsgedächtnisses erfolgte.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit diesem Buch des griechisch-österreichischen Historikers Adamantios Skordos begreift Michael Martens die außenpolitischen Ziele der Griechen vor allem in der Mazedonien-Frage etwas besser, für irrational hält er sie dennoch. Die These des Autors, der die aktuelle griechische Mazedonien-Politik wesentlich auf den griechischen Bürgerkrieg bis 1949 zurückführt, scheint Martens in diesem Buch überzeugend dargelegt. Ihr zufolge steht am Beginn der Problematik die offizielle Athener Erinnerungs- beziehungsweise Verdrängungspolitk bezüglich der deutsch-italienisch-bulgarischen Besatzung und der slawischen Beteiligung (auf Seiten der griechischen Kommunisten) am folgenden Bürgerkrieg. Die Sozialisation der aktiven griechischen Politikergeneration zu jener Zeit erhält im Hinblick auf die Mazedonien-Politik für Martens neue Bedeutung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Ursprünge des Streits zwischen Griechenland und Mazedonien
Im Jahr 1991 wurden Griechen in aller Welt von einer rätselhaften Krankheit erfasst: der Mazedonien-Hysterie. Mit einer für Außenstehende unverständlichen Aggressivität beharrten sie darauf, dass Mazedonien, der südlichste aus dem Zerfall Jugoslawiens hervorgegangene Staat, nicht Mazedonien heißen dürfe. Dieser Name gebühre nämlich allein den Griechen beziehungsweise der gleichnamigen Provinz im Norden Griechenlands.
Binnen Monaten kam es zu einer völligen "Makedonisierung" der griechischen Öffentlichkeit. Die staatliche Fluglinie Olympic Airways gründete ein Tochterunternehmen namens Macedonian Airlines, mit dem sogenannten Stern von Vergina als Logo, einem Symbol der antiken Makedonier. Armbinden mit diesem Stern wurden zum Verkaufsschlager. Die Flughäfen von Kavala und Thessaloniki wurden in "Alexander der Große" und "Makedonien" umbenannt. Ein Hafen an der thrakischen Küste hieß fortan "Philipp der Zweite". Die griechische Post gab Makedonien-Sondermarken heraus. Hunderttausende demonstrierten in Athen und Thessaloniki unter der Losung "Makedonien ist griechisch" gegen den Namen des Nachbarstaates. Staatspräsident Karamanlis - Tränen in den Augen, mit zittriger Stimme, ein Schluchzen unterdrückend - sagte: "Sie müssen endlich einsehen, dass es nur ein Makedonien gibt. Und dieses Makedonien ist griechisch."
Gelöst ist der "Namensstreit" bis heute nicht. Griechenland verhindert unter Verweis darauf jegliche Annäherung Mazedoniens an Nato und EU, den Spott und das Unverständnis seiner westlichen Partner in Kauf nehmend. Wie kommt es, dass ein Mitgliedstaat der EU eine derart irrationale Politik verfolgt? Oder ist die Haltung der Griechen am Ende gar nicht so irrational, wie es allen anderen scheint?
Der österreichische Historiker Adamantios Skordos, dessen Name die griechischen Wurzeln verrät, hat ein wichtiges Werk zum "Namensstreit" vorgelegt. Wer sich für griechische Außenpolitik interessiert, sollte es lesen. Wer es gelesen hat, dürfte die Athener Position im Namensstreit zwar immer noch für irrational halten, wird aber wenigstens verstehen, woher die Irrationalität kommt. Skordos' überzeugend belegte These lautet, dass die "Makedonien-Hysterie" der Griechen nur vor dem Hintergrund des griechischen Bürgerkriegs verstanden werden kann, der sich an die deutsch-italienisch-bulgarische Besatzung des Landes anschloss und 1949 mit der Niederlage der Linken endete. Die im "Namensstreit" griechischerseits vorgebrachte Berufung auf Alexander den Großen lenkt laut Skordos vom Kern des "Namensstreits" ab. Es geht nämlich nicht um 330 vor, sondern um 1949 nach Christus.
Um seine These zu belegen, wirft der Autor einen Blick auf den griechischen Bürgerkrieg und vor allem auf die offizielle Athener Erinnerungspolitik daran. Die ist zwar von einigen Brüchen gekennzeichnet, weist aber eine Konstante auf: Ein wesentlicher Aspekt des Bürgerkrieges, die maßgebliche Beteiligung slawischer (manche würden sagen: mazedonischer) Kämpfer auf Seiten der griechischen Kommunisten wird verzerrt oder gar nicht dargestellt. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie wenig viele Griechen darüber wissen. Eine über Jahrzehnte betriebene, selektive Gedenkpolitik hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Skordos spricht von einem gesellschaftlichen Erinnerungsfoto, das so lange retuschiert wurde, bis es nationalkonform war.
Als in Griechenland "Linke" gegen "Rechte" kämpften, spielten auf Seiten der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) Slawophone - griechische Bürger, deren Muttersprache ein slawischer Dialekt ist (ob es sich um "Bulgarisch", "Mazedonisch" oder nur einen Dialekt handelt, ist ein gesonderter Streitfall) - eine wichtige Rolle. Wie viele Slawen damals in Nordgriechenland lebten, ist umstritten. In einem Bericht des griechischen Außenministeriums ist noch 1965 die Rede von bis zu 150 000 "Slawophonen". Fest steht, dass auf dem Höhepunkt des Bürgerkrieges die meisten der etwa 26 000 Kämpfer in den Reihen der Kommunisten slawophone Griechen waren - beziehungsweise mazedonische Slawen oder slawische Mazedonier, je nach Sichtweise.
Um die slawische Bevölkerung Nordwestgriechenlands für den Partisanenkrieg gegen die Deutschen zu rekrutieren und eine bessere Ausgangsposition für den innergriechischen Machtkampf nach deren Abzug zu haben, hatte die KKE sogar eigene Kampfeinheiten mit slawophonen Griechen gegründet: Die "Slavjano-Makedonski Narodno Osloboditelen Front", zu Deutsch "slawisch-makedonische Volksbefreiungsfront". Die Abhängigkeit der Kommunisten von den Slawophonen hatte allerdings ihren Preis. Gegen Ende des Bürgerkrieges versprach die KKE dem "mazedonischen Volk" in Nordgriechenland für den Fall eines kommunistischen Sieges die "nationale Rekonstituierung", ja sogar die "Konstituierung Makedoniens als vereinte, unabhängige und gleichberechtigte Teilrepublik innerhalb einer volksdemokratischen Föderation der Balkanvölker." Dies wurde von den Rechten, aber auch von vielen griechischen Kommunisten als Bereitschaft der KKE verstanden, "den Slawen" griechisches Territorium abzutreten.
Jahrzehntelang hing dieser "nationale Verrat" der KKE an. Bedroht war der 1912 im ersten Balkankrieg von Griechenland erkämpfte Teil der historischen Region Makedonien zeitweilig tatsächlich. Im April 1945 sagte der jugoslawische Diktator Tito während eines Besuchs in Moskau, zwar erhebe sein Land "vorläufig" keine territorialen Ansprüche gegen Athen, werde sich aber einer Vereinigung der "Makedonier Griechenlands mit ihren Landsleuten in Jugoslawien" nicht widersetzen. Wenige Monate später forderte Tito dann offen die Vereinigung "aller Makedonier in ihrem Land". Vor der Pariser Friedenskonferenz von 1946 verlangte Belgrad sogar offiziell die Lostrennung "Ägäis-Makedoniens" von Griechenland und seinen Anschluss an Jugoslawien, da das "makedonische Volk" endlich "vom griechischen Joch" befreit werden müsse. Die Athener Zeitung "Kathimerini" schrieb von einer "Kriegserklärung von 200 Millionen Slawen" an Griechenland und brachte damit auf den Punkt, was viele Griechen dachten.
Doch die griechische Linke verlor den Krieg, und die Sieger erhoben ihre Sichtweise der Ereignisse zur staatlichen Erinnerungspolitik. Sie stilisierten den Bürgerkrieg zum "slawokommunistischen Banditenkrieg" um. Neue Fest- und Trauertage wurden eingeführt, deren wichtigster der "Jahrestag des Sieges über die kommunistischen Banditen" war. Schulklassen wurden in patriotischen Ausflügen an Schauplätze vermeintlicher oder echter "slawischer" Verbrechen geführt. Die Armee gab hetzerische Spielfilme in Auftrag, um das antislawische Bewusstsein der Bevölkerung zu festigen.
Öffentliche Reuebekenntnisse "bekehrter" Kommunisten taten ein Übriges. Zwar kam es zu einer Zäsur, als Andreas Papandreou 1981 seine Sozialisten an die Macht führte und die Linken die Kontrolle über die Erinnerungspolitik übernahmen. Das "Projekt der antislawischen Sinnstiftung" (Skordos) war schon nach der türkischen Besatzung Zyperns von einem stärker auf die Türkei fokussierten Feindbild abgelöst worden. Die im Norden des eigenen Landes siedelnden Slawen standen aber weiter im Verdacht, eine fünfte Kolonne ausländischer Mächte zu sein. Wer sich vor Augen führt, dass die heute maßgebliche Generation griechischer Politiker, etwa Ministerpräsident Samaras, in dieser Zeit sozialisiert wurde, wird sich über Athens Mazedonien-Politik weniger wundern.
MICHAEL MARTENS
Adamantios Skordos: Griechenlands Makedonische Frage. Bürgerkrieg und Geschichtspolitik im Südosten Europas, 1945-1992. Wallstein Verlag, Göttingen 2012. 439 S., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main