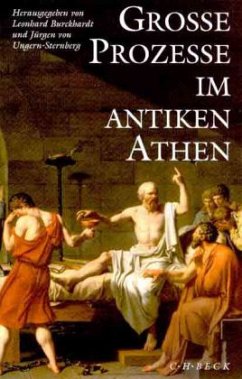In diesem Band begegnen uns viele jener Persönlichkeiten wieder, die damals die Geschichte der berühmtesten aller griechischen Städte bestimmten, wie etwa Themistokles, Perikles, Alkibiades und Demosthenes. Sie alle waren irgendwann die Helden ihrer Heimatstadt Athen und gerieten doch letztlich in die Mühlen ihrer - politischen - Justiz. Das prominenteste Opfer der athenischen Volksgerichte wurde zweifellos Sokrates, dem sein Witz und seine Schlagfertigkeit ebenso wenig halfen wie der Satz des Orakels von Delphi, er sei der weiseste aller Menschen.
Aber natürlich wurden nicht nur politisch motivierte Prozesse in Athen geführt. Auch ganz "bürgerliche" Gerichtsfälle sind berühmt geworden und finden dank ihrer überzeitlichen Thematik noch heute unser ungebrochenes Interesse: Was tut etwa ein braver athenischer Ehemann, wenn er einen Ehebrecher in flagranti erwischt? Und wie wehrt sich eine Familie, wenn ihr Erbe ins "Rotlichtmilieu" transferiert werden soll?
In eigenen Beiträg en werden dem Leser zudem Aufbau und Geschichte des athenischen Gerichtswesens, aber auch wichtige Rechtsinstitutionen wie das sprichwörtlich gewordene Scherbengericht erklärt, um den rechtshistorischen Rahmen der großen Prozesse zu veranschaulichen.
Aber natürlich wurden nicht nur politisch motivierte Prozesse in Athen geführt. Auch ganz "bürgerliche" Gerichtsfälle sind berühmt geworden und finden dank ihrer überzeitlichen Thematik noch heute unser ungebrochenes Interesse: Was tut etwa ein braver athenischer Ehemann, wenn er einen Ehebrecher in flagranti erwischt? Und wie wehrt sich eine Familie, wenn ihr Erbe ins "Rotlichtmilieu" transferiert werden soll?
In eigenen Beiträg en werden dem Leser zudem Aufbau und Geschichte des athenischen Gerichtswesens, aber auch wichtige Rechtsinstitutionen wie das sprichwörtlich gewordene Scherbengericht erklärt, um den rechtshistorischen Rahmen der großen Prozesse zu veranschaulichen.

Massenmacht: Althistoriker wecken Verständnis für die Volksrichter Athens / Von Uwe Walter
Der qualitative Vergleich antiker Rechtsordnungen sieht die Römer als klare Sieger, schufen sie doch ein juristisches System, das sich über große Teile der Welt verbreiten konnte - und das lange nach dem Erlöschen ihres Reiches. Die Rezeption des römischen (Privat-)Rechts vom Mittelalter bis hin zu den Kodifikationen des neunzehnten Jahrhunderts war möglich, weil es von den konkreten Gegebenheiten der Gesellschaften, in denen es sich entwickelte, abgelöst und wegen seines hohen Abstraktionsgrades auf andere Ordnungen übertragen werden konnte. Es orientierte sich an wenigen Grundbegriffen, wurde im Laufe der Zeit immer weiter fortgebildet und systematisiert und schließlich im sechsten Jahrhundert nach Christus durch Kaiser Justinian in einem umfassenden Corpus zusammengefaßt.
Eng gebunden an das Substrat der soziopolitischen Ordnung des demokratischen Bürgerstaates war hingegen die Rechtspraxis Athens im fünften und vierten Jahrhundert vor Christus. Sie hat spätestens seit dem Moment, als Platon in der "Apologie" den Prozeß gegen Sokrates wegen Einführung neuer Götter und Verführung der Jugend zum Willkürakt eines wankelmütigen und manipulierbaren Pöbels gegen den vermeintlich besten Menschen nicht nur seiner Zeit stilisierte, eine denkbar schlechte Presse. Eine politisierte Justiz, die gegen das Urbild aller Philosophen, den hartnäckigen Wahrheitssucher, nach einer offenkundig dubiosen Anklage ein Todesurteil fällte, verdiente nur Abscheu. Daß Sokrates entgegen allen Erwartungen das Urteil auf sich nahm und den Giftbecher tatsächlich leerte, steigerte das Fehlurteil zum Justizmord. Generationen von Schülern humanistischer Gymnasien verinnerlichten bei der Lektüre der Verteidigungsrede die fundamentale Denkfigur des einzelnen, der gegen die Masse steht. Die Ankläger werden ironisiert, das Volk lärmt. In der einst berühmten Schallplattenaufnahme der Rede mit Walter Krauss erscheinen die "Männer von Athen" nur als aufbrausendes, gänzlich amorphes Hintergrundgeräusch. Es war Platons geniale Leistung, den Prozeß aus seinem historisch-politischen Kontext herauszulösen und Sokrates zum Märtyrer zu machen.
Wem dieses Bild zu einfach erschien, mußte folgerichtig bemüht sein, die platonische Entkontextualisierung rückgängig zu machen und die Motive und Hintergründe des Prozesses aufzuhellen. Dies tat ausführlich schon in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts George Grote in seiner großen "History of Greece". Ihm folgte der liberale Publizist Irving F. Stone mit seinem Buch "Der Prozeß gegen Sokrates" (F.A.Z. vom 10. August 1991). In seinem Beitrag zu "Große Prozesse im antiken Athen" zeichnet Peter Scholz die Zusammenhänge noch einmal nach: wie Sokrates zunächst eher bespöttelt wurde, dann aber durch seine persönliche Nähe zu Protagonisten des oligarchischen Terrorregimes von 404/403 und als angeblicher "Volkshasser" zu negativer Popularität gelangte, die sich durch sein unverändert provozierendes, allen Regeln des gesellschaftlichen und religiösen Konventionalismus hohnsprechendes Auftreten nicht verminderte. Mindestens einer der Ankläger war Opfer der diktatorischen Oligarchie gewesen, während Sokrates sogar zum Kreis ihrer Vollbürger gehörte. Das machte ihn auch zur Zielscheibe legitimer Rachebedürfnisse. Seine Verteidigungsrede war der letzte und ärgste Bruch mit dem Regulativ des Erwartbaren, und doch war die Mehrheit für den Schuldspruch nur knapp. Es gibt andererseits keine Anzeichen für spätere Reue, und Jahrzehnte später konnte ein Redner bündig feststellen: "Ihr habt Sokrates, den Sophisten, hingerichtet, weil er als der Erzieher des Kritias erschien, eines der dreißig, welche die Demokratie umstürzten."
Die nüchterne Rekontextualisierung funktioniert nicht nur hier. Alle Beiträge des lesenswerten Sammelbandes, die einführenden Überblicksartikel zu den Institutionen und Regeln der gerichtlichen Praxis wie die Fallstudien zu einzelnen Prozessen, finden ihre gemeinsame Mitte darin, weder überzeitliche Gerechtigkeitsideale noch die Rezipierbarkeit für spätere Epochen zum Maßstab ihrer Einschätzung der athenischen (Straf-)Rechtsordnung zu machen. In der Tat war diese geradezu ein Abbild der Grundprinzipien der demokratischen Polis, in der jährlich 6000 Bürger ihren Dienst als Richter versahen. Den durch Los besetzten und mit ausgeklügelten Mechanismen gegen Absprachen, Gruppenbildung und Bestechung geschützten Gerichtshöfen oblag neben der Streitschlichtung letztlich auch die Kontrolle der führenden Politiker durch den kleinen Mann, zumal nach dem faktischen Erlöschen des Ostrakismos ("Scherbengericht"), den Martin Dreher überzeugend nicht nur als Waffe im inneraristokratischen Machtkampf, sondern auch als institutionalisierten Ausdruck der Mißbilligung falschen Verhaltens der Elite durch die Bürgerschaft deutet.
Zugleich boten die Gerichte ein Forum zum Austrag von politischem Streit und stellten die Demokratie gleichsam täglich auf die Bühne, weil in den agonalen Rededuellen zwischen Anklägern und Angeklagten die Mitglieder der führenden Schicht um Einfluß rangen. Dabei spielten die Amtsträger der Polis keine aktive Rolle, sondern überwachten nur den Verfahrensablauf. Eine Beweiswürdigung und Zeugenbefragungen im Prozeß selbst gab es ebensowenig wie komplexe juristische Argumentation, Urteilsbegründungen oder Revisionsmöglichkeiten. Das Recht war als Diskurs gar nicht, als Organisation so wenig wie möglich verselbständigt. Es zählte die Evidenz und das, was auch sonst das meiste Gewicht hatte: Lebenswandel, demokratische Gesinnung, Verdienste um die Gemeinschaft in Krieg und Frieden. Die Kehrseite liegt auf der Hand: Enttäuschte Hoffnungen und kollektive Traumata schlugen sich ebenso wie Brüche im Politischen unmittelbar in Anklagen und überharten Urteilen nieder.
Nicht zufällig fanden einige der berühmtesten politischen Prozesse während der für Athen so katastrophalen Endphase des Peloponnesischen Krieges oder kurz danach statt. Einer der spektakulärsten war die Verurteilung und Hinrichtung mehrerer Befehlshaber, die es angeblich versäumt hatten, nach dem athenischen Sieg in der Seeschlacht bei den Arginusen die eigenen Schiffbrüchigen zu retten. Bei diesem Urteil spielten gewiß Machenschaften einzelner Führer eine Rolle. Die eigentliche Ursache freilich sieht Leonhard Burckhardt mit Recht darin, daß in diesem Prozeß - unabhängig von den wegen eines Sturmes unsicheren Aussichten auf Rettung - die Achtung vor dem Leben des einzelnen Bürgers als Träger der Polis und der absolute Wille des souveränen Volkes brachial durchgesetzt wurden, was auf Kosten anderer Werte gehen mußte, die für das Funktionieren und die Akzeptanz einer rechtlich-politischen Ordnung auf Dauer freilich unaufgebbar sind, also Sicherheit, Berechenbarkeit von Konfliktregelungsmechanismen und Schutz vor Willkür. Die eigentliche Pointe läßt Burckhardt freilich aus: Auch nach der Hinrichtung der sechs Strategen fanden sich in den Folgejahren stets reichlich Kandidaten für dieses offensichtlich so risikoreiche Amt. Zur Alleinherrschaft des Politischen gab es offenbar keine Alternative.
Die Fallstudien bieten, hintereinander gelesen, auch eine dichte und zugleich gut nachvollziehbare Einführung in zentrale Ereignisse und Phänomene der athenischen Geschichte; die begrenzten Möglichkeiten der historischen Rekonstruktion für das fünfte Jahrhundert treten ebenso plastisch hervor wie die Religion als Maßstab von politischer Konformität. Doch auch der Alltag kommt zu seinem Recht, soweit er sich in Privatprozessen spiegelt. Eine der analysierten Reden zeichnet das faszinierend manipulative Selbstbild eines biederen Bürgers, der den Liebhaber seiner Frau erschlägt und dabei auf dem schmalen Grat der gerechtfertigten Tötung wandelt, eine andere läßt den Leser bei einem Erbschaftsprozeß - auch damals eine häßliche Sache - in die Abgründe einer prekären Existenz zwischen bürgerlicher Wohlanständigkeit und Halbwelt blicken.
Leonhard Burckhardt, Jürgen von Ungern-Sternberg (Hrsg.): "Große Prozesse im antiken Athen". Verlag C. H. Beck, München 2000. 301 S., geb., 54,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Große Prozesse und eine ganz klitzekleine Besprechung dazu von Stefan Fischer. Fischer zeigt sich erfreut über den "detaillierten Blick" auf das Gerichtswesen im antiken Athen, den der Band ermöglicht, auf das "Procedere politischer Entscheidungsfindung" - und auf die Vorgeschichte der Beteiligten sowie auf die "innen- und außenpolitische Situation, aus der sich die Stimmung in der Polis-Gemeinschaft erklärt." Achtung hat der Rezensent vor der kritischen Behutsamkeit der Autoren im Umgang mit den Quellen ("sie scheuen sich nicht, notfalls etwas im Ungewissen zu lassen"); dass über das Todesurteil gegen Sokrates "nur Vermutungen" geboten werden, macht ihn also nicht bös.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH