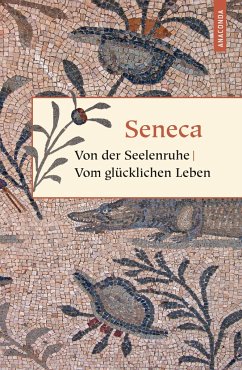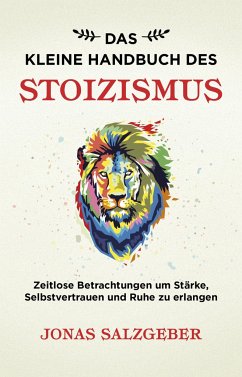Nicht lieferbar
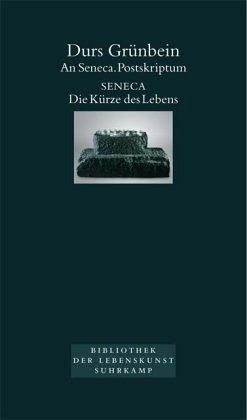
Grünbein, Durs;Seneca, der Jüngere
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
"So ist's: Wir erhalten kein kurzes Leben, sondern haben es dazu gemacht, und es mangelt uns nicht an Zeit, sondern wir verschwenden sie." Als Stoiker widmet Seneca sein Denken der Lebenspraxis: dem gut geführten Leben, das, von Vernunft geleitet, Affekten widersteht. Seelenruhe zu erlangen ist das erklärte Ziel.Auf die Frage, wie denn zu leben sei, antwortet Seneca mit "lebe jetzt", "verschaff dir Muße", "zieh dich von den anderen zurück", "widme dich der Philosophie" - und nicht der Karriere, der Ablenkung und Zerstreuung. Um so bewegter war sein eigenes Leben: Ruhm, Verbannung, Macht un...
"So ist's: Wir erhalten kein kurzes Leben, sondern haben es dazu gemacht, und es mangelt uns nicht an Zeit, sondern wir verschwenden sie." Als Stoiker widmet Seneca sein Denken der Lebenspraxis: dem gut geführten Leben, das, von Vernunft geleitet, Affekten widersteht. Seelenruhe zu erlangen ist das erklärte Ziel.
Auf die Frage, wie denn zu leben sei, antwortet Seneca mit "lebe jetzt", "verschaff dir Muße", "zieh dich von den anderen zurück", "widme dich der Philosophie" - und nicht der Karriere, der Ablenkung und Zerstreuung. Um so bewegter war sein eigenes Leben: Ruhm, Verbannung, Macht und Rückzug.
Durs Grünbein befreit den berühmten Text aus der Schublade der ewig haltbaren Lebensrezepte. Ihn interessiert das Janusköpfige des Philosophen, seine schriftstellerische Könnerschaft, der Widerspruch zwischen Philosophie und Leben, aus dem gar Dichtung entsteht. "Wie kommt ein erwachsener Römer dazu, dem Freund in der Pose des Ratgebers entgegenzutreten? Warum opfert einer seine kostbare Freizeit, um einen Essay zu schreiben zum Thema Von der Kürze des Lebens?" Durchaus affektvoll schreibt Grünbein einen Brief, ein Postskriptum an Seneca: "Du hattest recht. Das kurze Leben raunt uns zu: halt an, / Eh die Affekte dich versklaven." Aber: "Was, wenn wir unbelehrbar sind, verstockt und in uns regt / bei jedem Ja ein Nein sich ..."
Lucius Annaeus Seneca, geboren um 4 v. Chr. in Córdoba (Spanien), gestorben 65 n. Chr. in Rom, philosophischer Schriftsteller und Dichter, Erzieher Neros.
Auf die Frage, wie denn zu leben sei, antwortet Seneca mit "lebe jetzt", "verschaff dir Muße", "zieh dich von den anderen zurück", "widme dich der Philosophie" - und nicht der Karriere, der Ablenkung und Zerstreuung. Um so bewegter war sein eigenes Leben: Ruhm, Verbannung, Macht und Rückzug.
Durs Grünbein befreit den berühmten Text aus der Schublade der ewig haltbaren Lebensrezepte. Ihn interessiert das Janusköpfige des Philosophen, seine schriftstellerische Könnerschaft, der Widerspruch zwischen Philosophie und Leben, aus dem gar Dichtung entsteht. "Wie kommt ein erwachsener Römer dazu, dem Freund in der Pose des Ratgebers entgegenzutreten? Warum opfert einer seine kostbare Freizeit, um einen Essay zu schreiben zum Thema Von der Kürze des Lebens?" Durchaus affektvoll schreibt Grünbein einen Brief, ein Postskriptum an Seneca: "Du hattest recht. Das kurze Leben raunt uns zu: halt an, / Eh die Affekte dich versklaven." Aber: "Was, wenn wir unbelehrbar sind, verstockt und in uns regt / bei jedem Ja ein Nein sich ..."
Lucius Annaeus Seneca, geboren um 4 v. Chr. in Córdoba (Spanien), gestorben 65 n. Chr. in Rom, philosophischer Schriftsteller und Dichter, Erzieher Neros.