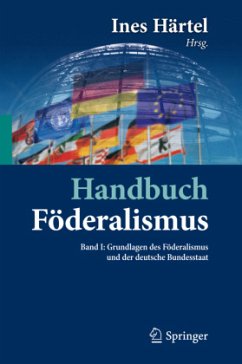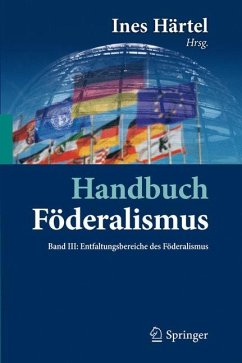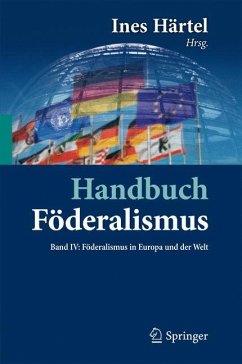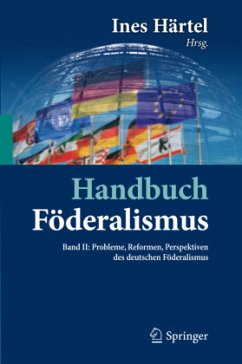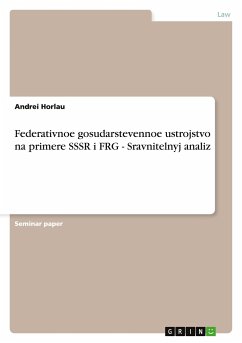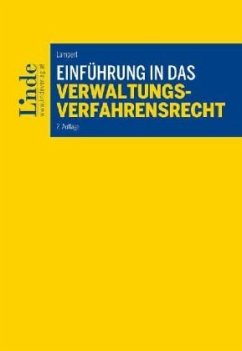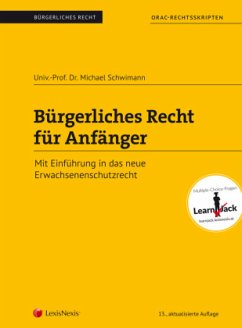Nicht lieferbar
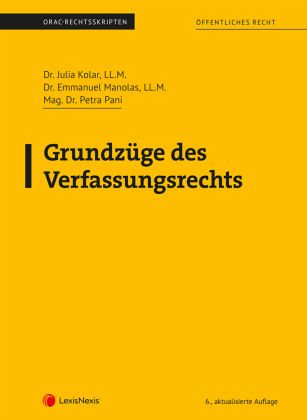
Grundzüge des Verfassungsrechts (Skriptum)
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Das vorliegende Werk bietet einen kompakten Zugang zum Verständnis des österreichischen Verfassungsrechts. Die Darstellung folgt den Grundprinzipien der Bundesverfassung und stellt Zusammenhänge zwischen den einzelnen Begriffen und Instituten des öffentlichen Rechts dar, die es sowohl Einsteigern im Verfassungsrecht ermöglicht, sich rasch einen verlässlichen Überblick zu verschaffen als auch Fortgeschrittenen wesentliche Bereiche des Verfassungsrechts näher bringt. In die Darstellung fließen in durchgängiger Form auch die wichtigsten Querbezüge zum Europarecht ein.Größter Wert wir...
Das vorliegende Werk bietet einen kompakten Zugang zum Verständnis des österreichischen Verfassungsrechts. Die Darstellung folgt den Grundprinzipien der Bundesverfassung und stellt Zusammenhänge zwischen den einzelnen Begriffen und Instituten des öffentlichen Rechts dar, die es sowohl Einsteigern im Verfassungsrecht ermöglicht, sich rasch einen verlässlichen Überblick zu verschaffen als auch Fortgeschrittenen wesentliche Bereiche des Verfassungsrechts näher bringt. In die Darstellung fließen in durchgängiger Form auch die wichtigsten Querbezüge zum Europarecht ein.
Größter Wert wird auf knappe und griffige Formulierungen bei gleichzeitig maximaler Vermittlung der Grundzüge des Lernstoffes gelegt. Die Falllösungsschematik der Grundrechtsprüfung wird in anschaulichen und bewährten Grafiken dargestellt.
Die vorliegende sechste Auflage des didaktisch seit über 20 Jahren bewährten Werkes bringt die Darstellung auf den Stand April 2020.
Größter Wert wird auf knappe und griffige Formulierungen bei gleichzeitig maximaler Vermittlung der Grundzüge des Lernstoffes gelegt. Die Falllösungsschematik der Grundrechtsprüfung wird in anschaulichen und bewährten Grafiken dargestellt.
Die vorliegende sechste Auflage des didaktisch seit über 20 Jahren bewährten Werkes bringt die Darstellung auf den Stand April 2020.