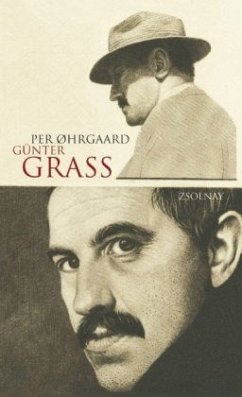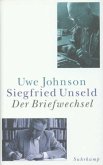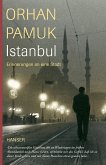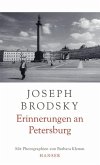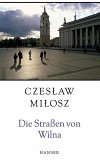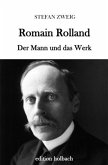Per Oehrgaards großer Essay über Günter Grass würdigt den deutschen Nobelpreisträger aus europäischer Perspektive. Er verfolgt das Leben des Autors von seinen Anfängen bis heute, von der frühen Lyrik und der Danziger Trilogie bis zum Nobelpreis und der jüngsten Novelle "Im Krebsgang". Dabei sind Leben und Werk nicht zu trennen, der Schwerpunkt liegt hier jedoch auf dem Werk selbst. Das Buch des renommierten Germanisten und Grass-Übersetzers Oehrgaard, 2001 mit dem Henrik-Steffens-Preis ausgezeichnet, ist nicht nur Grass-Kennern, sondern auch als Einführung zu empfehlen.

Aufgeschrieben hat er's, der Stoffel: Eine Günter-Grass-Biographie
Günter Grass ist sich seiner weltliterarischen Bedeutung gewiß, und er sorgt persönlich dafür, daß sie nicht abnimmt. Eine besondere Rolle spielt dabei der stetige Kontakt zu seinen Übersetzern. Bei ihnen weiß er sich in Gesellschaft von so intimen wie kritischen Kennern seines Werks. Seinen dänischen Übersetzer Per Øhrgaard hat Grass als einen akribischen Leser gepriesen, der nicht bereit sei, Unverständlichkeiten und Ungenauigkeiten hinzunehmen, der beharrlich alles Fragwürdige auf den Punkt bringe. In "Die Rättin" findet sich eine lyrische Liebeserklärung an die dänische Ferieninsel der Familie Grass, "mit der wir älter und dänischer hätten werden können". Dänischer werden aber heißt gelassener werden, und die Studie, die Øhrgaard dem bildenden Künstler und Schriftsteller gewidmet hat, zeichnet sich vor allem durch die Gelassenheit einer Betrachtung aus, die in souveräner Ortskenntnis durch die Textlandschaft um Danzig streift, hier eine Blume pflückt, dort eine Inschrift entziffert, hier in den Grund blickt, dort eine Aussicht weist.
Die Literaturtheorie der letzten Jahrzehnte ist an dem Kopenhagener Germanisten offenbar spurlos vorübergegangen. Leben und Werk werden in ihrer Einheit und Bezüglichkeit betrachtet, und Günter Grass erscheint als quicklebendiger Autor seines Werks und seiner Handlungen, der noch im Irrtum Größe zeigt. Daß Grass in Deutschland immer wieder "beschimpft und verleumdet" wurde, verzeichnet Øhrgaard trocken als Schicksal aller Großen, läßt aber keinen Zweifel daran, daß er für die deutsche Verkleinerungssucht kein Verständnis hat. Seine eigene Abneigung gegen großsprecherische Theorie findet der Übersetzer in seinem Autor wieder, und so bewundert Øhrgaard die spöttische Überlegenheit, mit der bereits der Anfänger in der "Blechtrommel" die damaligen Theorien vom Ende des Erzählens abfertigte. Für Grass sei von Anfang an unzweifelhaft gewesen, daß der Mensch sich selbst, die Welt und die anderen nur in Geschichten versteht.
Diese Geschichten aber hören niemals auf. Ein Ich erscheint bei Grass als "das jederzeit erzählende Bewußtsein". Die Überzeugung, daß nichts je aufhört, entspreche dem Geschichtsverständnis des Schriftstellers, dem noch das kleinste Detail erlittener Vergangenheit zur Gegenwärtigkeit erwachen könne. So bestehe das poetische Verfahren als Dialektik zwischen Stillstand und Fortschritt in der wechselseitigen Projektion von Zeitlichem und Räumlichem, in der Herstellung von Gleichzeitigkeit. Daß man es bei Grass immer mit "unzuverlässigen Erzählern" zu tun habe, zeige den Menschen in seinem so beschränkten wie produktiven Verhältnis zum Geschehenen. Auch die erfundenen Geschichten machen Geschichte.
Sowohl als bildender Künstler wie als Schriftsteller habe sich Grass trotz seiner Neigung zum "wilden Surrealismus" von jeher der genauen Beobachtung des Sichtbaren verpflichtet, sein Werk sei wesentlich gegenständlich. Freilich sei das Sichtbare bei Grass "stets mehr als bloß das unmittelbar Vorhandene" und allgemein Wahrgenommene. Er sei ein Künstler, der nicht ohne Entsetzen und Melancholie mehr sehe, als da ist. Seine Aufmerksamkeit richte sich vor allem auf das Unbeobachtete und "das Übriggebliebene" der menschlichen Wahrnehmung der Welt und der Überlieferung. Als solche sei sie immer bei denen, die Geschichte erleiden.
So sieht Øhrgaard den ethischen wie ästhetischen Grundsatz von Grass' Erzählkunst darin, daß man gelebtes Leben nicht für ungültig erklären dürfe, "auch nicht durch noch so große politische Umwälzungen". Gerade in Zeiten allgemeiner Verdrängungsbereitschaft muß davon neu erzählt werden, und zwar unabhängig von der Bewertung. Ob einer dabei recht behält, darauf kommt es nicht an. Nicht einmal Fonty aus "Ein weites Feld" sei als Rechthaber dargestellt. Dennoch sei der Roman im Deutschland der Wendezeit vielfach von einem einseitigen Standpunkt aus gelesen worden, aus dem die Vielschichtigkeit des Erzählten nicht gesehen werden konnte. Der Roman sei nicht nur Kritik der Wiedervereinigung, keineswegs einseitiger Ausblick in eine "apokalyptische Landschaft", er öffne vielmehr die Wahrnehmung für eine "Einbettung" der deutschen Verhältnisse in einen größeren Zusammenhang. Auch hier komme es auf das Übriggebliebene an.
Max Frisch hat Günter Grass einmal einen "Schriftsteller mit persönlicher Haftung" genannt. So hebt auch Øhrgaard hervor, daß sich Grass nie hinter ästhetischen oder ideologischen Programmen verschanzt hat. Sowohl im Werk wie in der politischen Stellungnahme setze er sich als Person aus, mache sich bewußt angreifbar und nehme den eigenen Irrtum in Kauf. Trotz unverbrüchlicher Verpflichtung auf das Ideal einer sozialen Demokratie sei Grass nie ein Utopist gewesen, im späten Werk verliere die Darstellung der Geschichte noch mehr an Eindeutigkeit. So zeige "Im Krebsgang", daß "die Geschichte nicht allein denen gehört, die Aufklärung und Demokratie verbreiten wollen". Daß ein Schriftsteller, der sich politisch einmischt, nicht unbedingt recht behalten möchte, scheint in Deutschland aber schwer vermittelbar.
Bei aller gelassenen Bewunderung des großen Autors ist das luzide Bild, das Øhrgaard von Grass zeichnet, kein Porträt des Künstlers als weiser alter Mann. Gelegentlich scheint der manchmal allzu betulich schreibende dänische Professor sich sogar ein wenig vor Unkontrolliertem und Maßlosem im "deutschen Schriftsteller" zu grausen. Noch im Nobelpreisträger sieht er den Stoffel, den wilden jungen Gelnhausen aus "Das Treffen in Telgte", dem der weise Heinrich Schütz sagt, er dürfe seine "Lügengeschichten nie wieder mörderisch ausleben, sondern er müsse sie beherzt niederschreiben".
FRIEDMAR APEL
Per Øhrgaard: "Günter Grass. Ein deutscher Schriftsteller wird besichtigt". Aus dem Dänischen übersetzt von Christoph Bartmann. Zsolnay Verlag, Wien 2005. 204 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rundum glücklich ist Friedmar Apel mit dieser Günter-Grass-Biografie des dänischem Germanisten und Grass-Übersetzers Per Ohrgaard. Dessen souveräne Kenntnis des Schriftstellers und seines Werks sowie die gelungene Darstellung haben ihn überzeugt. Er bescheinigt Ohrgaard, Grass' Leben und Werk unberührt von allen germanistischen Moden als Einheit zu betrachten und Grass dabei als "quicklebendigen Autor" vorzustellen. Ohrgaards Einschätzung des Schriftstellers als großen Erzähler mit genauer Beobachtungsgabe und ethischen Prinzipien kann Apel nur zustimmen. Ohrgaads "gelassene Bewunderung" für Grass scheint dem Rezensenten nicht unangebracht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH