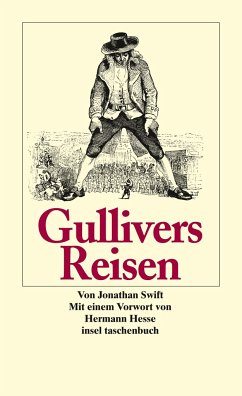Dieses Buch (...) wurde leider alsbald, verstümmelt und verkürzt, zur Kinder- und Jugendlektüre verniedlicht. Dabei handelt es sich bei diesem Buch um eine hochkarätige Satire auf die Lebensgewohnheiten und politischen Gepflogenheiten der damaligen Zeit, der der Autor das fadenscheinige Mäntelchen der exotischen Reisebeschreibung umhing. »Es steht also Zeitloses, es steht Menschliches in diesem Buch, das uns alle angeht, heut wie damals.« Hermann Hesse

Wiedergelesen: "Gullivers Reisen", in einer neuen Übersetzung / Von Katja Lange-Müller
Früher, ja, früher gehörten mindestens drei, vier Bücher einfach zum "guten Ton". Gerade "Gullivers Reisen" fehlte in kaum einer Schrankwand, nicht einmal in der meiner eher praktisch gebildeten Eltern. Womöglich hatte das schmuddlige, eselsohrige Exemplar unserer 1932 erschienenen "volkstümlichen Ausgabe" den Zweiten Weltkrieg besser überstand als der, dem es einst geschenkt worden war; mein Vater wollte es in einem Antiquariat erworben haben - und jemand, vermutlich auch ein Vater, hatte mit kaum verblasster Friedenstinte hineingeschrieben: "Für Jan Jablonski, zum vierzehnten Geburtstag". - Und besser als an den für den "jugendlichen Leser" gekürzten, in schlichtes, verflachendes Deutsch übersetzten Text, kann ich mich an die Illustrationen erinnern, besonders an das Bild des lang und breit daliegenden Gullivers, der es sich einfältig grinsend gefallen lässt, dass ihn hunderte von ameisenkleinen Gestalten wie eine Kohlroulade mit Bindfäden umwickeln.
Nun habe ich Swifts "Gulliver" wieder und erstmals "richtig" gelesen und frage mich, ob ich ein Werk, das zum Fundus der Weltliteratur gezählt wird, beschreiben und nach ähnlichen Kriterien beurteilen darf, wie ein so genanntes "zeitgenössisches" oder "modernes". - Ich hoffe, ich bin so frei.
Die Konstruktion (und um eine solche, durchaus im technischen Sinne des Wortes, handelt es sich) der ganzen, vierteiligen Geschichte ist entwaffnend simpel und zugleich rätselhaft viel-, aber nicht feinsinnig - im Gegenteil, sie wimmelt von derben Metaphern. Der 1667 in Dublin geborene irisch-englische Schriftsteller, Theologe und Politiker Jonathan Swift erfindet sich den Schiffsarzt Lemuel Gulliver, der ihn, wie der biblische Wahl den Jonas, durch die Weltmeere trägt und an fremde Ufer spuckt und ihn schließlich, wie das Trojanische Pferd die listigen Krieger, zu den echten und wahren Pferden bringt, den edlen Houyhnhnms. Diesen Gulliver "verkauft" uns der (nur scheinbar!) gänzlich in seiner Figur verschwundene Autor als sprachbegabten, auch stilistisch eleganten, sachlichen und gewissenhaften, doch - bei aller Bildung und Offenheit - zunächst noch recht naiven Berichterstattet, als chronisch fernwehkranken Abenteurer mit Hummeln im Hintern, der es bei seiner Frau, der "zweiten Tochter eines Newgatestreeter Strumpfwarenhändlers", und seinen zwischen den Reisen mal schnell gezeugten Kindern keine drei Tage aushält.
Die erste Reise bringt Gulliver nach Liliput, wo der "Menschberg" sein "zum Himmel stinkendes Geschäft" in einem Tempel verrichtet, seinen um so ziemlich alles verlegenen "Gastgebern wider Willen" die mikroskopisch kleinen Haare von den Köpfen frisst, aus Loyalität gegen Liliputs Kaiser die Nussschalenkriegsflotte der vom rechten Eierglauben abgefallenen und seither mit den Liliputanern verfeindenten Belfuscanern kidnappt, doch kurze Zeit später bei Hofe unten durch ist, weil er so hilfreich aber dreist war, einen Palastbrand einfach auszupissen. Glücklicherweise findet Gulliver, noch ehe die Däumlinge des einen oder des anderen Reiches den gewaltigen Nimmersatt und Misterzeuger im Schlaf mittels vergifteter Nadeln zu Tode pieken, ein gekentertes europäisches Beiboot, kann sich retten und seine liliputanischen Souvenirschäfchen auf einem "Spielrasen bei Greenwich" ins Trockene bringen, was sich, wie er hofft, "wegen der Feinheit der Vliese für die englische Wollfabrikation noch sehr vorteilhaft auswirken wird".
Bei der nächsten Reise fügt es sich so, dass Gulliver allein an einem fremden Strand zurückbleibt, dem von Brobdignag, dem Land der Riesen. Hier nun ist Gulliver seinen - an Liliput gemessen reziproken - und in jeder Hinsicht schrecklichen Wahrnehmungen und Empfindungen ausgesetzt, was dazu führt, dass er den Abscheu vieler Liliputaner vor dem Monstermenschen, als der er ihnen galt, auch empirisch begreifen lernt. Schon allein wegen ihrer zwangsläufig bedrohlichen Monumentalität kann Gulliver die Brobdignagier nur grob, also hässlich finden. Jede kratertiefe Hautpore, jeder Pickel ist eine optische Zumutung für den Winzling; die aasigen Winde, die den sprechenden Brobdignianermündern entströmen, den Donnerhall der Stimmen kann er kaum ertragen. Einige Brobdignagier halten Gulliver für so etwas wie ein mechanisches Miniaturwunder, andere für ein kurioses Tierchen und wieder andere, vorzüglich die Brobdignagierinnen kindlichen und geschlechtsreifen Alters, behandeln ihn wie ein Spielzeug, ein hübsches, weil niedliches Püppchen. Schwer makaber ist die (Fritz Fischer, dessen Illustrationen in dieser neuen Ausgabe reproduziert sind, gleich elf Zeichnungen werte) Beschreibung eines Besuchs bei den Ehrendamen des Hofes von Brobdignag, deren schönste viel Vergnügen daran findet, das putzige Kerlchen "rittlings auf eine ihrer Brustwarzen zu setzen" und mit ihm "noch manche andere Scherze zu machen, deren Übergehung der Leser hier entschuldigen wird." Grauenhafte Abenteuer besteht der Gulliver-Krümel auch im Umgang mit dem Zwerg der Königin, in Kämpfen gegen entengroße Wespen, Saurierfrösche und einen Gonzilla, der ihn auf das Dach des Palastes entführt. Und doch meint Gulliver im letzten Kapitel seines Berichts, als er sich an die Sanftmut der Riesen, an deren friedliebenden, ja geradezu pazifistischen König erinnert, dass "von den fernen Nationen, in denen "Yahoos" (Menschen) "die Regierung führen, die Brobdignagier die gewiss am wenigsten verdorbenen sind".
Im für meinen Geschmack seltsamsten und mir vielleicht gerade deshalb partiell langweiliger als die anderen dritten Teil des Buches reist Gulliver nach Laputa, Balnibari, Luggnagg und Japan. Auf der fliegenden Untertasse Laputa leben musikalische Mathematiker, die aber nicht rechnen können und, weil sie sich dauernd vermessen, schiefe Häuser bauen. In der großen Akademie zu Lagado, der Hauptstadt von Balnibarbi, trifft Gulliver auf die durchgeknalltesten Erfinder, "Projektemacher" und Künstler aller Zeiten. Einer versucht seit acht Jahren "aus Gurken Sonnenstrahlen zu ziehen", ein weiterer "will menschliche Exkremente wieder in die ursprüngliche Nahrung zurückverwandeln", noch ein anderer züchtet nackte Schafe, deren Wolle eines Tages so fein soll wird, dass keiner sie mehr sieht und fühlt. Die Politikwissenschaftler dieser absurden Akademie erforschen, welche Krankheiten einen Anwärter auf ein Ministeramt für den jeweiligen Posten besonders prädestinieren und wie der Staat "auf die bequemste und wirksamste Weise Steuern erheben könnte, ohne den Untertanen lästig zu fallen". Sie gelangen zu dem Schluss, dass man "gerade jene Eigenschaften des Körpers und der Seele besteuern müsse, auf die die Menschen besonders stolz sind: Gesundheit, Schönheit, Witz, Tapferkeit und Höflichkeit.
In Luggnagg begegnet Gulliver äußerst traurigen Kreaturen, den einst mit einem roten Fleck im Gesicht geborenen unsterblichen Struldbrugs. Diese Struldbrugs sind trotz ihres hohen Alters kein bisschen klug und weise, sondern völlig verblödet, krank und hinfällig; sie werden von den Leuten verachtet und gehasst, weil sie bis in alle Ewigkeit der Allgemeinheit auf der Tasche liegen, die schlecht genug für sie sorgt. Und der König von Luggnagg hat die Güte, Gulliver ein wenig zu necken: "Er wünschte, ich könne ein paar Struldbrugs in mein Vaterland schicken, um unser Volk ein für allemal gegen die Todesfurcht zu wappnen."
Dann endlich, am zufälligen Ziel seiner vierten und letzten Reise, trifft Gulliver auf die grundgütigen, gräziösen Pferde, die Houyhnhnms, die Meister aller Lebewesen. Doch leider hausen bei denen auch die stinkenden, launischen, in jeder ihrer Lebensäußerungen grottenhässlichen, hinterlistigen, bösartigen und dennoch feigen "Yahoos", wie Menschen in der Houyhnhnmsprache heißen. Nun sind diese ziegenbärtigen Zottelyahoos längst nicht so lernbegierig, bekehrungsbeflissen und demütig wie der brave, von sämtlichen seiner Artgenossen rundum tief enttäuschte Gulliver. Nein, aus gänzlich unerörterten Gründen sind sie total degeneriert, jedenfalls dämlicher als all die europäischen Soldaten, Ärzte und Politiker, die Gulliver so verachtet, unkultivierter als jedwedes Yahoovolk, dem er je begegnete.
Und endlich wird eines der Yahooweibchen, ein nicht einmal ganz so hässliches, dem vierhundert Seiten lang bedenklich keuschen Gulliver zum Verhängnis; es erblickt den Badenden und "von Begierde entflammt, kommt es sogleich mit aller Eile herbeigelaufen", springt ins Wasser, umarmt den tief erschrockenen Gulliver "in der ekelhaftesten Weise". Aus diesem Vorfall schlussfolgern die klugen Hoyhnhnms, dass Gulliver, obwohl er von hellerer Farbe ist und reden kann, "ein wirklicher Yahoo sei, da doch die Weibchen eine natürlichere Neigung zu ihm hegen als zu einem Geschöpf ihrer eigenen Art." Sie beschließen, dass Gulliver zu behandeln sei wie alle übrigen Yahoos oder aber ihr Land zu verlassen habe. Da muss sich Gulliver, der bis ans Ende seiner Tage bei den Hoyhnhnms bleiben wollte, ein Schiff bauen und heimfahren nach England zu Weib und Kindern, die ihm aber derart widerwärtig geworden sind, dass er mit ihnen nicht einmal mehr an einem Tisch sitzen mag. Das erste Geld, das Gulliver als Rentner ausgibt, "verwendet" er "auf den Ankauf zweier junger Hengste", die er sich "in einem guten Stalle" hält; "nächst ihnen ist der Stallknecht" sein "bester Freund".
Sicher ist "Gullivers Reisen" ein großartiges Buch - unterhaltsam und voler Spannung, auch heute noch, da wir alle Reisende sind; es birgt scharfsinnige Gesellschaftsbeobachtungen und Psychogramme, entlarvt den korrupten, geld- und machtgeilen, selbstsüchtigen, bequemen Zivilisationsmenschen, den wir kennen und hassen, auch und vielleicht besonders in uns selbst. Swift, hinter der Maske seines misanthropischen Gullivers, verspottet das eitle, reaktionäre Prinzip Monarchie, entlarvt Mediziner, Gelehrte, Generäle als egozentrische Bauernfänger, fällt vernichtende Urteile über Staatsmänner, Professoren, Bürokraten, ächtet den Krieg.
Aber warum machte sich Swift die Mühe des Schreibens, wenn "der Mensch an sich" nichts weiter war, ist und wird als ein dreckiger Yahooarsch im Defektzustand und am Ende, am ebenso banalen wie grausamen Ende seiner - womöglich schon längst wieder rückläufigen - Evolution? Wenn es, was ich nicht bezweifle, tatsächlich stimmt, dass eine ordentliche Satire beißend sein, also verletzen muss, dann ist "Gullivers Reisen" ein Hoyhnhnm unter den Satiren; denn es kränkt mich, weil ich rothaarig, weiblich und ein Yahoo bin, manchmal schon, dass gerade die rothaarigen "Yahoos" die schlimmsten von allen sein sollen, übertroffen an übler Nichtsnutzigkeit, Niedertracht und Debilität nur noch von den Yahoofrauen sämtlicher Gulliver bekannten Populationen. Und warum drückt dieser "Gulliver Swift" ausgerechnet dem Pferd, einem nach landläufiger Meinung nicht gerade intelligenten Verwandten des Esels, "die Krone der Genesis" zwischen die nervösen Ohren? Wenn auch das, wie ich langsam zu begreifen glaube, ein Witz sein soll, wird mir das Lachen noch schwerer - und nichts bleibt mir übrig als mit letzter Kraft "auf andere Art so wenig Hoffnung" zu schöpfen aus einem Satz, den ich vor Jahren nachts in einer Theaterkantine von einem Schauspieler gehört habe: "Seit ich die Tiere kenne, liebe ich die Pflanzen."
Jonathan Swift: "Gullivers Reisen". Hrsg. von Bernhard Fabian. Aus dem Englischen übersetzt von Franz Kottenkamp. Überarbeitet von Heinrich Fauteck. Mit Zeichnungen von Fritz Fischer. C. H. Beck Verlag, München 1999. 409 S., geb., 49,50 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main