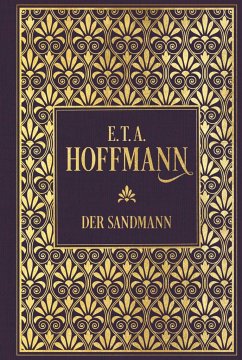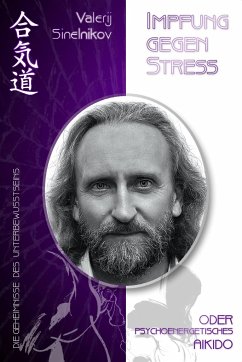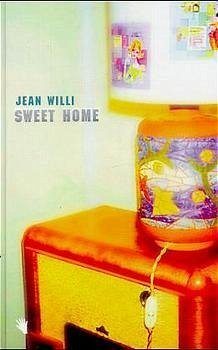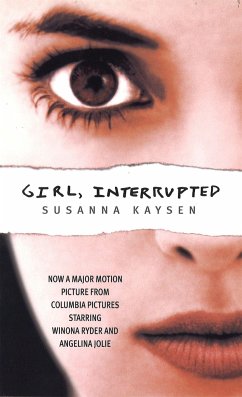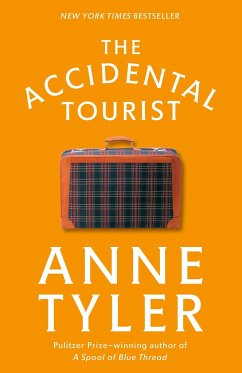Gute Genossen
Erzählung, naturtrüb
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
14,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
7 °P sammeln!
In einem Brief, einem Gespräch und 19 Kapiteln schildert Erich Loest die Gesichte einer Familie wie unzählige in der DDR, der Vater, Hauptmann bei den Grenztruppen in Thüringen, die Mutter im sozialistischen Handel, der siebzehnjährige Sohn Bobsportler in Obershof. Am Ende ist jeder der drei abgestürzt oder aufgestiegen, doch keiner lernt aus allen Querelen; sie bleiben gute Genossen in diesem für sie heftigen Monaten des Jahres 1978. Elf Jahre später dürften sie aus allen Wolken fallen.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.