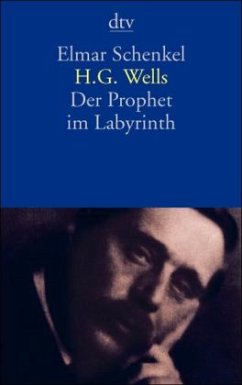Man kennt ihn als Autor der "Zeitmaschine", als Erfinder phantastischer Geschichten über Außerirdische, Unsichtbare und Mischwesen zwischen Tier und Mensch: Doch damit ist nur eine Seite von Herbert George Wells benannt. Elmar Schenkels essayistischer Rundgang beweist: Dieser Autor hat auf vielfältige Weise das vergangene Jahrhundert beeinflußt, indem er Ideen bereitgestellt und prophetisch in die Zukunft gedacht hat.

Elmar Schenkel erkundet H. G. Wells / Von Alban N. Herbst
H. G. Wells ist soeben 125 Jahre alt geworden. Doch kaum deshalb, sondern möglicherweise aus prinzipiellen, literarästhetischen Erwägungen hat Elmar Schenkel über diesen einen Vater der Science-fiction ein in seiner Eleganz sehr englisches Buch vorgelegt. Er nennt es "Eine essayistische Erkundung". "Biographische Essays" hätte vielleicht besser gepaßt, wäre der Text nicht über lange Strecken mit kurzweiligen interpretativen Spekulationen beschäftigt. Elmar Schenkel, als Apologet John Cowper Powys' bekannt, scheut sich dabei durchaus nicht vor pathetischer Verbindlichkeit: "Die alten Geschichten von Zeitreisenden ... liegen da wie schwere Steine, Grabsteine möglicherweise, auf die das Symbol Science-fiction gemeißelt ist, auf daß niemand die Ruhe dieser Geschichten störe ... Aber hebt einmal die Steinplatte hoch, dreht sie um, und ihr seht andere Inschriften, andere Welten, andere Aussichtspunkte", beschwört er seinen Leser. Es ist mehr als sympathisch, daß dieser Autor in seinen lose miteinander verzahnten Aufsätzen Partei für das Genre nimmt - Partei gegen die Arroganz eines Literaturbetriebs, der seit Jahren auf Science-fiction nur mit Naserümpfen reagiert und über seiner akademistischen Hoffart ganz die eigentlich wirkmächtigen Vektoren des gerade zu Ende gegangenen wie des jetzigen Jahrhunderts vergißt: die Naturwissenschaften.
Nicht aber darum geht es Schenkel, einer technologisch orientierten Unterhaltungsliteratur affirmativ das Wort zu reden, sondern seine Aufsätze machen im Gegenteil deutlich, daß bereits die Gothic Novels "große romantisch-viktorianische Vorspiegelungen eines psychischen Territoriums" gewesen sind, "das in der Folge das Unbewußte genannt werden sollte". Entsprechend fallen im zwanzigsten Jahrhundert Technik und Magie zusammen. "Die Zeitmaschine ist nichts anderes als das dynamisch gewordene Ich, das es nicht zu verlieren gilt." Mit Musil gesprochen, habe Literatur einen Möglichkeitssinn entfaltet, der sich nun auf Geschichte und Zeitverläufe erstrecke: "Geschichte spaltet sich auf und entwickelt sich verschieden in parallelen Universen." In einer Zeit, in welcher, etwa über das Internet, die Wirklichkeit ständig solche neuen Cyberräume abwirft, bedarf es, die sowohl historisch notwendige wie angemessene Funktion dieser Literatur zu unterstreichen, im Grunde keines Verteidigers, auch nicht des bei Schenkel ein wenig zu häufig als Sekundanten zitierten Wells-Apologeten Jorge Luis Borges. Denn die sogenannte Science-fiction hat ja längst ihrerseits Einfluß auf Denkvorstellungen in der Wissenschaft genommen. Jedenfalls außerhalb Deutschlands. Hierzulande ist man davon weit entfernt. Zwar wird auch bei uns durchaus mit Recht bezweifelt, daß die medial vermittelten Bilder von Wirklichkeit, die unser politisches Denken tagtäglich bestimmen, wahre Bilder sind. Doch der Gedanke, sie erzeugten auch dann, wären sie es nicht, neue Realitäten, liegt zumindest Literaturwissenschaftlern und Kritikern fern. Dabei ist Schenkels Feststellung durchaus zutreffend, daß "Zeitbahnhöfe, Zeitkammern, Zeitschleifen . . . geradezu zum Kennzeichen der Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts geworden" seien - nur eben nicht der deutschsprachigen, jedenfalls nicht derjenigen, die nach 1930 geschrieben wurde: Die akzentuiert bis heute - verständlicherweise, doch letztlich ideologisch ignorant - nahezu ausschließlich politisch-soziale Wirkfaktoren, soweit nicht sogar ein überkommenes, sagen wir: "lyrisches" Ich die Romanform bestimmt. "Erst im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und der virtual reality geht uns ein Licht darüber auf, was es bedeutet, wenn das Gehirn andere Realitäten vermittelt als die uns umgebende materielle Welt."
Noch einiges mehr wird in Schenkels Erkundungen deutlich, etwa die Genese der Science-fiction aus den Umständen des scheidenden neunzehnten Jahrhunderts, worin sich der Siegeszug der Physik mit einer ganz selben Neigung zum Unsichtbaren in den Humanwissenschaften parallelisiert, die schließlich in Freuds Postulat des Unbewußten ihren Zwischengipfel erreichte. Außen- und Innenwelten wachsen zusammen, spiegeln einander. Ganz entsprechend verschwimmen feste Bestimmungen, seien es die der Persönlichkeit und Persönlichkeitsgrenzen, seien es schließlich die von Völkern und Nationen - von, kurz, Identitäten. Das stellt Schenkel in jenem zugleich populären wie kenntnisreich kunstvollen Stil dar, für den besonders der englischsprachige Wissenschaftsjournalismus berühmt ist. Schenkel verschweigt nicht, daß die formalen Konsequenzen der sich seinerzeit abzeichnenden neuen Welt ganz sicher nicht in dessen Werk, sondern eher etwa bei Virginia Woolf zu finden sind. Dennoch sind sie, thematisch, ständig zugegen, handelt es sich nun um die Verräumlichung der Zeit, um die Auflösung des starren Materiebegriffs oder um das ästhetische Ideal der Androgynität, die den Symbolismus gekennzeichnet hat und in allerjüngster Zeit im Cyborg eben zu jener praktischen Modernität gelangt, die seinerzeit noch fremd, unheimlich und exaltiert wirken mußte.
Das hybride Element schlägt sich nun auch in den essayistischen Erkundungen selbst nieder, besonders in ihrer Anordnung: Nicht nur, daß sie mit H. G. Wells' Selbstnachruf von 1943 endet und sich mit zweien seiner Originaltexte mischt, deren einer humoristisch klarstellt, was die englische Dichtung so unangefochten auf den Gipfel der Weltliteratur gebracht hat, nämlich weil sich die Dichter ihre Mägen mit schlechtem Essen verdarben. Sondern auch Schenkels Quellenverweise sind nicht immer "rein", vielmehr auch ihrerseits aus Fiktionen gespeist. Besonders schön die Bemerkung, wie Wells sei Sherlock Holmes ein großer Radfahrer gewesen, wozu die abgeworfene Fußnote spröde bemerkt, daß sich diese Tatsache leider nicht nachweisen lasse, und eigens dafür auf das 31. Baker Street Journal verweist. Nun verlieren aus historischem Abstand erfundene und reale Personen ohnedies ihre Trennschärfe - ein Vorgang, dessen Konsequenzen selten genug begriffen werden: Dabei ist zweifelsfrei Bonaparte für uns Heutige ganz unbedingt ein Erzeugnis der Literatur. Die aus einer solchen Beobachtung zu gewinnenden Schlüsse seien einem jeden selbst überlassen, auch Elmar Schenkel drängt sie niemandem auf. Dennoch: Gerade weil sich all dies so unangestrengt und überaus schnell, so geradezu tänzerisch liest, kann man mitunter nicht anders, als plötzlich und trocken in der Lektüre aufzulachen: der vielleicht am wenigsten mittelbare Garant von Erkenntnis.
Elmar Schenkel: "H. G. Wells. Der Prophet im Labyrinth". Eine essayistische Erkundung. Zsolnay Verlag, München und Wien 2001. 344 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Weit entfernt von der Steifheit der meisten literaturwissenschaftlichen Monographien, breitet Schenkel die Fülle der Informationen über Leben und Werk quicklebendig, elegant und genüßlich aus, essayistisch, locker, kurzweilig, oft amüsant." Gisbert Kranz in 'Die Tagespost'
"Gerade weil sich all dies so unangestrengt und überaus schnell, so geradezu tänzerisch liest, kann man mitunter nicht anders, als plötzlich und trocken in der Lektüre aufzulachen: der vielleicht am wenigsten mittelbare Garant für Erkenntnis." Alban N. Herbst in 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'
"Gerade weil sich all dies so unangestrengt und überaus schnell, so geradezu tänzerisch liest, kann man mitunter nicht anders, als plötzlich und trocken in der Lektüre aufzulachen: der vielleicht am wenigsten mittelbare Garant für Erkenntnis." Alban N. Herbst in 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'