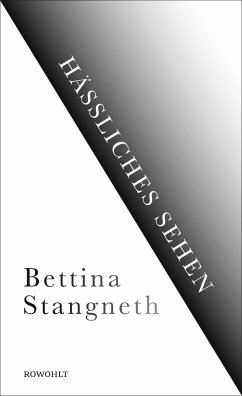Ob Lehrer oder Demagogen, Revolutionäre oder Terroristen, Kulturkämpfer oder ganz normale Selfie-Versender - sie alle eint die Hoffnung auf die Kraft der Bilder. Niemand muss nachdenken, wenn er es nicht will. Nur weil jeder Vernunft hat, steht es uns doch frei, ihr nicht zu folgen. Wer wirken will, setzt darum lieber auf die Sinne. Wer etwas ändern will, muss Zeichen setzen.
Das Vertrauen in die Bildgewalt ist das Vertrauen auf die Unschuld des Sehens. Ein Bild soll leisten, was Gedanken nicht schaffen: die unmittelbare Erkenntnis. Bilderwelten können zusammenfügen, was kein Denken stiften kann: die Identität einer Gemeinschaft, das Wir. Denn hatte jemals eine Idee dieselbe Wirkung auf die Menschen wie Ideale? Konnte Vernunft je etwas ausrichten gegen Tradition und Kultur?
Die Philosophin Bettina Stangneth, die hiermit den letzten Band ihrer Trilogie über das dialogische Denken vorlegt, fordert erneut dazu auf, liebgewordene Vorstellungen zu überprüfen. «Hässliches Sehen» ist ein Essay zur Frage, was eigentlich Sehen heißt.
Das Vertrauen in die Bildgewalt ist das Vertrauen auf die Unschuld des Sehens. Ein Bild soll leisten, was Gedanken nicht schaffen: die unmittelbare Erkenntnis. Bilderwelten können zusammenfügen, was kein Denken stiften kann: die Identität einer Gemeinschaft, das Wir. Denn hatte jemals eine Idee dieselbe Wirkung auf die Menschen wie Ideale? Konnte Vernunft je etwas ausrichten gegen Tradition und Kultur?
Die Philosophin Bettina Stangneth, die hiermit den letzten Band ihrer Trilogie über das dialogische Denken vorlegt, fordert erneut dazu auf, liebgewordene Vorstellungen zu überprüfen. «Hässliches Sehen» ist ein Essay zur Frage, was eigentlich Sehen heißt.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Es ist für den Leser der Kritik nicht ganz leicht zu verstehen, was hier mit "hässlichem Sehen" eigentlich gemeint ist. Dies sei der dritte Teil einer Trilogie, in der die Philosophin in essayistischer Weise eine "radikal aufklärerische Haltung" verfechte, erläutert der rezensierende Kollege Daniel-Pascal Zorn. Die Philosophin scheint ganz allgemein darüber nachzudenken, wie Bilder in bestimmten Denk- oder Argumentationszusammenhängen eingesetzt werden. Zorn lobt dabei die lockere, unprätenziöse Weise, in der sie das tut. Es gibt etwa Erwägungen über Vernunft, die ein nicht immer glamouröses Programm sei und doch irgendwie unvermeidlich. Immanuel Kant habe jedenfalls nach wie vor große Aktualität. Stangneth betreibe "eine Art Ethnologie der eigenen Kultur", so Zorn weiter und dies tue sie zum Glück mit sehr viel Witz.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
So ist "Hässliches Sehen" im besten Sinne ein philosophischer Essay, in dem am Leitfaden einer übergeordneten Frage das Grundsätzliche zur Sprache kommt. Dabei gelingt es in jedem Kapitel, dieses Grundsätzliche mit anschaulichen Beispielen und einer gehörigen Portion Witz aus immer neuen Perspektiven zur Sprache zu bringen. Daniel-Pascal Zorn Süddeutsche Zeitung 20190411