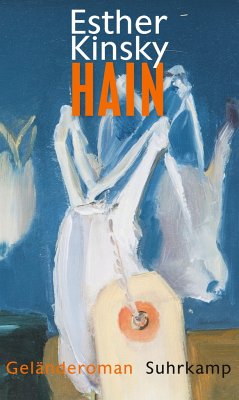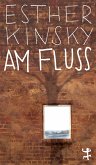Drei Reisen unternimmt die Ich-Erzählerin in Esther Kinskys Geländeroman. Alle drei führen sie nach Italien, doch nicht an die bekannten, im Kunstführer verzeichneten Orte, nicht nach Rom, Florenz oder Siena, sondern in abseitige Landstriche und Gegenden - nach Olevano Romano etwa, einer Kleinstadt in den Hügeln nordöstlich der italienischen Hauptstadt gelegen, oder in die Valli di Comacchio, die Lagunenlandschaft im Delta des Po, halb von Vögeln beherrschte Wasserwelt, halb dem Wasser abgetrotztes Ackerland. Zwischen diesen beiden Geländeerkundungen im Gebirge und in der Ebene führt die dritte Reise die Erzählerin zurück in die Kindheit: Wie bruchstückhafte Filmsequenzen tauchen die Erinnerungen an zahlreiche Fahrten durch das Italien der Siebzigerjahre auf, dominiert von der Figur des Vaters.
Esther Kinskys Streifzüge und Wanderungen - im Gedächtnis ebenso wie gehend oder fahrend in der Gegenwart - sind Italienische Reisen eigener Art. Sie erkunden mit allen Sinnen äußeres Terrain und führen doch ins Innere, zu Abbrüchen der Trauer und des Schmerzes und zu Inseln des Trostes. Der einfühlsame, präzise Blick der Reisenden entlockt jedem Gelände, was eigentlich im Verborgenen liegt: Geheimnis und Schönheit.
Esther Kinskys Streifzüge und Wanderungen - im Gedächtnis ebenso wie gehend oder fahrend in der Gegenwart - sind Italienische Reisen eigener Art. Sie erkunden mit allen Sinnen äußeres Terrain und führen doch ins Innere, zu Abbrüchen der Trauer und des Schmerzes und zu Inseln des Trostes. Der einfühlsame, präzise Blick der Reisenden entlockt jedem Gelände, was eigentlich im Verborgenen liegt: Geheimnis und Schönheit.

Gewinn oder Verlust, das ist manchmal nur eine Frage der Betonung: Esther Kinsky fährt nach Italien und erkundet in ihrem Geländeroman "Hain" den Ort, wo sich die Toten und die Lebenden begegnen.
Die Reise, die von der hinterbliebenen Lebensgefährtin eines Mannes namens "M." unternommen wird, beginnt im Zeichen des Verlusts: "Es war Januar, als ich in Olevano ankam, zwei Monate nach M.s Beerdigung", notiert sie: "Die Reise war lang, führte durch schmuddelige Winterlandschaften, die sich unentschlossen an graue Schneereste klammerten", und die Schilderung der Route, so scheint es, rechtfertigt die Kapitelüberschrift "Weg". Allerdings kann man den Vokal lang oder kurz aussprechen und damit die Strecke oder den Verlust meinen, muss sich aber nur dann zwischen diesen beiden Lesarten entscheiden, wenn man das Wort ausspricht. Belässt man es beim stummen Lesen, kommt man Esther Kinskys Buch, für das sie die einleuchtende Gattungsbezeichnung "Geländeroman" gewählt hat, sicherlich näher. Denn es ist diese Ambivalenz, dieses unangestrengt Durchscheinende, diese schimmernde Bedeutungsvielfalt all dessen, was die Erzählerin von zwei aktuellen Italienreisen und der Erinnerung an viele frühere, mit dem längst verstorbenen Vater unternommene, notiert und bewahrt, das dem Buch seinen außergewöhnlichen Zauber verleiht.
Der Verlust des Anfangs setzt sich auch während der Reise fort: Unterwegs wird das Auto der Erzählerin aufgebrochen und der mitgeführte Koffer gestohlen, in dem sich die Kleidung des Verstorbenen befand - die Trauernde hatte vorgehabt, in der Wohnung im italienischen Olevano Romano nachts M.s Hemden zu tragen. Dieser Plan ist schon eines der deutlichsten Anzeichen, wie es um die Erzählerin steht, die sonst sehr viel mehr über die Landschaft, die sie bereist, preisgibt, als über sich selbst. Man stellt sie sich vor wie eine Erstarrte, die gemessenen Schritts durch das Städtchen in den Bergen nordöstlich von Rom läuft, die sich ins Auto setzt und Ausflüge macht und immer wieder den Friedhof besucht, die bei den Behörden vorstellig wird, um etwas über ein bestimmtes Grab zu erfahren oder stundenlang den Olivenbaumschneidern bei ihrer Arbeit zusieht.
Über sich selbst sprechen muss sie aber auch gar nicht, solange sie in dieser besonderen Weise von dem erzählt, was sie sieht, vor allem in den kunstvoll beiläufigen Sätzen, die jeweils die kurzen Kapitel einleiten: "Die Tage wurden länger, aber kaum wärmer und heller" ist so ein Satz, den man mühelos auf das Innen wie das Außen beziehen wird, und der Verlust, der alles grundiert und nur selten benannt wird, tritt hier wie in vielen anderen Beschreibungen so deutlich hervor, dass er den Leser zuverlässig erreicht.
Es ist eine intensiv erfahrene, leise Trauer, die von der auch sich selbst gegenüber scharfsichtigen Erzählerin in Sprache gebannt wird, samt aller Versuche, damit umzugehen. Als sie etwa erfährt, dass ganz in der Nähe der Ort Palestrina liegt, aus dem der Kirchenmusiker stammt, fährt sie dorthin: "Vor vielen Jahren hatte ich in einer Palestrinamesse gesungen und dabei gemerkt, wie ich in der Musik trauerlos der Welt abhandenkam, unsichtbar wurde und nichts mehr sah." Sie erzählt ein Märchen nach, von einem schneeweißen Vogel, der sich in der Not in einen Kaminschlund begibt und nun, als schwarze Amsel, aller Verwandlung und Versehrung zum Trotz weiterlebt. Und sie probiert aus, welche Folgen das Alltägliche auf ihren Zustand haben kann, wenn sie es im Bewusstsein des Verlusts durchführt. So kauft sie, weil M. immer eine solche Freude daran hatte, dem Obsthändler ein paar Orangen ab - einen "Trauerkauf" nennt sie das, ein "Versuchsritual", und was in einem anderen Zusammenhang unzugänglich oder auch banal sein könnte, erhält in diesem Buch, das in jeder Zeile vom Verhältnis zwischen Tod und Leben spricht, eine besondere Dimension: Geht es darum, in den Orangen M.s Bild heraufzubeschwören, ihn gar auf kurze Zeit zurückzuholen? Oder geht es umgekehrt darum, seinen Geist, die Erinnerung an ihn mit einer Art Opfer zu befrieden?
Tatsächlich ist die Erinnerung an M. etwas, das offensichtlich keiner Kontrolle unterliegt - manchmal meldet er sich im Traum, wo er mit verstörender Deutlichkeit in rasender Schnelle aus dem Bereich der Lebenden in den der Toten wechselt. Und er erscheint ganz am Ende des Buchs, als die Erzählerin bei der Abreise nun aus dem Po-Delta ihre Sachen packt, darunter auch die Kameratasche. Dort ertastet sie "in einem nie genutzten Seitenfach einen eckigen Umriss." Der gehört zu einem Negativstreifen, der, gegen das Licht gehalten, auf einmal den "sofort erkannten" M. zeigt. Der blinzelt gegen das Licht, heißt es, und es ist in der Kunst der Autorin begründet, dass man dieses Blinzeln zugleich beiden Situationen geschuldet weiß, einmal der, in der das Bild aufgenommen wurde, zweitens aber der, in der das Negativ wieder gefunden und aus der Dunkelheit der Kameratasche ins italienische Winterlicht gehalten wird.
Es ist ein dem Leben zugewandtes Buch, das doch permanent die Grenzen des Totenreichs und auch des Totengedenkens auslotet, und die kursive Einleitung dieses Geländeromans schlägt den Ton an, der durch das übrige Buch hallt, wenn sie den Raum zwischen Leben und Tod als etwas eigenes beschreibt, etwas, das in keinem der beiden Zustände ganz aufgeht. Es setzt sich fort in vielen Bildern, die diese Grauzone aufs Schönste mit den Mitteln einer Sprache beschreiben, die mühelos den Rhein mit dem Styx überblenden und das deutsche Fährpersonal mit Charon. Und wenn es einmal heißt "Bis hierher gehe dein Totenreich", dann wird man diesen Ausspruch zugleich rührend finden und mutig, keineswegs aber wird man auf seine Wirksamkeit vertrauen.
Einmal, nach Wochen in den Bergen, sitzt die Erzählerin im Gras und blickt über die Landschaft. Jetzt stellt sie eine Verbindung her zwischen den Zielen ihrer bisherigen Ausflüge, und zugleich klingt das, was topographische Beschreibung sein sollte, wie das Sprechen über die eigene Situation, den eigenen Lebensweg nach M.s Tod. Das setzt sich im Traum fort, wo sie für sich selbst die Frage nach der Zugehörigkeit zu den Lebendigen oder den Toten beantworten muss, und ob sie weiterhin unter den Lebenden als Gespenst herumziehen will.
Als sie die Gegend verlässt, notiert sie, wie plötzlich "wie im Märchen" das Bleiherz zerspringt. Auch dies eine zweischneidige Formulierung. Als ob es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, wovon dieser reiche, traurige, kostbare Roman lebt.
TILMAN SPRECKELSEN
Esther Kinsky: "Hain".
Geländeroman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 287 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Eine abgespecktere Literatur als Esther Kinskys Roman "Hain" ist kaum vorstellbar - ein Buch wie dieses zu lesen, wahrscheinlich auch es zu schreiben, ist die absolute "ästhetische Askese", so der Rezensent Ijoma Mangold - schwierig, manchmal anstrengend und bestimmt nichts für jeden. Das wäre zu glauben, allerdings lässt der Chor der Lobeshymnen in den Feuilletons anderes vermuten: Esther Kinskys literarisches Programm scheint in all seiner Magerkeit zu überzeugen. Der asketische Charakter dieser Literatur scheint ihr eine besondere zähe Kraft zu verleihen, eine Kraft, die auch die Erzählerin in diesem Roman braucht, denn ihr ist vor kurzem ein geliebter Mensch abhanden gekommen. Diesen Verlust zu verarbeiten, reist sie nach Italien, wo sie während der Wintermonate viel spaziert, ihre Umwelt jedoch stets und auch erzählerisch auf Distanz hält. Mangold nennt den Roman ein "Trauerbuch" und ist besonders von der kalten Schärfe und Genauigkeit angetan. Dazu verwende die Autorin eine beeindruckende Palette von Grautönen, die in ihrer Vielfalt wohl kaum zu übertreffen sei. In diesem ernsten Grau-in-Grau, in der gestochenen Schärfe und literarischen Selbstkasteiung liegt allerdings eine ganz eigene Form von Pathetik - fast schon ein bisschen "prätentiös", so der zwinkernde Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Auch wer schreibt, bewegt sich auf undefiniertem Gelände ... Esther Kinsky ist bisher vor allem als Lyrikerin und Übersetzerin hervorgetreten. Und vielleicht sind diese Nuancen der äusseren und inneren Landschaften nur einer Übersetzerin möglich, jemandem, der am Gewicht der Worte trägt und jeden Satz auf die Goldwaage legt, bis er so leicht wie eine Vogelfeder geworden ist.« Andrea Köhler Neue Zürcher Zeitung 20180608