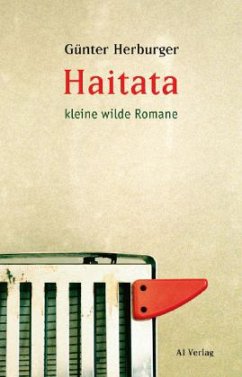Herburgers kleine wilde Romane führen ins Reich der Möglichkeiten, in hochkonzentrierter Form auf engstem Raum weit angelegt, und liefern ein umfassendes Material, mit dem die ganze Welt erzählt werden kann. Sie vereinigen in sich Augenschärfe, Geruchs- und Geschmackssinn großer Romane, kolportiert durch Heiterkeit, die nur mit unordentlichen Einfällen , wie er es selbst nennt, zu erreichen sind. Die im Autor geisternden Phantasien strudeln wie Sturzbäche von den Gefühlsgebirgen und tragen jeden Irrsinn in sich.
Durch die Konsistenz des Inhalts und das Geschick der Sprache schafft er mit dem Reichtum seiner Einfälle, mit Witz und Radikalität notwendige Neben- und Gegenwelten, die dem Leser erlauben, seine eigenen Romane entstehen zu lassen.
Durch die Konsistenz des Inhalts und das Geschick der Sprache schafft er mit dem Reichtum seiner Einfälle, mit Witz und Radikalität notwendige Neben- und Gegenwelten, die dem Leser erlauben, seine eigenen Romane entstehen zu lassen.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit Vergnügen hat Rezensent Jochen Schimmang diese unter dem Titel "Haitata" erschienenen, ein bis vier Seiten langen "kleinen wilden Romane" von Günter Herburger gelesen. Der Autor, der statt dicker Romane nun kurze Prosatexte bevorzugt, erscheint dem Kritiker aber keineswegs erschöpft, sondern gleichermaßen humorvoll und "treffend sarkastisch", wenn er etwa schreibt, dass zwei Frauen beim Spülen kein Spülmittel verwenden - "aus Sorge vor der Welt Ende". Nicht immer erschließen sich die rätselhaften, zuweilen fantastischen und anarchischen Texte dem Rezensenten sofort, ab und an lasse er etwa das Subjekt ganz verschwinden. Zugleich lassen die Erzählungen immer auch Trauer durchscheinen, meint der Kritiker, der darauf hinweist, dass "Haitata" kein lautmalerischer Jubelschrei, sondern das finnische Wort für "behindern" sei.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Utopist sein: Neue Prosa von Günter Herburger
Widerspenstigkeit ist von Anfang an eines der Merkmale des Schreibens von Günter Herburger gewesen. Auch als er noch dicke Romane schrieb, die Thuja-Trilogie nämlich, an der er fast zwei Jahrzehnte gearbeitet hat, war dieser Autor nie ein braver Abschilderer gesellschaftlicher Verhältnisse, obwohl seine Romane an ihnen so nahe dran waren wie sonst in jenen Jahren vielleicht nur Genazinos Abschaffel-Trilogie. Immer brach er aus dem Erzählfluss aus und tummelte sich auf dem Feld der Abschweifungen, bevor er einen fast schon vergessenen Faden wiederaufnahm. Mit dem Abschildern war es schon allein deshalb nicht getan, weil Herburgers Romane aus dem Geist der Utopie geschrieben waren.
Seit einigen Jahren beschränkt Herburger sich auf kurze Formen, auf Gedichte und auf Prosatexte zwischen ein und vier Seiten Länge wie in den vorliegenden "kleinen wilden Romanen". Doch man sollte dies nicht dem Alter und der Erschöpfung zuschreiben. Wenn hier etwas erschöpft ist, dann nicht der Autor, sondern die Utopie. Folgerichtig endet der Text "Das Böse" mit den Sätzen: "Bloch schrieb, wo Heimat sei, würden wir nie sein, wünschten es aber. Dort wartet schon lang das Böse und reibt sich die Fingerchen."
Das ist einer dieser typischen, ebenso verschmitzten wie erratischen Herburger-Schlüsse. Er zeigt, wie souverän der Autor gleichsam mit den Mythen und Materialien der Utopie umgeht, denn natürlich hat Bloch nie geschrieben, was Herburger zitiert, sondern hoffte eben, dass eines Tages Heimat wirklich existieren könne, von uns selbst erschaffen. Herburger aber macht mit dem Material, das er vorfindet, was er will. Diese Texte sind oft Vexierbilder und Kippfiguren, bei denen ohne weiteres das Subjekt wechseln, ja verschwinden kann, um am Ende wiederaufzutauchen. Ein hübsches Beispiel ist die Geschichte von dem Mann, der im Grunewald "an seinen langen weißen Haaren in einem Baum" hängt und den erstaunten Zuschauern zuruft, er sei nicht Jesus. Nach einer halben Seite übernehmen Wildschweine die Protagonistenrolle in diesem Text, und eines Morgens hängt nur noch das abgeschnittene Haar des Mannes im Baum, während er selbst unerkannt unter den Zuschauern steht. Zum Ende aber sehen wir diese Wildschweine, wie sie, "ihre Frischlinge in die Mitte nehmend, hinter dem Mann, dessen gekürzte Haare nicht mehr gebräunt sind, über das Wasser marschieren" und am anderen Ufer im Dunst von Hohengatow verschwinden. Versteht sich, dass der Kalauer "Jesus kam nur bis Hohengatow" sich eigentlich verbietet, dass man ihn sich aber doch nicht verkneifen kann.
Einen solchen kleinen Roman wie den eben zitierten kann man durchaus episch abgeschlossen und rund nennen. Andere dagegen sperren und verweigern sich konsequent. Sie ähneln Günter Eichs Maulwürfen und haben den gleichen anarchischen Gestus. Man kann sie zuweilen auch als Phantastik lesen, die allerdings bei Herburger immer in sehr konkreten Verhältnissen fundiert ist, in diesem Falle überwiegend in Berliner Verhältnissen. "Man kann sich im Grunde weniger Phantasie erlauben, wenn man sich nicht auskennt in der Realität", hat der Autor in einem Rundfunkgespräch gesagt. Er kennt sich aus, mit Kindern und Tieren zumal, mit dem Prekariat, mit dem "Blumenladen Ecke Paretzer Straße" und mit "Reisegruppen aus dem einstigen Westdeutschland".
Keine Frage, dass diese Geschichten voller Witz und zuweilen auch voll trefflicher Sarkasmen sind, etwa wenn jemand erzählt, "Johannes der Täufer habe, als er schon geköpft worden sei, Armbewegungen hinterlassen, der Angeber", oder wenn zwei Frauen beim Spülen kein Spülmittel verwenden "aus Sorge vor der Welt Ende". Der Titel des Bandes, "Haitata", ist jedoch kein Jubelschrei und keine kindliche Lautmalerei, sondern, wie der Autor uns versichert, das finnische Wort für "behindern". Bei aller Phantasie und fröhlichen Anarchie nämlich, die aus diesen Texten sprechen, ist ihr Grundzug ein anderer, wie schon bei dem vorausgegangenen Gedichtband "Ein Loch in der Landschaft". Herburger schreibt noch immer aus dem Geist der Utopie, aber einer Utopie, die sich, adornitisch gesprochen, am Leben erhält, "weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward". Die Trauer darum ist der Subtext dieses Buches, der bei allem Witz nicht zu überhören ist.
JOCHEN SCHIMMANG
Günter Herburger: "Haitata". Kleine wilde Romane.
A1 Verlag, München 2012. 112 S., geb., 18,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main