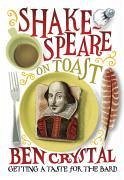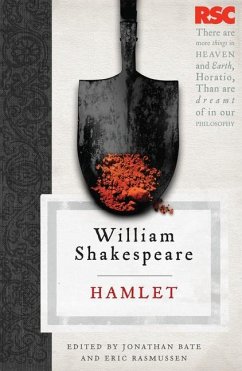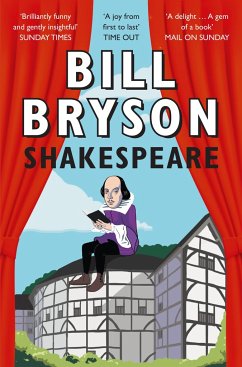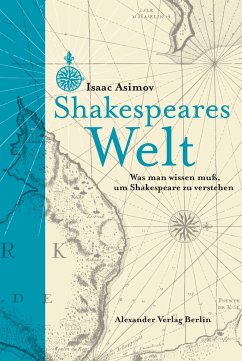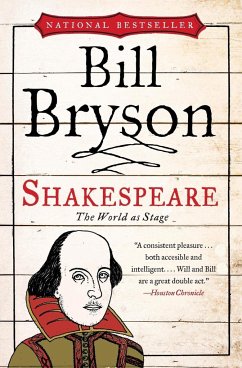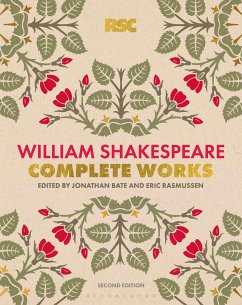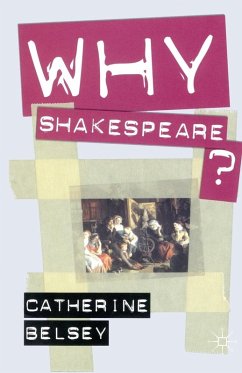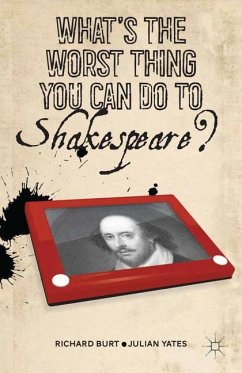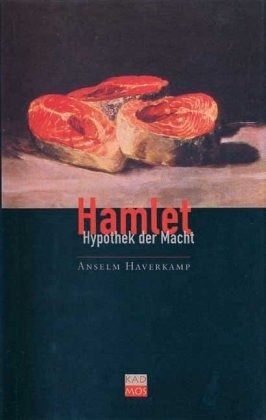
Hamlet, Hypothek der Macht
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
19,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das Geheimnis von Shakespeares Hamlet hat viele Aspekte. Seit der Romantik ist es grundlose Melancholie, die den Helden politisch unfähig macht; die subjektive Seite der Tragödie bringt die politische Konstellation zum Verschwinden. Was beide Seiten verbindet, die subjektive Misere im Vordergrund und die objektive Sphäre im Hintergrund, ist die doppelte Rolle des verlorenen Vaters und ermordeten Königs. Wie, wenn das Geheimnis, dessen Hamlet gewahr würde, darin bestünde, daß der Vater nicht der Vater, sondern der Onkel, der Sohn nicht der Sohn des ermordeten Königs, sondern der Mörder...
Das Geheimnis von Shakespeares Hamlet hat viele Aspekte. Seit der Romantik ist es grundlose Melancholie, die den Helden politisch unfähig macht; die subjektive Seite der Tragödie bringt die politische Konstellation zum Verschwinden. Was beide Seiten verbindet, die subjektive Misere im Vordergrund und die objektive Sphäre im Hintergrund, ist die doppelte Rolle des verlorenen Vaters und ermordeten Königs. Wie, wenn das Geheimnis, dessen Hamlet gewahr würde, darin bestünde, daß der Vater nicht der Vater, sondern der Onkel, der Sohn nicht der Sohn des ermordeten Königs, sondern der Mörder und Usurpator wäre?"Die Texte [.] sind meist für theoretisch Fortgeschrittene [.]. Aber warum nicht, Fortgeschrittene haben auch eine Existenzberechtigung und für genau die verweist Haverkamp dann etwa auf 128 Momente, für die es sich lohnt, den Kopf zu knoten. (DE:BUG)
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.