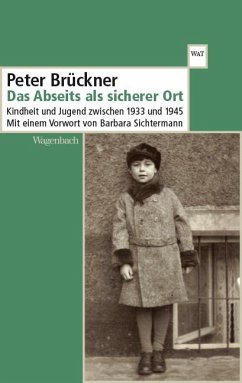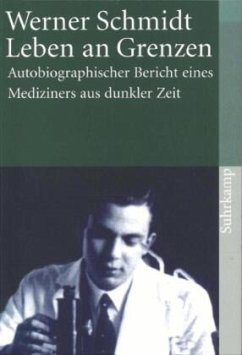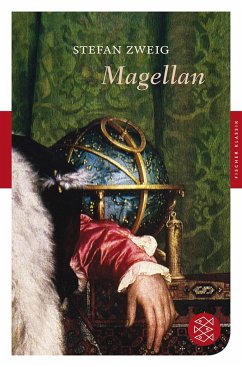Hammerstein oder Der Eigensinn
Eine deutsche Geschichte
Mitwirkender: Müller, Reinhard
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
14,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ein großes Werk über die verhängnisvollste Periode der deutschen Geschichte und über die herausragende Gestalt eines Mannes, dessen Biographie bislang nicht geschrieben wurde. Hans Magnus Enzensberger hat die Geschichte des Generals Kurt von Hammerstein aus allen erreichbaren Quellen recherchiert und entfaltet sie in einem Genre, das er beherrscht wie kein zweiter: in der literarischen Biographie.Kurt von Hammerstein war Chef der Reichswehr, ein Grandseigneur, ein unerschütterlicher Gegner des Nationalsozialismus, ein unbestechlicher Zeuge des Untergangs seiner Klasse, des deutschen Milit...
Ein großes Werk über die verhängnisvollste Periode der deutschen Geschichte und über die herausragende Gestalt eines Mannes, dessen Biographie bislang nicht geschrieben wurde. Hans Magnus Enzensberger hat die Geschichte des Generals Kurt von Hammerstein aus allen erreichbaren Quellen recherchiert und entfaltet sie in einem Genre, das er beherrscht wie kein zweiter: in der literarischen Biographie.
Kurt von Hammerstein war Chef der Reichswehr, ein Grandseigneur, ein unerschütterlicher Gegner des Nationalsozialismus, ein unbestechlicher Zeuge des Untergangs seiner Klasse, des deutschen Militäradels. Seinen Abschied nahm er, nachdem Hitler seine Weltkriegspläne 1933 in einer Geheimrede offengelegt hatte.
Aber es geht auch um die Lebensläufe seiner Frau und seiner sieben Kinder: gezeichnet von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, von Verrat, Widerstand, Spionage und Sippenhaft. Und nicht zuletzt geraten jene Personen ins Fadenkreuz, die zu einem gefährlichen Doppelleben gezwungen waren: vom letzten Reichskanzler der Weimarer Republik über die Agenten der KPD bis zu jener Drogistin, die in Kreuzberg Deserteure und Juden versteckte.
Hammerstein ist nach Der kurze Sommer der Anarchie und Requiem für eine romantische Frau Enzensbergers dritte literarische Biographie, in der die Selbstbehauptung des Einzelnen gegenüber kollektiven und autoritären Zumutungen im Zentrum steht. Für dieses Buch hat der Autor die Archive von Moskau bis Berlin, von München bis Toronto befragt. Doch behält für ihn das Dokument nicht das letzte Wort. In einem vielfältigen Werk verbindet sich erneut die Recherche mit der Freiheit des Autors, sich der historischen Wirklichkeit auch über Fiktionen zu nähern.
Kurt von Hammerstein war Chef der Reichswehr, ein Grandseigneur, ein unerschütterlicher Gegner des Nationalsozialismus, ein unbestechlicher Zeuge des Untergangs seiner Klasse, des deutschen Militäradels. Seinen Abschied nahm er, nachdem Hitler seine Weltkriegspläne 1933 in einer Geheimrede offengelegt hatte.
Aber es geht auch um die Lebensläufe seiner Frau und seiner sieben Kinder: gezeichnet von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, von Verrat, Widerstand, Spionage und Sippenhaft. Und nicht zuletzt geraten jene Personen ins Fadenkreuz, die zu einem gefährlichen Doppelleben gezwungen waren: vom letzten Reichskanzler der Weimarer Republik über die Agenten der KPD bis zu jener Drogistin, die in Kreuzberg Deserteure und Juden versteckte.
Hammerstein ist nach Der kurze Sommer der Anarchie und Requiem für eine romantische Frau Enzensbergers dritte literarische Biographie, in der die Selbstbehauptung des Einzelnen gegenüber kollektiven und autoritären Zumutungen im Zentrum steht. Für dieses Buch hat der Autor die Archive von Moskau bis Berlin, von München bis Toronto befragt. Doch behält für ihn das Dokument nicht das letzte Wort. In einem vielfältigen Werk verbindet sich erneut die Recherche mit der Freiheit des Autors, sich der historischen Wirklichkeit auch über Fiktionen zu nähern.