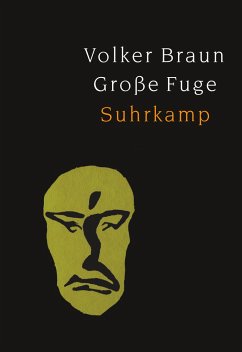Nicht lieferbar

Handbibliothek der Unbehausten
Neue Gedichte
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Wovon spricht die Dichtung zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Noch immer oder nun erst von der Wildnis der Gesellschaft.Am Kilometer Null der Empörung, auf der Puerta del Sol in Madrid, sah Volker Braun die Handbibliothek, die seinem neuen Buch den Titel gibt. In ihm stehen die Gedichte wie in improvisierten Regalen, einzelne kleine Schriften, leicht herauszugreifen und zu benutzen. Und von Wanderwesen & Fabelarbeitern ist darin die Rede, den Nackten und den Vermummten, der ungesättigten Menge (ein Riß geht hindurch bis zum Bodensatz), der unbehausten Menschheit. Der Dichter sieht sich auf der...
Wovon spricht die Dichtung zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Noch immer oder nun erst von der Wildnis der Gesellschaft.
Am Kilometer Null der Empörung, auf der Puerta del Sol in Madrid, sah Volker Braun die Handbibliothek, die seinem neuen Buch den Titel gibt. In ihm stehen die Gedichte wie in improvisierten Regalen, einzelne kleine Schriften, leicht herauszugreifen und zu benutzen. Und von Wanderwesen & Fabelarbeitern ist darin die Rede, den Nackten und den Vermummten, der ungesättigten Menge (ein Riß geht hindurch bis zum Bodensatz), der unbehausten Menschheit. Der Dichter sieht sich auf der warmen Erde, worin die Sohlen wohnen, eine Zuflucht der Sinne suchend und Lust, nicht Hoffnung ziehnd aus dem Rohstoff.
Die vier Sammlungen entstanden in zehn Jahren neben den Prosa- und Theatertexten. »Gedichte sind der Kern der Arbeit, das beiläufige Eigentliche.«
Am Kilometer Null der Empörung, auf der Puerta del Sol in Madrid, sah Volker Braun die Handbibliothek, die seinem neuen Buch den Titel gibt. In ihm stehen die Gedichte wie in improvisierten Regalen, einzelne kleine Schriften, leicht herauszugreifen und zu benutzen. Und von Wanderwesen & Fabelarbeitern ist darin die Rede, den Nackten und den Vermummten, der ungesättigten Menge (ein Riß geht hindurch bis zum Bodensatz), der unbehausten Menschheit. Der Dichter sieht sich auf der warmen Erde, worin die Sohlen wohnen, eine Zuflucht der Sinne suchend und Lust, nicht Hoffnung ziehnd aus dem Rohstoff.
Die vier Sammlungen entstanden in zehn Jahren neben den Prosa- und Theatertexten. »Gedichte sind der Kern der Arbeit, das beiläufige Eigentliche.«