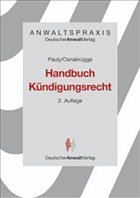Seit Erscheinen der ersten Auflage wurden über 10.000 neue arbeitsrechtliche Entscheidungen veröffentlicht. Mehr als 300.000 neue Kündigungsschutzklagen in Deutschland im Jahre 2005 machen deutlich: Kündigungsschutzmandate bleiben die häufigsten Mandate.
20 renommierte Arbeitsrechtsspezialisten - Rechtsanwälte und Richter - führen Sie durch den Dschungel von Rechtsprechung und Gesetzen. Das Handbuch Kündigungsrecht liefert Ihnen für alle Fragen des arbeitsrechtlichen Bestandsschutzmandates die richtige Antwort. Umfassend, praxisgerecht aufgearbeitet, sofort verwertbar und aktuell. Schon in der zweiten Auflage ein Standardwerk für die anwaltliche Praxis, das in keiner Anwaltsbibliothek fehlen darf.
Gegenüber der Vorauflage erweitert um Kapitel zu sozialversicherungsrechtlichen- und steuerrechtlichen Fragen sowie vollständig überarbeitet und aktualisiert erhalten Sie für Ihre tägliche Arbeit alles, was Sie an Spezialwissen, Praxistipps und Prozessberatungsstrategien brauchen. U. a.:
- Herangehensweise und Mandatsführung im kündigungsrechtlichen Mandat
- Wie entgeht man Haftungsfallen
- Die materiellrechtlichen Grundlagen
- Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag
- Der Kündigungsschutzprozess I. und II. Instanz
- Die Zwangsvollstreckung aus arbeitsrechtlichen Titeln
- Keine Gebühren verschenken - die gebührenrechtliche Behandlung nach RVG
- Die Abwicklung des Mandats mit der Rechtsschutzversicherung
- Steuer- und Sozialversicherungsrechtliches Umfeld
- Checklisten, Muster, Beratungshinweise, Formulierungshilfen.
Mit dem Handbuch Kündigungsrecht in der brandaktuellen zweiten Auflage auf dem Schreibtisch haben Sie den nötigen Vorsprung bei der Beratung und Vertretung Ihrer Mandanten und das ideale Hilfsmittel für Ihre tägliche Arbeit. Das Werk hat den Gesetzgebungsstand 01.06.2006.
Inhaltsverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnis. 47
Literaturverzeichnis. 55
A. Materielles Kündigungs- und Kündigungsschutzrecht. 59
§ 1 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
I. Einführung. 59
II. Die Arten der Kündigung. 59
1. Die Beendigungs- und die Änderungskündigung. 60
2. Ordentliche und außerordentliche Kündigung. 63
III. Die ordentliche Kündigung. 64
1. Person des Kündigenden. 64
2. Person des Kündigungsempfängers. 65
3. Gegenstand der Kündigung. 67
4. Form und Inhalt der Kündigung. 68
a) Form der Kündigung. 68
b) Inhalt der Kündigungserklärung. 70
5. Zeitpunkt und Zugang der Kündigung. 71
a) Zeitpunkt der Kündigung. 71
b) Zugang der Kündigungserklärung. 72
6. Kündigungsfristen und Kündigungstermine. 76
§ 2 Die außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses
I. Einführung. 81
II. Die Arten der Kündigung. 82
III. Unkündbarkeit (= Ausschluss der ordentlichen Kündigung). 82
IV. Ausschlussfrist. 83
V. Abmahnung. 84
VI. Wichtiger Grund. 84
VII. Art der Kündigungsgründe. 85
1. Betriebsbedingte Kündigung. 85
2. Personenbedingte Kündigung. 86
3. Verhaltensbedingte Kündigung. 86
VIII. Beispiele. 86
IX. Außerordentliche Arbeitnehmerkündigungen. 88
1. Einführung. 88
2. Art der Kündigungsgründe. 88
3. Beispiele. 89
X. Sonderkündigungsschutz. 89
1. Mutterschutz. 89
2. Elternzeit. 90
3. Schwerbehinderte. 90
XI. Beteiligung des Betriebsrates. 91
XII. Darlegungs- und Beweislast. 91
XIII. Sozialversicherungsrecht. 92
XIV. Muster, Checkliste. 92
1. Muster: Anhörung des Betriebsrates. 92
2. Muster: Einholung der Zustimmung des Integrationsamtes. 93
3. Muster: Antrag auf Zustimmung der Kündigung einer unter das MuSchG fallenden Arbeitnehmerin. 94
4. Muster: Außerordentliche Kündigung mit vorsorglicher ordentlicher Kündigung. 94
5. Checkliste: Außerordentliche Kündigung. 95
§ 3 Der allgemeine Kündigungsschutz nach dem KSchG
I. Überblick. 98
II. Voraussetzungen des allgemeinen Kündigungsschutzes. 103
1. Geschützter Personenkreis. 103
2. Nicht geschützte Personen. 105
3. Erfasste Betriebe. 106
a) Betriebsbegriff. 106
b) Gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen. 108
c) Mindestarbeitnehmerzahl. 110
4. Wartezeit. 113
a) Beschäftigungsdauer von mehr als sechs Monaten. 113
b) Berechnung. 114
III. Allgemeine Prinzipien zur Überprüfung von Kündigungen. 116
1. Ultima-ratio-Prinzip. 116
2. Prognoseprinzip. 116
3. Interessenabwägung. 116
IV. Betriebsbedingte Gründe. 117
1. Dringende betriebliche Erfordernisse. 118
a) Unternehmerentscheidung. 118
b) Außer- und innerbetriebliche Gründe. 120
c) Umsetzung der Unternehmerentscheidung. 122
d) Missbrauchskontrolle. 123
e) Nachvollziehbarer Arbeitskräfteüberhang. 125
f) Betriebsbezogenheit. 128
g) Wiedereinstellungsanspruch. 129
2. Fehlende Möglichkeit der Weiterbeschäftigung. 130
a) Möglichkeit der Weiterbeschäftigung in demselben Betrieb oder einem anderen Betrieb des Unternehmens. 130
aa) Freier Arbeitsplatz. 130
bb) Vergleichbarer Arbeitsplatz. 132
cc) Betrieb oder Unternehmen. 133
b) Möglichkeit der Weiterbeschäftigung nach Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen. 133
c) Möglichkeit der Weiterbeschäftigung unter geänderten Arbeitsbedingungen. 134
d) Sonstige anerkannte mildere Mittel. 135
e) Darlegungs- und Beweislast. 137
f) Vermutung dringender betrieblicher Erfordernisse bei Interessenausgleich mit Namensliste. 137
g) Druckkündigung. 141
3. Soziale Auswahl. 141
a) Betriebsbezug. 142
b) Vergleichbare Arbeitnehmer. 143
aa) Fähigkeiten und Kenntnisse. 143
bb) Arbeitsvertrag. 144
cc) Dieselbe Ebene der Betriebshierarchie. 146
c) Soziale Gesichtspunkte. 146
d) Darlegungs- und Beweislast. 148
e) Vermutung ordnungsgemäßer Sozialauswahl bei Interessenausgleich mit Namensliste. 150
f) Leistungsträgerregelung. 152
g) Kollektivrechtliche Auswahlrichtlinien. 156
V. Absolute Sozialwidrigkeitsgründe. 156
1. Erweiterter Kündigungsschutz. 156
2. Widerspruch des Betriebs- oder Personalrats. 157
VI. Personenbedingte Gründe. 157
1. Vorliegen personenbedingter Kündigungsgründe. 157
2. Allgemeine Prüfungssystematik. 158
a) Negativprognose. 158
b) Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen. 158
c) Weiterbeschäftigung auf einem freien Arbeitsplatz oder sonstige mildere Mittel. 158
d) Interessenabwägung. 158
3. Krankheit. 159
a) Dauernde Leistungsunfähigkeit. 161
b) Lang andauernde Leistungsunfähigkeit. 162
c) Häufige Kurzerkrankungen. 164
d) Krankheitsbedingte Leistungsminderung. 166
4. Alkohol- und sonstige Drogenabhängigkeit. 167
5. Arbeitserlaubnis. 167
6. Eignung. 167
7. Inhaftierung des Arbeitnehmers. 168
8. Pensionsalter. 169
9. Sicherheitsbedenken. 170
10. Straftaten im außerdienstlichen Bereich. 170
11. Minderleistung. 170
VII. Verhaltensbedingte Gründe. 171
1. Vorliegen verhaltensbedingter Kündigungsgründe. 171
2. Allgemeine Prüfungssystematik. 171
a) Arbeitspflichtverletzung. 171
b) Negative Zukunftsprognose. 171
c) Abmahnung. 172
d) Weiterbeschäftigung auf einem anderen freien Arbeitsplatz. 172
e) Interessenabwägung. 172
f) Verschulden. 173
3. Darlegungs- und Beweislast. 173
4. Fallgruppen anerkannter Arbeitspflichtverletzungen. 173
a) Alkohol- und Drogenmissbrauch. 173
b) Anzeigen und Zeugenaussagen. 174
c) Arbeitsverweigerung. 174
d) Außerbetriebliches Verhalten. 175
e) Beleidigungen. 176
f) Betriebliche Ordnung. 176
g) Fehl-, Schlecht- oder Minderleistung. 177
h) Gehaltspfändungen. 178
i) Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit. 178
j) Private Nutzung betrieblicher Telefon- und Datenverarbeitungsanlagen sowie Internetzugänge. 179
k) Sexuelle Belästigung. 181
l) Tarifliche Regelung. 181
m) Wettbewerbs- und Nebentätigkeit. 181
VIII. Abmahnung. 182
1. Überblick. 182
2. Notwendiger Inhalt der Abmahnung. 183
a) Konkrete Bezeichnung (eines) Fehlverhaltens. 183
b) Androhung arbeitsrechtlicher Konsequenzen. 184
d) Kein Formerfordernis. 185
e) Zugang der Abmahnung. 185
f) Kenntnisnahme durch Arbeitnehmer. 185
3. Zeitpunkt der Abmahnung. 185
a) Verwirkung. 186
b) Keine Geltung tarifvertraglicher Ausschlussfristen. 186
4. Wirkungslosigkeit von Abmahnungen. 186
b) Wirkungsdauer und Tilgung. 187
c) (Bewährungs-) Zeitraum zwischen Abmahnung und Kündigung. 188
5. Erforderlichkeit einer Abmahnung - Steuerbares Verhalten. 188
6. Abmahnung in Sonderfällen. 190
a) Abmahnung gegenüber Auszubildenden. 190
b) Abmahnung vor Änderungskündigung. 190
c) Keine Abmahnung bei Nichtanwendbarkeit des KSchG. 190
d) Abmahnung von Betriebs- oder Personalratsmitgliedern. 191
7. Verhältnis von Abmahnung und Kündigung. 191
a) Gleichartigkeit der Pflichtverletzungen. 191
b) Anzahl der Abmahnungen. 192
c) Kündigungsverzicht durch Abmahnungserteilung. 192
8. Beteiligung des Betriebs- oder Personalrats. 192
9. Rechtsmittel gegen Abmahnungen. 193
a) Anspruch auf Entfernung unberechtigter Abmahnungen aus der Personalakte. 193
b) Widerrufsanspruch. 194
c) Recht auf Gegendarstellung. 194
IX. Änderungskündigung. 194
1. Überblick. 194
2. Annahme, Annahme unter Vorbehalt, Ablehnung. 195
3. Prüfungssystematik. 196
4. Betriebsbedingte Änderungskündigung. 197
a) Entgeltreduzierung. 197
b) Nebenabreden. 199
c) Versetzungen. 200
d) Veränderung der Arbeitszeit. 200
5. Personenbedingte Änderungskündigung. 201
6. Verhaltensbedingte Änderungskündigung. 201
X. Muster: Kündigungsschutzklage. 202
§ 4 Anzeigepflichtige Entlassungen (sog. Massenentlassungen)
I. Einführung. 207
II. Anzeigepflicht nach § 17 Abs. 1 KSchG. 207
1. Betrieb. 208
2. Arbeitnehmer. 208
3. Entlassung. 209
4. Rahmenfrist. 213
III. Beteiligung des Betriebsrates. 213
1. Schriftliche Unterrichtung gem. § 17 Abs. 2 S. 1 KSchG. 214
2. Beratung gem. § 17 Abs. 2 S. 2 KSchG. 214
3. Einholung der Stellungnahme des Betriebsrates gem. § 17 Abs. 3 S. 2 KSchG. 215
4. Zuleitung einer Abschrift der Anzeige an den Betriebsrat gem. § 17 Abs. 3 S. 6 KSchG. 215
5. Konzernklausel gem. § 17 Abs. 3a KSchG. 215
6. Gewährleistung der Mitbestimmungsrechte gem. § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG, falls Kurzarbeit gem. § 19 Abs. 1 KSchG eingeführt wird. 215
IV. Inhalt der Anzeige gem. § 17 KSchG. 216
1. Muss-Inhalt. 216
2. Soll-Inhalt. 216
3. Schriftform. 216
V. Rechtsfolgen. 217
1. Entlassungssperre. 217
2. Entscheidung der Agentur für Arbeit. 217
3. Sperrfrist. 218
4. Freifrist. 219
5. Kurzarbeit. 220
6. Rechtsfolgen bei Fehlen der Massenentlassungsanzeige. 220
7. Rechtsfolgen der unwirksamen Massenentlassungsanzeige. 220
8. Rechtsfolgen bei nichtrechtzeitiger Massenentlassungsanzeige. 220
9. Verzicht auf den Massenentlassungsschutz. 221
VI. Massenentlassung und betriebsbedingte Kündigung. 221
VII. Sonstige Rechte der Arbeitnehmervertretungen. 221
VIII. Praktisches Vorgehen bis zur Gesetzesänderung. 221
IX. Checkliste. 222
§ 5 Abfindungsanspruch bei betriebsbedingten Kündigungen, § 1a KSchG
I. Einführung. 223
II. Anspruchsinhalt und Anspruchsvoraussetzungen. 224
1. Gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Anspruch? 224
2. Voraussetzungen des Anspruchs. 226
a) Geltung des Kündigungsschutzgesetzes. 226
b) Kündigung wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nach § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG. 227
c) Hinweis des Arbeitgebers (Angebot). 228
d) Verstreichenlassen der Klagefrist (Annahme). 229
3. Rechtsfolgen. 230
4. Einzelprobleme. 233
a) Niedrigeres Angebot. 233
b) Höheres Angebot. 234
c) Nachträgliche Zulassung der Klage (§ 5 KSchG). 235
d) Klagerücknahme im Prozess. 235
e) § 6 KSchG. 236
5. Sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen. 236
6. Steuerliche Rahmenbedingungen. 237
III. Beratungshinweise. 237
IV. Muster: Kündigung, verbunden mit einem Angebot nach § 1 a KSchG. 238
§ 6 Kündigungsschutz außerhalb des KSchG
I. Einführung. 239
II. Der allgemeine Kündigungsschutz außerhalb des KSchG. 240
1. Verfassungsrechtlicher Hintergrund. 240
2. Ansichten in der Literatur. 241
3. Die Rechtsprechung des BAG zu Kündigungen außerhalb des KSchG. 242
4. Die Rechtmäßigkeit von Kündigungen in der anwaltlichen Praxis. 246
§ 7 Sonderkündigungsschutz
I. Einführung. 249
II. Kündigungsschutz nach dem MuSchG. 249
1. Geltungsbereich und Dauer. 249
2. Voraussetzungen des Kündigungsschutzes. 250
a) Schwangerschaft. 250
b) Kündigung durch den Arbeitgeber. 251
c) Kenntnis des Arbeitgebers. 251
d) Versäumung der Mitteilungsfrist. 252
aa) Nachträgliche Mitteilung binnen zwei Wochen ab Zugang der Kündigung. 252
bb) Unverschuldet verspätete Mitteilung. 252
3. Rechtsfolge. 253
4. Ausnahme vom Kündigungsschutz. 253
a) Antrag des Arbeitgebers. 254
b) Entscheidung der Behörde. 254
III. Kündigungsschutz nach dem BErzGG. 256
1. Geltungsbereich und Dauer. 256
2. Voraussetzungen des Kündigungsschutzes. 257
a) Kündigungsschutz nach Verlangen von Elternzeit und während der Elternzeit. 257
b) Kündigungsschutz bei Teilzeitarbeit während der Elternzeit. 258
c) Kündigungsschutz bei Teilzeitarbeit ohne Elternzeit in besonderen Fällen. 258
3. Rechtsfolge. 259
4. Ausnahme vom Kündigungsschutz. 259
IV. Kündigungsschutz schwerbehinderter Arbeitnehmer. 260
1. Geltungsbereich und gesetzliche Ausnahmen. 260
2. Voraussetzungen des Kündigungsschutzes. 261
a) Schwerbehinderteneigenschaft. 261
b) Gleichgestellte. 262
c) Kenntnis des Arbeitgebers. 263
d) Präventive Maßnahmen, insbesondere betriebliches Eingliederungsmanagement. 264
3. Rechtsfolge. 265
4. Ausnahme vom Kündigungsschutz. 266
a) Ordentliche Kündigung. 266
b) Außerordentliche Kündigung. 267
5. Betriebsratsanhörung. 269
6. Rechtsmittel. 269
V. Kündigungsschutz von Betriebsratsmitgliedern und anderen Amtsinhabern. 269
1. Geltungsbereich und Dauer. 270
2. Umfang des Kündigungsschutzes. 271
a) Ordentliche Kündigung. 271
aa) Unzulässigkeit ordentlicher Kündigung. 271
bb) Ausnahme bei Betriebs- oder Betriebsteilstilllegung. 272
b) Außerordentliche Kündigung. 273
aa) Wichtiger Grund. 273
bb) Zustimmung des Betriebsrats. 274
cc) Ersetzung der Zustimmung. 275
3. Rechtsfolge. 276
VI. Sonstige Fälle besonderen Kündigungsschutzes. 276
§ 8 Kündigung im Berufsausbildungsverhältnis
I. Einführung. 277
II. Einvernehmliche Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses. 278
1. Zulässigkeit des Aufhebungsvertrages. 278
2. Form und Inhalt des Aufhebungsvertrages. 279
3. Checkliste: Aufhebungsvertrag mit Auszubildendem nach Ende der Probezeit. 280
4. Muster: Aufhebungsvereinbarung. 280
III. Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses. 281
1. Kündigung innerhalb der Probezeit. 281
a) Beginn und Ende der Probezeit. 281
b) Formelle Wirksamkeitsvoraussetzungen. 282
c) Besondere Schutzvorschriften. 282
d) Sonderfall: Kündigung vor Beginn der Berufsausbildung. 282
2. Kündigung nach Ende der Probezeit. 282
a) Kündigung aus wichtigem Grund. 283
b) Form und Inhalt. 283
c) Fristen. 284
d) Mitbestimmung/Sonderkündigungsschutz. 284
e) Güteverfahren. 284
f) Anerkannte Gründe. 285
g) Checkliste: Kündigung durch Ausbildungsbetrieb nach Ende der Probezeit. 286
§ 9 Kündigung im Arbeitskampf
I. Grundlagen. 287
1. Rechtsgrundlagen. 287
2. Begriffsbestimmung. 287
3. Parteien des Arbeitskampfes (im engeren Sinne). 288
II. Arbeitskampfmaßnahmen im engeren Sinne (Streiks und Aussperrungen). 288
1. Der Streik. 289
a) Erscheinungsformen. 289
b) Voraussetzungen des rechtmäßigen Streiks. 289
c) Folgen eines rechtmäßigen Streiks. 291
aa) Abmahnung und Kündigung wegen des Arbeitskampfes. 291
bb) Kündigung aus anderen Gründen als dem Arbeitskampf. 291
cc) Beteiligungsrechte des Betriebsrats. 292
d) Folgen eines rechtswidrigen Streiks. 292
aa) Kündigung. 292
bb) Beteiligungsrechte des Betriebsrats. 293
cc) Aussperrung als Reaktion des Arbeitgebers. 293
e) Neutralitätspflicht des Staates, Leistungen der Arbeitsförderung. 293
2. Die Aussperrung. 293
a) Suspendierende Aussperrung als Angriffsmittel (Angriffsaussperrung) 294
b) Aussperrung als Reaktion auf einen Streik (Abwehraussperrung). 294
c) Folgen rechtmäßiger Aussperrungen. 295
d) Folgen rechtswidriger Aussperrungen. 295
e) Sonderfall: Lösende Aussperrung. 295
III. Arbeitskampfmaßnahmen im weiteren Sinne (hier: Massenänderungskündigung). 296
1. Die Massenänderungskündigung des Arbeitgebers. 296
2. Massenänderungskündigung der Arbeitnehmer. 297
§ 10 Kündigung bei Betriebsübergang
I. Einführung. 299
II. Der Betriebsübergang: Begriff und Tatbestandsvoraussetzungen. 300
1. Verständnis der Norm. 300
2. Begriff der wirtschaftlichen Einheit. 300
3. Teilbetrieb. 302
4. Rechtsgeschäftlicher Übergang. 302
5. Übergang auf einen anderen Inhaber. 303
a) Tatsächliche Weiterführung der Geschäftstätigkeit erforderlich. 303
b) Abgrenzung zum Gesellschafterwechsel/share deal. 303
6. Abgrenzungstatbestände. 303
a) Funktionsnachfolge. 303
b) Betriebsstilllegung. 304
7. Rechtsfolgen - Übergang der Arbeitsverhältnisse. 305
III. Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers und Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer. 306
1. Sinn und Zweck der Neuregelung. 306
2. Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers. 306
a) Inhalt. 306
b) Form. 307
c) Fehlerhafte Unterrichtung. 308
3. Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer. 308
a) Inhalt, Adressat, Form. 308
b) Frist. 308
c) Abweichende Vereinbarung, Verzicht, Widerruf. 309
IV Die Kündigung bei Betriebsübergang. 309
1. Grundsätze. 309
2. Kündigung "wegen" Betriebsübergang. 310
3. Umgehung durch Eigenkündigung, Befristung oder Auflösungsvertrag. 310
4. Nachteilige Vereinbarungen anlässlich des Betriebsübergangs unwirksam 310
5. Die Kündigung aus anderen Gründen beim Betriebsübergang. 311
6. Sanierungskonzepte des Betriebsveräußerers/Betriebserwerbers. 311
a) Grundsätze. 311
b) Personalreduzierung beim Veräußerer wegen "Erhöhung der Verkäuflichkeit". 312
c) Kündigung nach Erwerberkonzept. 313
7. Widerspruch des Arbeitnehmers gegen den Betriebsübergang und Sozialauswahl. 313
V. Sonderkündigungsschutz beim Betriebsübergang. 314
1. Grundsätze. 314
2. Betriebsräte. 315
3. Schwerbehinderte Menschen. 315
4. Arbeitnehmer in Mutterschutz und Elternzeit. 315
5. Tariflich unkündbare Arbeitnehmer. 316
VI. Wiedereinstellungs- und/oder Vertragsfortsetzungsanspruch. 316
1. Grundsätze. 316
2. Wiedereinstellungsanspruch gegen Altarbeitgeber. 317
3. Vertragsfortsetzungsanspruch gegen den Betriebserwerber. 317
4. Wiedereinstellungsanspruch in der Insolvenz. 318
VII. Prozessuale Fragen. 318
1. Klageart. 318
2. Passivlegitimation bei Kündigungsausspruch vor Betriebsübergang. 319
3. Passivlegitimation bei Kündigungsausspruch nach Betriebsübergang. 319
4. Annahmeverzug. 319
5. Auflösungsantrag. 320
6. Darlegungs- und Beweislast. 320
7. Klagefrist. 320
§ 11 Kündigung und Unternehmensumwandlung
I. Einführung. 321
II. Arten der Umwandlung. 321
III. Kündigungsschutz bei Umwandlungen. 322
1. Umwandlungsrecht und Betriebsübergang. 322
a) Grundsätze. 322
b) Sonderfall: Widerspruch des Arbeitnehmers bei Verschmelzung/Aufspaltung. 322
2. Kündigungsrechtliche Stellung der Arbeitnehmer bei Umwandlungen. 323
3. Kündigungsschutz im Gemeinschaftsbetrieb. 324
§ 12 Mitbestimmung bei Kündigungen
I. Einführung. 325
II. Die Beteiligung des Betriebsrats bei Kündigungen nach § 102 Abs. 1 BetrVG 326
1. Geltungs- und Anwendungsbereich, Abgrenzungen. 326
2. Gegenstand des Anhörungsverfahrens. 333
a) Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. 333
b) Sonstige Beendigungstatbestände. 335
3. Das Anhörungsverfahren - Überblick und Grundsätze. 336
a) Sinn und Zweck und Beteiligungsart. 337
b) Kündigungsfreiheit und Verzicht. 337
4. Einleitung des Verfahrens. 338
a) Form der Mitteilung. 338
b) Mitteilungsfrist. 339
c) Adressat (der "richtige" Betriebsrat). 340
5. Inhalt der Anhörungsmitteilung. 342
a) Grundsätze und Grenzen. 342
aa) Kenntnis des Betriebsrats. 342
bb) Kenntnis des Arbeitnehmers. 342
cc) Datenschutz. 342
b) Art der Kündigung und Kündigungsabsicht. 343
c) Kündigungsfrist, Kündigungszeitpunkt und Kündigungstermin. 343
d) Person des Arbeitnehmers/Sozialdaten. 343
e) Kündigungsgründe - Allgemeines und Grundsatz der subjektiven Determination. 344
f) Personenbedingte Kündigung. 345
g) Verhaltensbedingte Kündigung. 346
h) Betriebsbedingte Kündigung. 347
i) Änderungskündigung. 349
j) Verdachtskündigung. 349
k) Arbeitnehmer ohne Kündigungsschutz. 350
l) Außerordentliche Kündigung. 350
m) Nachschieben von Kündigungsgründen. 351
n) Checkliste "Allgemeiner Mindestinhalt". 352
6. Durchführung des Verfahrens. 352
7. Abschluss des Verfahrens. 353
a) Reaktion des Betriebsrats bei der ordentlichen Kündigung. 353
aa) Bedenken. 354
bb) Widerspruch. 354
cc) Zustimmung und Verzicht. 354
b) Reaktion bei der außerordentlichen Kündigung. 355
aa) Bedenken. 355
bb) Zustimmung und Verzicht. 356
c) Fristabreden. 356
d) Änderung und Aufhebung der Stellungnahme. 356
e) Checkliste. 357
8. Das Widerspruchsrecht des Betriebsrats - Inhalt, Ausübung und Wirkungen. 357
a) Frist. 358
b) Form. 358
c) Inhalt. 359
aa) Soziale Gesichtspunkte. 359
bb) Verstoß gegen Auswahlrichtlinie. 359
cc) Weiterbeschäftigungsmöglichkeit zu gleichen Bedingungen. 360
dd) Weiterbeschäftigungsmöglichkeit nach Fortbildung oder Umschulung. 360
ee) Weiterbeschäftigungsmöglichkeit zu geänderten Bedingungen. 360
d) Änderungskündigung. 361
e) Außerordentliche Kündigung. 361
f) Rechtsfolgen des Widerspruchs. 362
g) Checkliste. 362
9. Die Kündigung nach Verfahrensabschluss. 362
10. Mängel des Anhörungsverfahrens. 363
11. Rechtsfolgen der Mängel des Anhörungsverfahrens. 365
a) Verstoß gegen BetrVG. 365
b) Unwirksamkeit der Kündigung an sich. 365
c) Verwertungsverbot ("Nachschieben von Gründen"). 367
d) Auflösungsantrag § 9 KSchG. 370
e) Checkliste. 370
III. Die Beteiligung des Betriebsrats bei Kündigungen nach § 102 Abs. 6 BetrVG 370
IV. Die Beteiligung des Betriebsrats nach dem KSchG gem. § 102 Abs. 7 BetrVG 371
V. Die Beteiligung des Betriebsrats nach § 103 BetrVG. 371
§ 13 Der Weiterbeschäftigungsanspruch des Arbeitnehmers
I. Einführung. 375
II. Der gesetzliche Weiterbeschäftigungsanspruch gem. § 102 Abs. 5 BetrVG/§ 79 Abs. 2 BPersVG. 375
1. Voraussetzungen des Weiterbeschäftigungsanspruchs gem. § 102 Abs. 5 BetrVG. 376
a) Kündigung des Arbeitgebers. 376
b) Widerspruch des Betriebsrats. 377
c) Erhebung der Kündigungsschutzklage. 377
d) Verlangen nach Weiterbeschäftigung. 377
2. Anspruchsinhalt. 378
3. Beendigung des Weiterbeschäftigungsanspruches. 379
a) Entbindung des Arbeitgebers von der Weiterbeschäftigungspflicht. 379
aa) Mangelnde Erfolgsaussicht der Klage. 379
bb) Mutwilligkeit der Klage. 379
cc) Unzumutbare wirtschaftliche Belastung. 380
dd) Offensichtlich unbegründeter Widerspruch des Betriebsrats. 380
ee) Verfahren. 380
b) Sonstige Beendigungsgründe. 380
4. Rechtsfolgen der Entbindung und Rückabwicklung. 381
5. Anspruchsdurchsetzung. 382
6. Der gesetzliche Weiterbeschäftigungsanspruch gem. § 79 Abs. 2 BPersVG 382
7. Checkliste. 382
III. Der allgemeine Weiterbeschäftigungsanspruch. 383
1. Voraussetzungen. 383
a) Beendigungstatbestand. 384
b) Interessenabwägung. 384
aa) Zeitraum nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum ersten der Kündigungsschutzklage stattgebenden Urteil. 384
bb) Zeitraum nach stattgebendem Instanzurteil bis zu einem abweisenden Instanzurteil oder bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss. 385
cc) Zeitraum nach klageabweisendem Instanzurteil bis zu einem stattgebenden Urteil oder bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss. 385
dd) Abwägung bei offensichtlich unwirksamer Kündigung. 385
ee) Abwägung bei besonderem Beschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers. 386
2. Beendigung des allgemeinen Weiterbeschäftigungsanspruches. 386
3. Anspruchsinhalt und Rückabwicklung. 387
a) Erzwungene Weiterbeschäftigung. 388
b) Vereinbarte Weiterbeschäftigung. 388
4. Anspruchsdurchsetzung. 389
5. Böswilliges Unterlassen anderweitigen Erwerbes und Schriftform gem. § 14 Abs. 4 TzBfG. 390
6. Checkliste. 392
§ 14 Die Kündigung von Organen (AG-Vorstand und GmbH-Geschäftsführer)
I. Einführung. 393
II. Einleitende Fragestellungen. 394
1. Koppelung von Amt und Dienstvertrag. 394
2. Abmahnung. 395
3. Begründungspflicht. 395
4. Fristen. 395
5. Sonstige Beendigungstatbestände. 396
6. Zuständigkeiten. 396
7. Vertretungsbefugnis. 398
III. Kündigung von Vorstandsmitgliedern der AG. 399
1. Ordentliche Kündigung. 399
2. Außerordentliche Kündigung. 399
3. Kündigung durch das Vorstandsmitglied. 400
IV. Kündigung von Geschäftsführern der GmbH. 401
1. Ordentliche Kündigung. 401
2. Außerordentliche Kündigung. 401
3. Kündigung durch den Geschäftsführer. 402
V Rechtsfolgen und Fragen bei Beendigung der Stellung als Vorstand/Geschäftsführer. 402
VI. Arbeitsrechtliche Aspekte. 404
1. Vertretungsberechtigtes Organ und Arbeitnehmereigenschaft. 404
2. Umwandlung des Dienstverhältnisses in ein Arbeitsverhältnis, insbesondere die Weiterbeschäftigung nach Aufgabe der Organstellung. 405
3. Drittanstellungen. 405
4. Ruhen des Arbeitsverhältnisses. 406
5. Die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes auf vertretungsberechtigte Organe. 407
VII. Checkliste. 408
§ 15 Kündigung und Insolvenz
I. Einführung. 409
1. Die Zielsetzung des Insolvenzverfahrens. 409
2. Eröffnungs- und eröffnetes Verfahren. 410
a) "Eröffnungs-" oder "Antragsverfahren" (sog. "vorläufiges Insolvenzverfahren"). 410
b) Eröffnetes Verfahren. 413
aa) Forderungen, die vor dem Eröffnungsbeschluss entstanden sind. 413
bb) Forderungen, die nach dem Eröffnungsbeschluss entstanden sind. 414
II. Kündigungsrecht in der Eröffnungsphase. 414
1. Kündigung durch wen? 415
2. Freistellung. 416
3. Der Insolvenzgeldanspruch des Arbeitnehmers. 417
a) Rechtsgrundlagen. 417
b) Anspruchsberechtigter Personenkreis. 417
c) Weitere Anspruchsvoraussetzungen. 418
d) Inhalt und Umfang des Anspruchs. 419
e) Ausschlussfrist. 420
f) EU-Richtlinie zum Insolvenzgeld und ihre Umsetzung in Deutschland 420
g) Vorschuss und Vorfinanzierung von Insolvenzgeld. 421
aa) Die Vorschussregelung des § 186 SGB III. 421
bb) "Vorfinanzierung" von Insolvenzgeld gem. § 188 Abs. 4 SGB III. 422
h) Begrenzung des Insolvenzgeldes. 422
i) Prozessuales. 423
III. Kündigungsrecht und sonstige Gestaltungsrechte im eröffneten Verfahren. 423
1. Die einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften der InsO. 423
2. Individualarbeitsrecht. 424
a) Verkürzte Kündigungsfrist des § 113 Abs. 1 S. 2 InsO. 424
b) Nachkündigung durch den Insolvenzverwalter. 425
c) Kündigungsschutzklage. 426
d) Anmeldung von Kurzarbeit gem. §§ 169 ff. SGB III. 426
e) Freistellung und Weiterbeschäftigungsanspruch. 426
3. Kollektivarbeitsrecht. 427
a) Kündigung von Betriebsvereinbarungen gem. § 120 InsO. 427
b) Betriebsänderung und Sozialplanansprüche unter der Geltung der Insolvenzordnung. 427
IV Betriebsveräußerung unter der Geltung der Insolvenzordnung (§ 128 InsO). 430
V Sanierung durch AufTang- und Transfergesellschaften, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften (BQG). 431
1. Einleitung. 431
2. Rechtliche Struktur. 432
a) Übergang der Beschäftigungsverhältnisse auf die BQG. 432
aa) alter Arbeitgeber/Arbeitnehmer. 433
bb) Arbeitnehmer/BQG. 433
cc) alter Arbeitgeber/BQG. 434
b) Kein Betriebsübergang auf die BQG nach § 613a BGB. 435
c) Fortführung der Geschäftstätigkeit durch die Auffanggesellschaft. 435
3. Wirksamkeit der Gestaltung. 435
4. Allgemeine Aufklärungs- und Unterrichtungspflichten nach § 613a Abs. 5 BGB. 437
VI. Arbeitnehmeransprüche im massearmen Verfahren. 438
VII. Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz. 439
VIII. Internationales Insolvenzarbeitsrecht. 440
1. Hauptverwaltungssitz innerhalb der EU. 440
2. Hauptverwaltungssitz außerhalb der EU. 441
IX. Fazit. 441
X. Muster. 442
1. Vorläufiges Insolvenzverfahren: Bestellung eines sog. "schwachen" vorläufigen Insolvenzverwalters. 442
2. Vorläufiges Insolvenzverfahren: Bestellung eines sog. "starken" vorläufigen Insolvenzverwalters. 443
3. Sonderermächtigung des "schwachen" vorläufigen Verwalters zum Abschluss von Verträgen zu Lasten der künftigen Insolvenzmasse. 444
4. Übertragung der Arbeitgeberfunktion auf den vorläufigen "schwachen" Insolvenzverwalter. 445
5. Eröffnungsbeschluss. 446
§ 16 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
I. Ausgangspunkt. 447
II. Fragen der Vertragsgestaltung. 449
III. Pflichten aus dem Wettbewerbsverbot und Sanktionen. 450
1. Pflichten des Arbeitnehmers. 450
2. Pflichten des Arbeitgebers. 453
IV. Die Karenzentschädigung. 453
V. Das "fehlerhafte Wettbewerbsverbot". 454
1. Mangel der Schriftform, § 74 Abs. 1 HGB. 454
2. Mängel im Zusammenhang mit der Karenzentschädigung, §§ 74 Abs. 2, 75d HGB. 454
3. Mangel des berechtigten geschäftlichen Interesses, § 74a Abs. 1 S. 1 HGB 456
4. Unbillige Erschwernis, § 74a Abs. 1 S. 2 HGB. 458
5. Zeitliche Überdehnung, § 74a Abs. 1 S. 3 HGB. 458
6. Bedingte Wettbewerbsverbote/Wettbewerbsverbote mit Wahlrecht. 459
7. Nichtige Wettbewerbsverbote. 459
VI. Loslösung von rechtmäßigen Wettbewerbsverboten. 460
1. Verzicht gem. § 75a HGB. 460
2. Außerordentliche Kündigung durch den Arbeitnehmer, § 75 Abs. 1 HGB 464
3. Außerordentliche Kündigung des Arbeitgebers, § 75 Abs. 3 HGB. 465
4. Lösung des Wettbewerbsverbots bei ordentlicher Kündigung des Arbeitgebers, § 75 Abs. 2 HGB. 466
5. Einvernehmliche Aufhebung des Wettbewerbsverbotes/vertragliche Erweiterung der gesetzlichen Lösungsrechte. 467
VII. Muster. 467
1. Wettbewerbsverbotsklausel. 467
2. Fristsetzung zur Unterlassung des Wettbewerbes. 468
3. Rücktritt vom Wettbewerbsverbot. 468
4. Verzichtserklärung gem. § 75a HGB. 468
B. Befristung und auflösende Bedingung. 469
§ 17 Beendigung durch Befristung
I. Überblick. 469
II. Allgemeine Regeln zur wirksamen Befristung nach dem TzBfG. 471
1. Schriftform. 471
2. Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses. 472
3. Kündigung. 474
4. Entfristungsklage. 474
5. Befristung und Schwangerschaft. 478
6. Maßgeblicher Überprüfungszeitzeitpunkt. 479
7. Nachträgliche Befristung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses. 480
8. Keine Angabe des Befristungsgrundes und/oder der Rechtsgrundlage. 480
9. Befristung einzelner Arbeitsbedingungen. 482
10. Keine sachliche Rechtfertigung der Befristungsdauer. 483
11. Befristung in Kleinbetrieben, während der Wartezeit und bei leitenden Angestellten. 483
12. Befristungen mit Leiharbeitnehmern. 484
III. Sachgrundlose Befristungen nach dem TzBfG. 484
1. Maximal vier Befristungen in zwei Jahren. 485
2. Neueinstellung. 486
3. Befristete Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben. 488
4. Erleichterung befristeter Einstellungen für Unternehmensneugründungen 490
a) Unternehmensneugründung. 490
b) Sachgrundlose Befristung bis zur Dauer von vier Jahren. 491
c) Neueinstellung. 492
5. Tariföffnungsklausel. 493
IV. Sachgrundbefristungen nach dem TzBfG. 493
1. Allgemeines. 493
2. Die Fallgruppen des § 14 Abs. 1 S. 2 TzBfG. 493
a) Nr. 1 - Vorübergehender Arbeitskräftebedarf. 493
b) Nr. 2 - Erstanstellung im Anschluss an Ausbildung oder Studium. 495
c) Nr. 3 - Vertretung. 496
aa) Allgemeine Grundsätze. 497
bb) Elternzeitvertretung. 500
d) Nr. 4 - Eigenart der Arbeitsleistung. 500
e) Nr. 5 - Erprobung. 501
f) Nr. 6 - Gründe in der Person des Arbeitnehmers. 502
aa) Soziale Überbrückung. 502
bb) Befristung auf eigenen Wunsch. 503
cc) Arbeitserlaubnis und sonstige Einstellungs- und Beschäftigungsvoraussetzungen. 503
dd) Ausbildung. 505
ee) Studenten. 506
ff) Altersgrenze. 506
g) Nr. 7 - Haushaltsrechtliche Gründe. 507
h) Nr. 8 - Gerichtlicher Vergleich. 509
i) Sonstige sachliche Gründe. 510
V. Beteiligung des Betriebs- oder Personalrats beim Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen. 511
1. Mitbestimmungsrecht des Personalrates. 511
a) Mitbestimmungsrecht bei Einstellung. 511
b) Mitbestimmungsrecht bei Befristung. 512
2. Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. 513
VI. Musterentfristungsklage. 515
§ 18 Beendigung durch auflösende Bedingung
I. Überblick. 519
II. Sachgrundbefristungen. 519
1. Allgemeines. 519
2. Schriftform. 520
3. Klage. 520
4. Einzelne Sachgründe nach § 14 Abs. 1 S. 2 TzBfG. 521
a) Nr. 1 - Vorübergehender Arbeitskräftebedarf. 521
b) Nr. 2 - Erstanstellung im Anschluss an Ausbildung oder Studium. 521
c) Nr. 3 - Vertretung. 521
d) Nr. 4 - Eigenart der Arbeitsleistung. 521
e) Nr. 5 - Erprobung. 522
f) Nr. 6 - Gründe in der Person des Arbeitnehmers. 522
g) Nr. 7 - Haushaltsrechtliche Gründe. 523
h) Nr. 8 - Gerichtlicher Vergleich. 523
5. Sonstige Gründe. 523
6. Kein Eingreifen sonstiger Unwirksamkeitsgründe. 524
7. Rechtsfolgen unwirksamer auflösender Bedingungen. 524
C. Abwicklungs- und Aufhebungsvertrag. 525
§ 19 Abwicklungs- und Aufhebungsvertrag
I. Einführung. 525
II. Inhaltliche Ausgestaltung. 525
1. Beendigungsklausel. 526
2. Abfindungsklausel. 527
3. Abwicklungsklausel. 527
4. Freistellungsklausel. 528
5. Zeugnisklausel. 529
6. Verschwiegenheitsklausel. 529
7. Belehrungsklausel. 529
8. Wiedereinstellungsklausel. 530
9. Erledigungsklausel. 530
III. Form. 530
IV. Nichtigkeit. 531
1. Nichtigkeit infolge Anfechtung. 531
2. Nichtigkeit gem. § 134 BGB oder § 138 BGB. 532
V. Widerruf. 532
VI. Gleichwohlkündigung. 533
VII. Steuerrechtliche Behandlung von Abfindungszahlungen. 533
1. Steuerfreiheit von Abfindungen nach § 3 Nr. 9 EStG in der bis zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung. 534
a) Auflösung auf Veranlassung des Arbeitgebers. 534
b) Abfindung. 535
2. Steuerbegünstigung von Abfindungen gem. §§ 24, 34 EStG. 535
a) Entschädigung. 535
b) Zusammenballung. 536
c) Fünftelungsregelung. 536
3. Lohnsteueranrufungsauskunftsverfahren. 536
VIII. Muster: Aufhebungsvertrag. 537
IX. Muster: Abwicklungsvertrag. 539
D. Der Kündigungsschutzprozess. 541
§ 20 Der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten
I. Einführung. 541
1. Allgemeines. 541
2. Eigenständiger Rechtsweg. 541
3. Schiedsvertrag in Arbeitsstreitigkeiten. 542
4. Internationale Zuständigkeit. 542
5. Rechtswegzuständigkeit und Verweisung des Rechtsstreites. 543
6. Sachliche Zuständigkeit. 544
7. Einstweiliges Verfügungsverfahren. 544
8. Prozesskostenhilfeverfahren. 544
9. Wirkung der Entscheidung. 545
II. Prüfung der Rechtswegzuständigkeit. 546
1. Allgemeines. 546
2. Begriff des Arbeitnehmers. 546
3. Persönliche Abhängigkeit. 548
4. Beschäftigte in der Berufsausbildung. 549
a) Allgemeines/erfasster Personenkreis. 549
b) Schlichtungsausschüsse. 549
c) Zuständigkeit. 550
d) Anrufungsfrist. 550
5. Besondere Personengruppen. 551
6. Statusklage. 552
7. Die Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften auf die Rechtsverhältnisse arbeitnehmerähnlicher Personen. 553
8. Handelsvertreter. 553
9. Vertreter von juristischen Personen und Personengesamtheiten. 554
III. Rechtswegbesonderheiten. 556
1. Sachentscheidungsvoraussetzung. 556
2. Klagehäufung. 556
3. Die sog. sic-non-Fälle, aut-aut-Fälle und et-et-Fälle. 557
a) Sic-non-Fall. 557
b) Zusammenhangszuständigkeit nach § 2 Abs. 3 ArbGG. 559
c) Aut-aut-Fall. 561
d) Et-et-Fall. 562
e) Wahlfeststellung. 563
IV. Die örtliche Zuständigkeit. 563
1. Allgemeines. 563
2. Rugelose Einlassung. 563
3. Die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit. 564
4. Gerichtsstandsvereinbarungen. 565
5. Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden. 566
§ 21 Der Kündigungsschutzprozess im Allgemeinen
I. Einführung. 567
1. Die neue einheitliche Klagefrist. 567
2. Die Bedeutung der einheitlichen Klagefrist. 567
3. Die Ergänzung des § 5 KSchG für Fälle unverschuldeter Nichtkenntnis von der Schwangerschaft. 568
4. Fristberechnung bei behördlicher Zustimmung. 568
5. Änderungskündigung. 569
II. Punktuelle Streitgegenstandstheorie und ihre Folgen. 569
1. Allgemeines. 569
2. Folgerungen. 570
3. Der Schleppnetzantrag. 570
4. Mögliche Folgen aus der einheitlichen Klagefrist. 571
5. Klagefrist bei Anfechtung des Arbeitsvertrags durch Arbeitgeber? 571
III. Besonderheiten. 572
1. Entfristungsklage. 572
2. Kündigung durch den Insolvenzverwalter. 572
3. Andere Klagen als die Feststellungsklage nach § 4 KSchG. 572
IV Keine Unterbrechung der Verjährung eines auf Annahmeverzug gestützten Vergütungsanpruchs durch Erhebung der Kündigungsschutzklage. 573
V. Wahrung tarifvertraglicher Ausschlussfristen durch die Kündigungsschutzklage. 573
VI. Der zu verklagende Arbeitgeber. 574
VII. Die dreiwöchige Klagefrist. 575
1. Allgemeines. 575
2. Ausschlussfrist. 576
3. Fristberechnung. 576
4. Klageerhebung. 576
5. Richtige Bezeichnung des Arbeitgebers. 576
6. Inhalt der Klageschrift. 577
7. Schlüssigkeit der Kündigungsschutzklage. 577
8. Die eigenhändige Unterschrift. 578
9. Der PKH-Antrag. 578
10. Die Prüfung der Einhaltung der Klagefrist. 578
VIII. Ausnahmen vom Lauf der Drei-Wochen-Frist ab Kündigungszugang. 579
1. Fristberechnung bei nachträglicher Zustimmung der Behörde. 579
2. Die Klagefrist bei zum Wehrdienst Einberufenen und Wehrdienstleistenden. 580
3. Beginn der dreiwöchigen Klagefrist bei Besatzungsmitgliedern von Seeschiffen, Binnenschiffen und Luftfahrzeugen. 580
IX. Folgen der Versäumung der Drei-Wochen-Frist gem. § 7 KSchG. 581
X. Darlegungs- und Beweislast. 581
XI. Die gerichtliche Geltendmachung des Beschäftigungsanspruchs und des Weiterbeschäftigungsanspruchs. 583
1. Allgemeines. 583
2. Der Beschäftigungsanspruch. 583
3. Der Weiterbeschäftigungsanspruch. 583
4. Die gerichtliche Entscheidung. 584
5. Praxis. 584
6. Neue Rechtsprechung des BAG. 585
7. Betriebsübergang. 587
XII. Das klageabweisende Urteil im Kündigungsschutzprozess. 587
XIII. Das der Klage stattgebende Urteil. 588
§ 22 Die Zulassung verspäteter Klagen
I. Einführung. 589
II. Normzweck. 590
III. Voraussetzungen für die nachträgliche Zulassung. 591
1. Verspätete Klageerhebung. 591
2. Die zuzumutende Sorgfalt. 592
3. Einzelfälle zur Versäumung der Klagefrist. 592
a) Abwarten. 592
b) Arbeitgeber. 593
c) Arbeitsgericht. 593
d) Ausländische Arbeitnehmer. 593
e) Auskunftseinholung/falsche Auskunft. 594
f) Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage. 595
g) Familienangehörige. 595
h) Krankheit. 595
i) Ortsabwesenheit des Arbeitnehmers. 596
j) Verschulden des Vertreters. 597
k) Vergleichsverhandlungen. 598
IV Antrag auf nachträgliche Zulassung. 598
1. Form des Antrags. 598
2. Inhalt des Antrags. 599
3. Begründungsfrist. 599
4. Antragsfrist. 600
5. Fristberechnung. 601
6. Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 601
V. Entscheidung über den Antrag. 602
1. Zuständigkeit. 602
2. Zulässigkeit des Antrags. 602
3. Begründetheit des Antrags. 602
§ 23 Die Güteverhandlung
I. Einführung. 605
II. Die Güteverhandlung. 605
1. Vorbereitung der Güteverhandlung. 605
2. Persönliches Erscheinen. 606
3. Die Verhandlung. 606
4. Klagerücknahme. 606
5. Anerkenntnis und Verzicht. 607
6. Vergleich. 607
7. Zulässigkeitsrügen. 607
III. Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden. 608
1. Die Alleinentscheidungsbefugnis. 608
2. Die Alleinentscheidung auf Antrag beider Parteien. 608
IV Beweisbeschluss vor der streitigen Verhandlung, § 55 Abs. 4 ArbGG. 609
§ 24 Der Kammertermin
I. Einführung. 611
II. Streitige Verhandlung. 612
1. Die Aufforderung zur Klageerwiderung binnen einer angemessenen Frist 612
2. Auflage an den Kläger. 613
3. Zurückweisung verspäteten Vortrags. 613
§ 25 Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil und Abfindung
I. Einführung. 615
II. Der Auflösungsantrag. 616
1. Allgemeine Voraussetzungen des Auflösungsantrages. 616
2. Form, Inhalt und Zeitpunkt des Auflösungsantrages. 618
3. Auflösungsgründe. 620
a) Gründe für einen arbeitnehmerseitigen Auflösungsantrag. 620
b) Gründe für einen arbeitgeberseitigen Auflösungsantrag. 622
c) Auflösungsantrag beider Parteien. 625
III. Bemessungsfaktoren für die Höhe der auszuurteilenden Abfindung. 625
IV. Gerichtliche Entscheidung im Kündigungsschutzprozess mit Auflösungsantrag und Rechtsmittel. 627
V. Verhältnis zu anderen Ansprüchen. 627
VI. Streitwert. 629
§ 26 Der Kündigungsschutzprozess gegen Änderungskündigungen
I. Einführung. 631
II. Merkmale der Änderungskündigung. 632
1. Abgrenzung der Änderungskündigung von der Ausübung des Direktionsrechts. 632
2. Abgrenzung der Änderungskündigung vom Widerrufsvorbehalt. 634
3. Arten der Änderungskündigung. 634
4. Sachlicher und zeitlicher Zusammenhang von Kündigung und Änderungsangebot. 635
5. Ordentliche und außerordentliche Änderungskündigung. 636
III. Reaktionsmöglichkeiten des betroffenen Arbeitnehmers. 637
1. Vorbehaltlose Annahme des Änderungsangebotes. 637
2. Annahme unter Vorbehalt. 637
a) Form und Frist. 638
b) Inhalt. 639
3. Ablehnung. 639
4. Sonstige Einigung. 639
IV. Klageerhebung. 640
1. Anträge. 640
2. Klagefrist. 642
V. Prüfung der sozialen Rechtfertigung im Prozess. 642
1. Grundsätze der Prüfung. 642
2. Die betriebsbedingte Änderungskündigung. 643
3. Die Verhaltens- und personenbedingte Änderungskündigung. 646
VI. Prüfung der Einhaltung der Beteiligungsrechte des Betriebsrates im Prozess. 646
1. Anhörungserfordernis gem. § 102 BetrVG. 646
2. Mitbestimmungsrechte gem. §§ 99 ff. BetrVG. 647
3. Mitbestimmungsrechte gem. § 87 BetrVG. 648
VII. Prüfung sonstiger Unwirksamkeitsgründe im Prozess. 648
VIII. Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 649
IX. Streitwert. 650
§ 27 Der Kündigungsschutzprozess in der II. Instanz
I. Der Zugang zum Rechtsmittelgericht. 651
1. Statthaftigkeit der Berufung. 651
2. Beschwer. 651
a) Die formelle Beschwer. 651
b) Die Beschwer bei Auflösungsanträgen. 652
3. Das zuständige Gericht. 653
a) Das Landesarbeitsgericht als Berufungsgericht. 653
b) Die Zuständigkeitsprüfung in der Berufungsinstanz. 653
aa) Die örtliche Zuständigkeit. 653
bb) Die Zulässigkeit des Rechtswegs. 654
4. Die Einlegung der Berufung. 655
a) Anwaltszwang. 655
b) Form. 655
aa) Eigenhändig unterschriebenes Schriftstück. 655
bb) Verwendung moderner Kommunikationsmittel. 655
c) Inhalt der Berufungsschrift. 656
aa) Notwendiger Mindestinhalt. 656
bb) Beigabe einer vollständigen Urteilsabschrift. 656
cc) Berufungsanträge. 656
dd) Begründung der Berufung schon bei ihrer Einlegung. 657
d) Die Berufungsfrist. 658
aa) Dauer der Frist. 658
bb) Beginn des Fristenlaufs. 659
cc) Das Sonderproblem der Fünf-Monats-Frist des § 66 Abs. 1 S. 2 letzter Hs. ArbGG. 659
dd) Einlegung der Berufung vor Urteilszustellung innerhalb der ersten fünf Monate ab Verkündung. 661
ee) Rechtsnatur der Berufungsfrist; Wiedereinsetzung. 662
ff) Wiederholte Einlegung der Berufung. 662
e) Einlegung der Berufung und Prozesskostenhilfe. 662
5. Die Berufungsbegründung. 663
a) Die Berufungsbegründung als Zulässigkeitsvoraussetzung. 663
b) Die Frist zur Berufungsbegründung. 663
aa) Dauer der Frist. 663
bb) Fristbeginn. 663
cc) Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist auf Antrag. 664
dd) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 666
c) Inhaltliche Anforderungen an die Berufungsbegründung. 666
aa) Berufung gegen ein "Urteil ohne Gründe". 667
bb) Berufung ausschließlich wegen neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel. 668
cc) Berufung in Auseinandersetzung mit dem erstinstanzlichen Urteil 668
d) Die substantiierte Berufungsbegründung als Voraussetzung für den Erfolg. 669
6. Die Verwerfung der Berufung als unzulässig. 670
7. Keine Zurückweisung der Berufung als unbegründet durch Beschluss. 671
8. Der Eintritt des Berufungsbeklagten in das Verfahren und die Berufungsbeantwortung. 671
a) Die Zustellung der Berufungs- und Berufungsbegründungsschrift. 671
b) Die Berufungsbeantwortungsfrist und ihre Verlängerung. 672
c) Folgen der Nichteinhaltung der Berufungsbeantwortungsfrist. 672
9. Die Zulässigkeit neuen Vorbringens in der Berufungsinstanz. 673
a) Erstinstanzlich zurückgewiesene Angriffs- und Verteidigungsmittel, § 67 Abs. 1 ArbGG. 673
b) Verletzung richterlicher Schriftsatzfristen in I. Instanz, § 67 Abs. 2 ArbGG. 673
c) Verletzung allgemeiner Prozessförderungspflichten in I. Instanz, § 67 Abs. 3 ArbGG. 673
d) Aufnahme neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel in die Berufungsbegründungs- oder -beantwortungsschrift. 674
e) Verletzung richterlicher Schriftsatzfristen in II. Instanz, §§ 64 Abs. 7, 56 Abs. 2 ArbGG. 674
f) Wann wird die Erledigung des Verfahrens durch verspätetes Vorbringen verzögert? 674
II. Klageänderung, Klageerweiterung, Klagerücknahme; Berufungsrücknahme, Berufungsverzicht. 675
1. Klageänderung. 675
2. Klageerweiterung. 676
3. Der erstmals in der Berufungsinstanz gestellte Auflösungsantrag. 676
4. (Teil-)Klagerücknahme. 676
5. Berufungsrücknahme. 676
6. Berufungsverzicht. 677
III. Die Anschlussberufung. 678
IV. Der Ablauf des Berufungsverfahrens. 679
1. Der Gang des Verfahrens und seine voraussichtliche Dauer. 679
a) Die Terminierung. 679
b) Die mündliche Verhandlung vor dem Berufungsgericht. 679
c) Die voraussichtliche Dauer des Berufungsverfahrens. 680
2. Allgemeine Verfahrensgrundsätze. 680
a) Verhältnis von ArbGG zu ZPO; Verhältnis von erst- zu zweitinstanzlichem Verfahren. 680
b) Einige wichtige Besonderheiten. 681
aa) Die Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Arbeitsgericht. 681
bb) Säumnisverfahren. 681
cc) Übertragung der Entscheidung auf den Vorsitzenden. 681
dd) Vereidigung von Zeugen als Ausnahme. 682
ee) Anordnung des persönlichen Erscheinens der Parteien. 682
3. Hinweise zur Prozesssituation im Berufungsstreit um eine Kündigung. 683
4. Die gütliche Einigung im Berufungsverfahren. 683
V. Das Berufungsurteil und seine Anfechtbarkeit; Kosten und Streitwert. 684
1. Das Berufungsurteil. 684
2. Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gegen das Berufungsurteil. 684
a) Die Revision. 684
b) Die Nichtzulassungsbeschwerde und die Rechtskraft des Berufungsurteils. 685
c) Die Gehörsrüge nach § 78a ArbGG. 686
d) Die sofortige Beschwerde wegen verspäteter Absetzung des Berufungsurteils nach § 72b ArbGG. 687
3. Kosten und Streitwert. 687
VI. Besondere Verfahrensarten im Streit um eine Kündigung. 687
1. Sofortige Beschwerde im Verfahren nach § 5 KSchG. 687
2. Beschwerde im Beschlussverfahren nach § 103 BetrVG. 688
§ 28 Die Beendigung des Kündigungsschutzprozesses durch Prozessvergleich
I. Einführung. 689
II. Der Prozessvergleich. 690
1. Zustandekommen. 690
2. Inhalt. 690
a) Beendigungsart und Zeitpunkt. 691
b) Abfindung. 693
c) Lohnzahlung und weitere Durchführung des Arbeitsverhältnisses. 698
d) Urlaubsanspruch und Freistellung. 702
e) Regelungen zur Erteilung eines Zeugnisses. 706
f) Regelungen zur Erteilung von Arbeitspapieren. 707
g) Sonstige Regelungsgegenstände; große Erledigungsklausel. 708
§ 29 Die Geltendmachung von (Neben-)Ansprüchen im Kündigungsschutzprozess
I. Einführung. 711
II. Entgeltansprüche des Arbeitnehmers. 711
1. Klage auf Bruttoentgelt. 711
2. Arbeitslosengeld. 712
3. Checkliste. 712
III. Ansprüche auf Zeugniserteilung/Zeugnisberichtigung. 713
1. Arbeitszeugnis. 713
2. Geltendmachung. 715
3. Klageantrag. 715
4. Darlegungs- und Beweislast. 715
5. Zeugniserteilung nach Verurteilung. 716
6. Checkliste. 716
§ 30 Der Einstweilige Rechtsschutz
I. Einführung. 717
II. Arrest und einstweilige Verfügung. 717
1. Verfahrensrechtliche Grundlagen. 717
2. Arrest. 719
3. Einstweilige Verfügung. 720
III. Einzelfälle. 721
1. Beschäftigung und Weiterbeschäftigung. 721
a) Beschäftigungsanspruch. 721
b) Allgemeiner Weiterbeschäftigungsanspruch. 721
c) Betriebsverfassungsrechtlicher Weiterbeschäftigungsanspruch. 722
2. Arbeitsvergütung. 724
3. Wettbewerbsverbot. 726
4. Herausgabeansprüche. 728
a) Arbeitsmittel. 728
b) Dienstwagen. 728
5. Arbeitspapiere, Zeugnis. 729
IV. Antragsmuster. 731
1. Arrest. 731
2. Einstweilige Verfügung. 731
a) Betriebsverfassungsrechtlicher Weiterbeschäftigungsanspruch. 731
b) Arbeitsvergütung. 732
c) Wettbewerbsverbot. 732
d) Herausgabe eines Dienstwagens. 732
e) Arbeitspapiere, Zeugnis. 733
E. Sozialversicherungsrecht. 735
§ 31 Arbeitslosengeld I und II
I. Einführung. 735
II. Arbeitslosengeld (I). 736
1. Voraussetzungen des Anspruchs. 736
a) Arbeitslosigkeit. 737
aa) Beschäftigungslosigkeit. 737
bb) Eigenbemühungen. 738
cc) Verfügbarkeit. 740
b) Arbeitslosmeldung/Antrag. 743
c) Erfüllung der Anwartschaftszeit. 745
d) Keine Vollendung des 65. Lebensjahres. 745
2. Ruhen des Anspruchs. 746
3. Dauer des Anspruchs. 746
4. Höhe des Anspruchs. 747
a) Bemessungsentgelt. 747
b) Leistungsentgelt. 749
c) Leistungssatz. 749
5. Erlöschen des Anspruchs. 750
6. Sozialversicherungsschutz des Arbeitslosen. 750
II. Arbeitslosengeld II. 751
1. Vorbemerkung. 751
2. Voraussetzungen des Anspruchs. 753
a) Erwerbsfähigkeit. 753
b) Hilfebedürftigkeit. 754
aa) Ermittlung des Grundsicherungsbedarfs. 754
bb) Zu berücksichtigendes Einkommen und/oder Vermögen. 754
cc) Hilfe durch Dritte. 755
dd) Aufnahme einer zumutbaren Arbeit. 756
c) Bedarfsgemeinschaft. 757
d) Antrag. 758
3. Inhalt des Anspruchs: Grundsicherung. 758
a) Regelleistung zur Sicherung des Unterhalts. 759
b) Mehrbedarfe. 760
c) Angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung. 760
d) Befristeter Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld. 761
d) Sozialgeld. 761
e) Berechnung. 761
4. Verstöße gegen Mitwirkungs-/Meldeobliegenheiten. 762
a) Verstoß gegen Mitwirkungsobliegenheiten. 762
b) Verstoß gegen Meldeobliegenheiten. 763
c) Sonderregelungen. 764
d) Wirkung der Sanktionen. 764
e) Sanktionen gegenüber Beziehern von Sozialgeld. 765
5. Sozialversicherungsschutz. 765
§ 32 Sperrzeittatbestände und Ruhen
I. Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs. 767
II. Ruhenstatbestände. 767
1. Ruhen des Anspruchs bei Sperrzeit. 768
a) Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe. 768
aa) Lösen des Beschäftigungsverhältnisses. 768
bb) Anlass durch vertragswidriges Verhalten. 771
cc) Kausalität. 772
dd) Verschulden. 772
ee) Wichtiger Grund. 773
ff) Beginn und Dauer der Sperrzeit. 775
b) Sperrzeit bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung. 776
c) Weitere Sperrzeittatbestände. 776
d) Wirkung der Sperrzeit. 777
2. Ruhen des Anspruchs bei Entlassungsentschädigung. 778
a) Entlassungsentschädigung. 778
b) Maßgebliche Kündigungsfrist. 778
c) Dauer des Ruhens. 779
d) Gleichwohlgewährung. 780
3. Ruhen des Anspruchs bei Entgelt und Urlaubsabgeltung. 781
§ 33 Erstattungspflicht des Arbeitgebers
I. Einführung. 783
II. Voraussetzungen und Umfang der Erstattungspflicht. 784
1. Allgemeines. 784
2. Grundvoraussetzungen. 784
3. Befreiungstatbestände. 785
a) Kurzer Bestand des Arbeitsverhältnisses. 785
b) Kleinstunternehmen. 785
c) Arbeitnehmerkündigung ohne Abfindung. 786
d) Sozial gerechtfertigte Kündigung. 786
e) Berechtigung zur außerordentlichen Kündigung. 788
f) Personalabbau. 788
g) Unzumutbare Belastung. 789
4. Erstattungsschuldner. 789
5. Beginn und Umfang der Erstattungspflicht. 789
6. Beratung und Vorabentscheidung. 790
III. Vereinbarungen zur Vermeidung einer Erstattungspflicht. 790
F. Steuerrecht. 791
§ 34 Steuerrechtliches Umfeld der Beendigung von Arbeitsverhältnissen
I. Abfindungen wegen Auflösung des Dienstverhältnisses. 791
1. Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 9 EStG. 791
2. Steuerbegünstigung gemäß §§ 24, 34 EStG. 802
3. "Brutto=Netto"-Klauseln. 808
4. Abfindungen mit Auslandsbezug. 809
II. Karenzentschädigungen. 809
G. Aspekte der Zwangsvollstreckung. 813
§ 35 Die Zwangsvollstreckung im Kontext einer Kündigung
I. Einführung. 813
II. Rechtliche Grundlagen. 814
1. Der Ausgangspunkt der Vollstreckung aus arbeitsrechtlichen Titeln. 814
2. Die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. 815
Checkliste: Allgemeine Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. 816
a) Der vollstreckungsfähige Titel, insbesondere die vorläufige Vollstreckbarkeit. 817
aa) Der Vollstreckungstitel. 817
bb) Rechtskraft und vorläufige Vollstreckbarkeit. 817
cc) Die Bestimmtheit des Vollstreckungstitels. 825
b) Die Vollstreckungsklausel. 826
c) Die Zustellung des Vollstreckungstitels. 828
3. Die Zwangsvollstreckung aus einem Zahlungstitel. 828
a) Allgemeines zur Zwangsvollstreckung aus einem Zahlungstitel. 828
b) Die Zwangsvollstreckung aus einem Bruttolohntitel. 829
c) Die Abfindungszahlung nach §§ 9, 10 KSchG. 833
4. Die Zwangsvollstreckung aus einem Herausgabetitel. 834
a) Die Herausgabevollstreckung im Kontext einer Kündigung. 835
aa) Die Herausgabe von Arbeitspapieren. 835
bb) Die Herausgabe von Arbeitsmitteln und -geräten. 836
b) Die rechtlichen Grundlagen der Herausgabevollstreckung. 837
5. Die Zwangsvollstreckung wegen einer vertretbaren oder unvertretbaren Handlung. 838
a) Die Anwendungsfälle der Zwangsvollstreckung wegen einer vertretbaren oder unvertretbaren Handlung. 838
aa) Der Anspruch auf Entfernung einer Abmahnung aus der Personalakte. 838
bb) Der Anspruch auf Ausfüllung der Arbeitspapiere. 839
cc) Der Anspruch auf Erteilung einer Lohnabrechnung und der Abrechnung von Provisionen. 840
dd) Der Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses. 841
b) Die Grundzüge der Zwangsvollstreckung einer vertretbaren Handlung 843
c) Die Grundzüge der Zwangsvollstreckung wegen einer unvertretbaren Handlung. 844
d) Die Alternative der Verurteilung zur Zahlung einer Entschädigung nach § 61 Abs. 2 ArbGG. 846
6. Die Vollstreckung des Weiterbeschäftigungsanspruchs. 850
a) Die Vollstreckung des Weiterbeschäftigungsanspruches des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer. 850
b) Die Vollstreckung des Weiterbeschäftigungsanspruches des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber. 852
aa) Die Bestimmtheit des Titels. 852
bb) Die Unmöglichkeit der Weiterbeschäftigung. 853
cc) Der Übergang von Weiterbeschäftigungsanspruch zum Ersatzanspruch. 855
dd) Die Vollstreckung des Weiterbeschäftigungsanspruchs nach § 888 ZPO. 855
7. Die Vollstreckung einer Unterlassungsverpflichtung. 856
H. Das Mandat im Kündigungsschutzprozess. 861
§ 36 Das Mandat im Kündigungsschutzprozess
I. Einführung. 861
II. Mandatsannahme. 862
III. Sachverhaltserfassung. 864
IV. Der Umgang mit den Beteiligten des Kündigungsschutzprozesses. 867
1. Der Umgang mit den Mandanten. 867
2. Umgang mit dem Gegner und dessen Vertreter. 871
3. Umgang mit Richtern. 871
V. Vergütungsfragen. 872
VI. Verhandlungsstrategie. 874
1. Festpreis. 875
2. Basar. 876
3. Kooperation. 877
4. Risikoerhöhung. 877
VII. Haftungsfragen im kündigungsrechtlichen Mandat. 879
1. Verspätetes Handeln. 880
2. Unterbliebene Aufklärung/unterbliebene oder fehlerhafte Beratung. 880
3. Fristen. 881
VIII. Fragebogen Kündigungsschutz. 883
1. Arbeitnehmerfragebogen. 883
2. Arbeitgeberfragebogen. 884
I. Taktik und Fallstricke im Kündigungsschutzprozess. 887
§ 37 Taktik und Fallstricke für den Klägervertreter
I. Einführung. 887
II. Fristgebundene Handlungen bei Erhebung der Kündigungsschutzklage. 888
1. Zurückweisung der Kündigung gem. § 174 S. 1 BGB. 888
2. Einhaltung der Frist des § 9 MuSchG. 890
3. Wahrung des Sonderkündigungsschutzes als schwerbehinderter Mensch. 891
4. Maßnahmen bei Änderungskündigungen. 893
5. Maßnahmen bei Bestehen eines Betriebsrats. 894
6. Erhalt eines Zeugnisses. 894
III. Zeitpunkt der Klageeinreichung. 895
1. Einhaltung der Drei-Wochen-Frist. 895
2. Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Drei-Wochen-Frist. 897
IV. Inhalt der Klageschrift. 898
1. Durch die Gewährung von Prozesskostenhilfe bedingte Kündigungsschutzklage? 898
2. Klageanträge. 898
3. Klagebegründung. 899
V. Durchführung außergerichtlicher Vergleichsverhandlungen. 901
VI. Vorbereitung der Güteverhandlung. 902
1. Festlegung der Ziele. 902
2. Empfehlungen zum Verhalten des Mandanten. 905
VII. Taktik in der Güteverhandlung. 905
1. Teilnahme des Arbeitnehmers an der Güteverhandlung. 905
2. Abschluss eines Vergleiches oder Scheitern der Güteverhandlung? 908
VIII. Maßnahmen zwischen Güte- und Kammerverhandlung und Vorbereitung der Kammerverhandlung. 909
1. Verhalten des Arbeitnehmers. 909
2. Weiterbeschäftigungsantrag und arbeitgeberseitig angebotene Weiterbeschäftigungsmöglichkeit. 910
3. Ausschlussfristen. 912
a) Schriftliche Geltendmachung. 912
b) Gerichtliche Geltendmachung. 913
4. Schriftsätzliche Vorbereitung der Kammerverhandlung. 914
IX. Taktik in der Kammerverhandlung. 915
§ 38 Taktik und Fallstricke für den Beklagtenvertreter
I. Einführung. 917
II. Bestimmung des Prozessrisikos. 917
1. Einschätzung des Annahmeverzugslohnrisikos. 917
2. Bestimmung sonstiger Risiken. 920
3. Erfolgsaussichten der Verteidigung gegen die Kündigungsschutzklage. 921
III. Vorbereitung der Güteverhandlung. 923
1. Schriftliche Klageerwiderung zur Vorbereitung der Güteverhandlung. 923
2. Teilnahme des Arbeitgebers an der Güteverhandlung. 923
IV. Taktik in der Güteverhandlung. 924
V. Beratung im Anschluss an eine gescheiterte Güteverhandlung. 927
1. Ermittlung und Verdeutlichung des Risikos. 927
2. "Rücknahme" der Kündigung. 928
3. Erteilung eines Zeugnisses. 929
4. Angebot einer befristeten Weiterbeschäftigung für die Dauer des Kündigungsschutzrechtsstreits. 930
J. Kostenfragen. 933
§ 39 Gerichtskosten im Kündigungsschutzmandat
I. Einführung. 933
II. Geltende Regelung. 933
1. I. Instanz. 933
2. II. und III. Instanz. 936
§ 40 Rechtsanwalts-Vergütung im Kündigungsschutzmandat
I. Einführung. 939
II. Gegenstandswert. 941
1. Kündigungsschutzmandat. 942
2. Klagehäufung. 943
3. Allgemeiner Feststellungsantrag. 943
4. Weiterbeschäftigung. 944
5. Vergleichswert. 944
III. Anwaltsgebühren. 945
1. Die Angelegenheit. 946
2. Beratung. 948
a) Wegfall der gesetzlichen Beratungsgebühr. 948
b) Gebührenrahmen. 949
c) Erstberatung. 951
d) Anrechnung der Beratungsgebühr. 951
3. Außergerichtliche Vertretung. 951
a) Systematik. 952
b) Die Geschäftsgebühr und ihre Anrechnung. 952
c) Besondere Verfahren. 953
4. Gebühren in der I. Instanz. 954
a) Verfahrensgebühr. 954
b) Terminsgebühr. 956
c) Einigungsgebühr. 958
d) Verfahrensdifferenzgebühr. 960
5. Gebühren in der II. Instanz. 961
a) Verfahrensgebühr. 962
b) Terminsgebühr. 963
c) Einigungsgebühr. 963
d) Verfahrensdifferenzgebühr. 964
g) Verlustigerklärung des Rechtsmittels. 964
6. Gebühren in der III. Instanz. 965
a) Nichtzulassungsbeschwerde. 965
b) Revision. 965
IV. Verwaltungsverfahren. 966
§ 41 Das Kündigungsmandat aus Sicht der Rechtsschutzversicherung
I. Einführung. 967
II. Aufgaben der Rechtsschutzversicherung im Allgemeinen. 968
1. Wahrnehmung rechtlicher Interessen. 968
2. Kostentragung. 968
3. Rechtsbeziehungen im Rahmen des Rechtsschutzmandats. 969
a) Allgemeines. 969
b) Kostenerstattungs- bzw. Herausgabeansprüche der Rechtsschutzversicherung. 970
c) Aufrechnung des Rechtsanwalts mit eigenen, nicht gedeckten Gebührenansprüchen. 970
d) Auskunftsanspruch des Versicherers gegen den Rechtsanwalt. 971
III. Der Arbeits-Rechtsschutz. 971
1. Begriff, Deckungsbereich. 971
2. Rechtsschutzformen mit Arbeits-Rechtsschutz. 972
3. Rechtsschutz für Vertretungsorgane (Anstellungsverträge). 973
IV. Der Rechtsschutzfall in arbeitsrechtlichen Kündigungssachen. 974
1. Begriff, Allgemeines. 974
2. Fallgestaltungen zum Eintritt des Rechtsschutzfalls. 974
a) Eintritt des Rechtsschutzfalls bei Vorliegen einer Kündigung. 974
b) Eintritt des Rechtsschutzfalls, wenn es an einer Kündigung fehlt. 975
V. Streitpunkte aus der Rechtsschutzpraxis bei Kündigungsschutzverfahren. 976
1. Besprechungen und Korrespondenz mit der Gegenseite vor Erhebung der Kündigungsschutzklage. 976
2. Weiterbeschäftigungsanspruch. 977
3. Künftige Gehaltsansprüche im Kündigungsschutzprozess. 978
4. Einigung: Einbeziehung nicht rechtshängiger Ansprüche. 978
§ 42 Anspruchsdurchsetzung gegenüber der Rechtsschutzversicherung
I. Überblick. 979
II. Geschäftsgebühr. 979
1. Außergerichtliche/gerichtliche Vollmacht. 980
a) Muster: Vollmacht für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung. 980
b) Muster: Vollmacht für die gerichtliche Vertretung. 980
2. Anschreiben an den Arbeitgeber vor Klageerhebung. 981
a) Allgemeines. 981
b) Muster: Anschreiben an den Arbeitgeber vor Klageerhebung. 982
III. Deckungsantrag für die außergerichtliche Tätigkeit. 986
a) Allgemeines. 986
b) Muster: Deckungsantragsschreiben an die Rechtsschutzversicherung - außergerichtliche Tätigkeit. 987
IV. Deckungsantrag für die gerichtliche Tätigkeit und Kostenvorschussnote. 988
a) Allgemeines. 988
b) Muster: Deckungsantragsschreiben an die Rechtsschutzversicherung - gerichtliche Tätigkeit und Kostenvorschuss. 988
V. Weiterbeschäftigungsan
20 renommierte Arbeitsrechtsspezialisten - Rechtsanwälte und Richter - führen Sie durch den Dschungel von Rechtsprechung und Gesetzen. Das Handbuch Kündigungsrecht liefert Ihnen für alle Fragen des arbeitsrechtlichen Bestandsschutzmandates die richtige Antwort. Umfassend, praxisgerecht aufgearbeitet, sofort verwertbar und aktuell. Schon in der zweiten Auflage ein Standardwerk für die anwaltliche Praxis, das in keiner Anwaltsbibliothek fehlen darf.
Gegenüber der Vorauflage erweitert um Kapitel zu sozialversicherungsrechtlichen- und steuerrechtlichen Fragen sowie vollständig überarbeitet und aktualisiert erhalten Sie für Ihre tägliche Arbeit alles, was Sie an Spezialwissen, Praxistipps und Prozessberatungsstrategien brauchen. U. a.:
- Herangehensweise und Mandatsführung im kündigungsrechtlichen Mandat
- Wie entgeht man Haftungsfallen
- Die materiellrechtlichen Grundlagen
- Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag
- Der Kündigungsschutzprozess I. und II. Instanz
- Die Zwangsvollstreckung aus arbeitsrechtlichen Titeln
- Keine Gebühren verschenken - die gebührenrechtliche Behandlung nach RVG
- Die Abwicklung des Mandats mit der Rechtsschutzversicherung
- Steuer- und Sozialversicherungsrechtliches Umfeld
- Checklisten, Muster, Beratungshinweise, Formulierungshilfen.
Mit dem Handbuch Kündigungsrecht in der brandaktuellen zweiten Auflage auf dem Schreibtisch haben Sie den nötigen Vorsprung bei der Beratung und Vertretung Ihrer Mandanten und das ideale Hilfsmittel für Ihre tägliche Arbeit. Das Werk hat den Gesetzgebungsstand 01.06.2006.
Inhaltsverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnis. 47
Literaturverzeichnis. 55
A. Materielles Kündigungs- und Kündigungsschutzrecht. 59
§ 1 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
I. Einführung. 59
II. Die Arten der Kündigung. 59
1. Die Beendigungs- und die Änderungskündigung. 60
2. Ordentliche und außerordentliche Kündigung. 63
III. Die ordentliche Kündigung. 64
1. Person des Kündigenden. 64
2. Person des Kündigungsempfängers. 65
3. Gegenstand der Kündigung. 67
4. Form und Inhalt der Kündigung. 68
a) Form der Kündigung. 68
b) Inhalt der Kündigungserklärung. 70
5. Zeitpunkt und Zugang der Kündigung. 71
a) Zeitpunkt der Kündigung. 71
b) Zugang der Kündigungserklärung. 72
6. Kündigungsfristen und Kündigungstermine. 76
§ 2 Die außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses
I. Einführung. 81
II. Die Arten der Kündigung. 82
III. Unkündbarkeit (= Ausschluss der ordentlichen Kündigung). 82
IV. Ausschlussfrist. 83
V. Abmahnung. 84
VI. Wichtiger Grund. 84
VII. Art der Kündigungsgründe. 85
1. Betriebsbedingte Kündigung. 85
2. Personenbedingte Kündigung. 86
3. Verhaltensbedingte Kündigung. 86
VIII. Beispiele. 86
IX. Außerordentliche Arbeitnehmerkündigungen. 88
1. Einführung. 88
2. Art der Kündigungsgründe. 88
3. Beispiele. 89
X. Sonderkündigungsschutz. 89
1. Mutterschutz. 89
2. Elternzeit. 90
3. Schwerbehinderte. 90
XI. Beteiligung des Betriebsrates. 91
XII. Darlegungs- und Beweislast. 91
XIII. Sozialversicherungsrecht. 92
XIV. Muster, Checkliste. 92
1. Muster: Anhörung des Betriebsrates. 92
2. Muster: Einholung der Zustimmung des Integrationsamtes. 93
3. Muster: Antrag auf Zustimmung der Kündigung einer unter das MuSchG fallenden Arbeitnehmerin. 94
4. Muster: Außerordentliche Kündigung mit vorsorglicher ordentlicher Kündigung. 94
5. Checkliste: Außerordentliche Kündigung. 95
§ 3 Der allgemeine Kündigungsschutz nach dem KSchG
I. Überblick. 98
II. Voraussetzungen des allgemeinen Kündigungsschutzes. 103
1. Geschützter Personenkreis. 103
2. Nicht geschützte Personen. 105
3. Erfasste Betriebe. 106
a) Betriebsbegriff. 106
b) Gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen. 108
c) Mindestarbeitnehmerzahl. 110
4. Wartezeit. 113
a) Beschäftigungsdauer von mehr als sechs Monaten. 113
b) Berechnung. 114
III. Allgemeine Prinzipien zur Überprüfung von Kündigungen. 116
1. Ultima-ratio-Prinzip. 116
2. Prognoseprinzip. 116
3. Interessenabwägung. 116
IV. Betriebsbedingte Gründe. 117
1. Dringende betriebliche Erfordernisse. 118
a) Unternehmerentscheidung. 118
b) Außer- und innerbetriebliche Gründe. 120
c) Umsetzung der Unternehmerentscheidung. 122
d) Missbrauchskontrolle. 123
e) Nachvollziehbarer Arbeitskräfteüberhang. 125
f) Betriebsbezogenheit. 128
g) Wiedereinstellungsanspruch. 129
2. Fehlende Möglichkeit der Weiterbeschäftigung. 130
a) Möglichkeit der Weiterbeschäftigung in demselben Betrieb oder einem anderen Betrieb des Unternehmens. 130
aa) Freier Arbeitsplatz. 130
bb) Vergleichbarer Arbeitsplatz. 132
cc) Betrieb oder Unternehmen. 133
b) Möglichkeit der Weiterbeschäftigung nach Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen. 133
c) Möglichkeit der Weiterbeschäftigung unter geänderten Arbeitsbedingungen. 134
d) Sonstige anerkannte mildere Mittel. 135
e) Darlegungs- und Beweislast. 137
f) Vermutung dringender betrieblicher Erfordernisse bei Interessenausgleich mit Namensliste. 137
g) Druckkündigung. 141
3. Soziale Auswahl. 141
a) Betriebsbezug. 142
b) Vergleichbare Arbeitnehmer. 143
aa) Fähigkeiten und Kenntnisse. 143
bb) Arbeitsvertrag. 144
cc) Dieselbe Ebene der Betriebshierarchie. 146
c) Soziale Gesichtspunkte. 146
d) Darlegungs- und Beweislast. 148
e) Vermutung ordnungsgemäßer Sozialauswahl bei Interessenausgleich mit Namensliste. 150
f) Leistungsträgerregelung. 152
g) Kollektivrechtliche Auswahlrichtlinien. 156
V. Absolute Sozialwidrigkeitsgründe. 156
1. Erweiterter Kündigungsschutz. 156
2. Widerspruch des Betriebs- oder Personalrats. 157
VI. Personenbedingte Gründe. 157
1. Vorliegen personenbedingter Kündigungsgründe. 157
2. Allgemeine Prüfungssystematik. 158
a) Negativprognose. 158
b) Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen. 158
c) Weiterbeschäftigung auf einem freien Arbeitsplatz oder sonstige mildere Mittel. 158
d) Interessenabwägung. 158
3. Krankheit. 159
a) Dauernde Leistungsunfähigkeit. 161
b) Lang andauernde Leistungsunfähigkeit. 162
c) Häufige Kurzerkrankungen. 164
d) Krankheitsbedingte Leistungsminderung. 166
4. Alkohol- und sonstige Drogenabhängigkeit. 167
5. Arbeitserlaubnis. 167
6. Eignung. 167
7. Inhaftierung des Arbeitnehmers. 168
8. Pensionsalter. 169
9. Sicherheitsbedenken. 170
10. Straftaten im außerdienstlichen Bereich. 170
11. Minderleistung. 170
VII. Verhaltensbedingte Gründe. 171
1. Vorliegen verhaltensbedingter Kündigungsgründe. 171
2. Allgemeine Prüfungssystematik. 171
a) Arbeitspflichtverletzung. 171
b) Negative Zukunftsprognose. 171
c) Abmahnung. 172
d) Weiterbeschäftigung auf einem anderen freien Arbeitsplatz. 172
e) Interessenabwägung. 172
f) Verschulden. 173
3. Darlegungs- und Beweislast. 173
4. Fallgruppen anerkannter Arbeitspflichtverletzungen. 173
a) Alkohol- und Drogenmissbrauch. 173
b) Anzeigen und Zeugenaussagen. 174
c) Arbeitsverweigerung. 174
d) Außerbetriebliches Verhalten. 175
e) Beleidigungen. 176
f) Betriebliche Ordnung. 176
g) Fehl-, Schlecht- oder Minderleistung. 177
h) Gehaltspfändungen. 178
i) Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit. 178
j) Private Nutzung betrieblicher Telefon- und Datenverarbeitungsanlagen sowie Internetzugänge. 179
k) Sexuelle Belästigung. 181
l) Tarifliche Regelung. 181
m) Wettbewerbs- und Nebentätigkeit. 181
VIII. Abmahnung. 182
1. Überblick. 182
2. Notwendiger Inhalt der Abmahnung. 183
a) Konkrete Bezeichnung (eines) Fehlverhaltens. 183
b) Androhung arbeitsrechtlicher Konsequenzen. 184
d) Kein Formerfordernis. 185
e) Zugang der Abmahnung. 185
f) Kenntnisnahme durch Arbeitnehmer. 185
3. Zeitpunkt der Abmahnung. 185
a) Verwirkung. 186
b) Keine Geltung tarifvertraglicher Ausschlussfristen. 186
4. Wirkungslosigkeit von Abmahnungen. 186
b) Wirkungsdauer und Tilgung. 187
c) (Bewährungs-) Zeitraum zwischen Abmahnung und Kündigung. 188
5. Erforderlichkeit einer Abmahnung - Steuerbares Verhalten. 188
6. Abmahnung in Sonderfällen. 190
a) Abmahnung gegenüber Auszubildenden. 190
b) Abmahnung vor Änderungskündigung. 190
c) Keine Abmahnung bei Nichtanwendbarkeit des KSchG. 190
d) Abmahnung von Betriebs- oder Personalratsmitgliedern. 191
7. Verhältnis von Abmahnung und Kündigung. 191
a) Gleichartigkeit der Pflichtverletzungen. 191
b) Anzahl der Abmahnungen. 192
c) Kündigungsverzicht durch Abmahnungserteilung. 192
8. Beteiligung des Betriebs- oder Personalrats. 192
9. Rechtsmittel gegen Abmahnungen. 193
a) Anspruch auf Entfernung unberechtigter Abmahnungen aus der Personalakte. 193
b) Widerrufsanspruch. 194
c) Recht auf Gegendarstellung. 194
IX. Änderungskündigung. 194
1. Überblick. 194
2. Annahme, Annahme unter Vorbehalt, Ablehnung. 195
3. Prüfungssystematik. 196
4. Betriebsbedingte Änderungskündigung. 197
a) Entgeltreduzierung. 197
b) Nebenabreden. 199
c) Versetzungen. 200
d) Veränderung der Arbeitszeit. 200
5. Personenbedingte Änderungskündigung. 201
6. Verhaltensbedingte Änderungskündigung. 201
X. Muster: Kündigungsschutzklage. 202
§ 4 Anzeigepflichtige Entlassungen (sog. Massenentlassungen)
I. Einführung. 207
II. Anzeigepflicht nach § 17 Abs. 1 KSchG. 207
1. Betrieb. 208
2. Arbeitnehmer. 208
3. Entlassung. 209
4. Rahmenfrist. 213
III. Beteiligung des Betriebsrates. 213
1. Schriftliche Unterrichtung gem. § 17 Abs. 2 S. 1 KSchG. 214
2. Beratung gem. § 17 Abs. 2 S. 2 KSchG. 214
3. Einholung der Stellungnahme des Betriebsrates gem. § 17 Abs. 3 S. 2 KSchG. 215
4. Zuleitung einer Abschrift der Anzeige an den Betriebsrat gem. § 17 Abs. 3 S. 6 KSchG. 215
5. Konzernklausel gem. § 17 Abs. 3a KSchG. 215
6. Gewährleistung der Mitbestimmungsrechte gem. § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG, falls Kurzarbeit gem. § 19 Abs. 1 KSchG eingeführt wird. 215
IV. Inhalt der Anzeige gem. § 17 KSchG. 216
1. Muss-Inhalt. 216
2. Soll-Inhalt. 216
3. Schriftform. 216
V. Rechtsfolgen. 217
1. Entlassungssperre. 217
2. Entscheidung der Agentur für Arbeit. 217
3. Sperrfrist. 218
4. Freifrist. 219
5. Kurzarbeit. 220
6. Rechtsfolgen bei Fehlen der Massenentlassungsanzeige. 220
7. Rechtsfolgen der unwirksamen Massenentlassungsanzeige. 220
8. Rechtsfolgen bei nichtrechtzeitiger Massenentlassungsanzeige. 220
9. Verzicht auf den Massenentlassungsschutz. 221
VI. Massenentlassung und betriebsbedingte Kündigung. 221
VII. Sonstige Rechte der Arbeitnehmervertretungen. 221
VIII. Praktisches Vorgehen bis zur Gesetzesänderung. 221
IX. Checkliste. 222
§ 5 Abfindungsanspruch bei betriebsbedingten Kündigungen, § 1a KSchG
I. Einführung. 223
II. Anspruchsinhalt und Anspruchsvoraussetzungen. 224
1. Gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Anspruch? 224
2. Voraussetzungen des Anspruchs. 226
a) Geltung des Kündigungsschutzgesetzes. 226
b) Kündigung wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nach § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG. 227
c) Hinweis des Arbeitgebers (Angebot). 228
d) Verstreichenlassen der Klagefrist (Annahme). 229
3. Rechtsfolgen. 230
4. Einzelprobleme. 233
a) Niedrigeres Angebot. 233
b) Höheres Angebot. 234
c) Nachträgliche Zulassung der Klage (§ 5 KSchG). 235
d) Klagerücknahme im Prozess. 235
e) § 6 KSchG. 236
5. Sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen. 236
6. Steuerliche Rahmenbedingungen. 237
III. Beratungshinweise. 237
IV. Muster: Kündigung, verbunden mit einem Angebot nach § 1 a KSchG. 238
§ 6 Kündigungsschutz außerhalb des KSchG
I. Einführung. 239
II. Der allgemeine Kündigungsschutz außerhalb des KSchG. 240
1. Verfassungsrechtlicher Hintergrund. 240
2. Ansichten in der Literatur. 241
3. Die Rechtsprechung des BAG zu Kündigungen außerhalb des KSchG. 242
4. Die Rechtmäßigkeit von Kündigungen in der anwaltlichen Praxis. 246
§ 7 Sonderkündigungsschutz
I. Einführung. 249
II. Kündigungsschutz nach dem MuSchG. 249
1. Geltungsbereich und Dauer. 249
2. Voraussetzungen des Kündigungsschutzes. 250
a) Schwangerschaft. 250
b) Kündigung durch den Arbeitgeber. 251
c) Kenntnis des Arbeitgebers. 251
d) Versäumung der Mitteilungsfrist. 252
aa) Nachträgliche Mitteilung binnen zwei Wochen ab Zugang der Kündigung. 252
bb) Unverschuldet verspätete Mitteilung. 252
3. Rechtsfolge. 253
4. Ausnahme vom Kündigungsschutz. 253
a) Antrag des Arbeitgebers. 254
b) Entscheidung der Behörde. 254
III. Kündigungsschutz nach dem BErzGG. 256
1. Geltungsbereich und Dauer. 256
2. Voraussetzungen des Kündigungsschutzes. 257
a) Kündigungsschutz nach Verlangen von Elternzeit und während der Elternzeit. 257
b) Kündigungsschutz bei Teilzeitarbeit während der Elternzeit. 258
c) Kündigungsschutz bei Teilzeitarbeit ohne Elternzeit in besonderen Fällen. 258
3. Rechtsfolge. 259
4. Ausnahme vom Kündigungsschutz. 259
IV. Kündigungsschutz schwerbehinderter Arbeitnehmer. 260
1. Geltungsbereich und gesetzliche Ausnahmen. 260
2. Voraussetzungen des Kündigungsschutzes. 261
a) Schwerbehinderteneigenschaft. 261
b) Gleichgestellte. 262
c) Kenntnis des Arbeitgebers. 263
d) Präventive Maßnahmen, insbesondere betriebliches Eingliederungsmanagement. 264
3. Rechtsfolge. 265
4. Ausnahme vom Kündigungsschutz. 266
a) Ordentliche Kündigung. 266
b) Außerordentliche Kündigung. 267
5. Betriebsratsanhörung. 269
6. Rechtsmittel. 269
V. Kündigungsschutz von Betriebsratsmitgliedern und anderen Amtsinhabern. 269
1. Geltungsbereich und Dauer. 270
2. Umfang des Kündigungsschutzes. 271
a) Ordentliche Kündigung. 271
aa) Unzulässigkeit ordentlicher Kündigung. 271
bb) Ausnahme bei Betriebs- oder Betriebsteilstilllegung. 272
b) Außerordentliche Kündigung. 273
aa) Wichtiger Grund. 273
bb) Zustimmung des Betriebsrats. 274
cc) Ersetzung der Zustimmung. 275
3. Rechtsfolge. 276
VI. Sonstige Fälle besonderen Kündigungsschutzes. 276
§ 8 Kündigung im Berufsausbildungsverhältnis
I. Einführung. 277
II. Einvernehmliche Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses. 278
1. Zulässigkeit des Aufhebungsvertrages. 278
2. Form und Inhalt des Aufhebungsvertrages. 279
3. Checkliste: Aufhebungsvertrag mit Auszubildendem nach Ende der Probezeit. 280
4. Muster: Aufhebungsvereinbarung. 280
III. Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses. 281
1. Kündigung innerhalb der Probezeit. 281
a) Beginn und Ende der Probezeit. 281
b) Formelle Wirksamkeitsvoraussetzungen. 282
c) Besondere Schutzvorschriften. 282
d) Sonderfall: Kündigung vor Beginn der Berufsausbildung. 282
2. Kündigung nach Ende der Probezeit. 282
a) Kündigung aus wichtigem Grund. 283
b) Form und Inhalt. 283
c) Fristen. 284
d) Mitbestimmung/Sonderkündigungsschutz. 284
e) Güteverfahren. 284
f) Anerkannte Gründe. 285
g) Checkliste: Kündigung durch Ausbildungsbetrieb nach Ende der Probezeit. 286
§ 9 Kündigung im Arbeitskampf
I. Grundlagen. 287
1. Rechtsgrundlagen. 287
2. Begriffsbestimmung. 287
3. Parteien des Arbeitskampfes (im engeren Sinne). 288
II. Arbeitskampfmaßnahmen im engeren Sinne (Streiks und Aussperrungen). 288
1. Der Streik. 289
a) Erscheinungsformen. 289
b) Voraussetzungen des rechtmäßigen Streiks. 289
c) Folgen eines rechtmäßigen Streiks. 291
aa) Abmahnung und Kündigung wegen des Arbeitskampfes. 291
bb) Kündigung aus anderen Gründen als dem Arbeitskampf. 291
cc) Beteiligungsrechte des Betriebsrats. 292
d) Folgen eines rechtswidrigen Streiks. 292
aa) Kündigung. 292
bb) Beteiligungsrechte des Betriebsrats. 293
cc) Aussperrung als Reaktion des Arbeitgebers. 293
e) Neutralitätspflicht des Staates, Leistungen der Arbeitsförderung. 293
2. Die Aussperrung. 293
a) Suspendierende Aussperrung als Angriffsmittel (Angriffsaussperrung) 294
b) Aussperrung als Reaktion auf einen Streik (Abwehraussperrung). 294
c) Folgen rechtmäßiger Aussperrungen. 295
d) Folgen rechtswidriger Aussperrungen. 295
e) Sonderfall: Lösende Aussperrung. 295
III. Arbeitskampfmaßnahmen im weiteren Sinne (hier: Massenänderungskündigung). 296
1. Die Massenänderungskündigung des Arbeitgebers. 296
2. Massenänderungskündigung der Arbeitnehmer. 297
§ 10 Kündigung bei Betriebsübergang
I. Einführung. 299
II. Der Betriebsübergang: Begriff und Tatbestandsvoraussetzungen. 300
1. Verständnis der Norm. 300
2. Begriff der wirtschaftlichen Einheit. 300
3. Teilbetrieb. 302
4. Rechtsgeschäftlicher Übergang. 302
5. Übergang auf einen anderen Inhaber. 303
a) Tatsächliche Weiterführung der Geschäftstätigkeit erforderlich. 303
b) Abgrenzung zum Gesellschafterwechsel/share deal. 303
6. Abgrenzungstatbestände. 303
a) Funktionsnachfolge. 303
b) Betriebsstilllegung. 304
7. Rechtsfolgen - Übergang der Arbeitsverhältnisse. 305
III. Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers und Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer. 306
1. Sinn und Zweck der Neuregelung. 306
2. Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers. 306
a) Inhalt. 306
b) Form. 307
c) Fehlerhafte Unterrichtung. 308
3. Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer. 308
a) Inhalt, Adressat, Form. 308
b) Frist. 308
c) Abweichende Vereinbarung, Verzicht, Widerruf. 309
IV Die Kündigung bei Betriebsübergang. 309
1. Grundsätze. 309
2. Kündigung "wegen" Betriebsübergang. 310
3. Umgehung durch Eigenkündigung, Befristung oder Auflösungsvertrag. 310
4. Nachteilige Vereinbarungen anlässlich des Betriebsübergangs unwirksam 310
5. Die Kündigung aus anderen Gründen beim Betriebsübergang. 311
6. Sanierungskonzepte des Betriebsveräußerers/Betriebserwerbers. 311
a) Grundsätze. 311
b) Personalreduzierung beim Veräußerer wegen "Erhöhung der Verkäuflichkeit". 312
c) Kündigung nach Erwerberkonzept. 313
7. Widerspruch des Arbeitnehmers gegen den Betriebsübergang und Sozialauswahl. 313
V. Sonderkündigungsschutz beim Betriebsübergang. 314
1. Grundsätze. 314
2. Betriebsräte. 315
3. Schwerbehinderte Menschen. 315
4. Arbeitnehmer in Mutterschutz und Elternzeit. 315
5. Tariflich unkündbare Arbeitnehmer. 316
VI. Wiedereinstellungs- und/oder Vertragsfortsetzungsanspruch. 316
1. Grundsätze. 316
2. Wiedereinstellungsanspruch gegen Altarbeitgeber. 317
3. Vertragsfortsetzungsanspruch gegen den Betriebserwerber. 317
4. Wiedereinstellungsanspruch in der Insolvenz. 318
VII. Prozessuale Fragen. 318
1. Klageart. 318
2. Passivlegitimation bei Kündigungsausspruch vor Betriebsübergang. 319
3. Passivlegitimation bei Kündigungsausspruch nach Betriebsübergang. 319
4. Annahmeverzug. 319
5. Auflösungsantrag. 320
6. Darlegungs- und Beweislast. 320
7. Klagefrist. 320
§ 11 Kündigung und Unternehmensumwandlung
I. Einführung. 321
II. Arten der Umwandlung. 321
III. Kündigungsschutz bei Umwandlungen. 322
1. Umwandlungsrecht und Betriebsübergang. 322
a) Grundsätze. 322
b) Sonderfall: Widerspruch des Arbeitnehmers bei Verschmelzung/Aufspaltung. 322
2. Kündigungsrechtliche Stellung der Arbeitnehmer bei Umwandlungen. 323
3. Kündigungsschutz im Gemeinschaftsbetrieb. 324
§ 12 Mitbestimmung bei Kündigungen
I. Einführung. 325
II. Die Beteiligung des Betriebsrats bei Kündigungen nach § 102 Abs. 1 BetrVG 326
1. Geltungs- und Anwendungsbereich, Abgrenzungen. 326
2. Gegenstand des Anhörungsverfahrens. 333
a) Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. 333
b) Sonstige Beendigungstatbestände. 335
3. Das Anhörungsverfahren - Überblick und Grundsätze. 336
a) Sinn und Zweck und Beteiligungsart. 337
b) Kündigungsfreiheit und Verzicht. 337
4. Einleitung des Verfahrens. 338
a) Form der Mitteilung. 338
b) Mitteilungsfrist. 339
c) Adressat (der "richtige" Betriebsrat). 340
5. Inhalt der Anhörungsmitteilung. 342
a) Grundsätze und Grenzen. 342
aa) Kenntnis des Betriebsrats. 342
bb) Kenntnis des Arbeitnehmers. 342
cc) Datenschutz. 342
b) Art der Kündigung und Kündigungsabsicht. 343
c) Kündigungsfrist, Kündigungszeitpunkt und Kündigungstermin. 343
d) Person des Arbeitnehmers/Sozialdaten. 343
e) Kündigungsgründe - Allgemeines und Grundsatz der subjektiven Determination. 344
f) Personenbedingte Kündigung. 345
g) Verhaltensbedingte Kündigung. 346
h) Betriebsbedingte Kündigung. 347
i) Änderungskündigung. 349
j) Verdachtskündigung. 349
k) Arbeitnehmer ohne Kündigungsschutz. 350
l) Außerordentliche Kündigung. 350
m) Nachschieben von Kündigungsgründen. 351
n) Checkliste "Allgemeiner Mindestinhalt". 352
6. Durchführung des Verfahrens. 352
7. Abschluss des Verfahrens. 353
a) Reaktion des Betriebsrats bei der ordentlichen Kündigung. 353
aa) Bedenken. 354
bb) Widerspruch. 354
cc) Zustimmung und Verzicht. 354
b) Reaktion bei der außerordentlichen Kündigung. 355
aa) Bedenken. 355
bb) Zustimmung und Verzicht. 356
c) Fristabreden. 356
d) Änderung und Aufhebung der Stellungnahme. 356
e) Checkliste. 357
8. Das Widerspruchsrecht des Betriebsrats - Inhalt, Ausübung und Wirkungen. 357
a) Frist. 358
b) Form. 358
c) Inhalt. 359
aa) Soziale Gesichtspunkte. 359
bb) Verstoß gegen Auswahlrichtlinie. 359
cc) Weiterbeschäftigungsmöglichkeit zu gleichen Bedingungen. 360
dd) Weiterbeschäftigungsmöglichkeit nach Fortbildung oder Umschulung. 360
ee) Weiterbeschäftigungsmöglichkeit zu geänderten Bedingungen. 360
d) Änderungskündigung. 361
e) Außerordentliche Kündigung. 361
f) Rechtsfolgen des Widerspruchs. 362
g) Checkliste. 362
9. Die Kündigung nach Verfahrensabschluss. 362
10. Mängel des Anhörungsverfahrens. 363
11. Rechtsfolgen der Mängel des Anhörungsverfahrens. 365
a) Verstoß gegen BetrVG. 365
b) Unwirksamkeit der Kündigung an sich. 365
c) Verwertungsverbot ("Nachschieben von Gründen"). 367
d) Auflösungsantrag § 9 KSchG. 370
e) Checkliste. 370
III. Die Beteiligung des Betriebsrats bei Kündigungen nach § 102 Abs. 6 BetrVG 370
IV. Die Beteiligung des Betriebsrats nach dem KSchG gem. § 102 Abs. 7 BetrVG 371
V. Die Beteiligung des Betriebsrats nach § 103 BetrVG. 371
§ 13 Der Weiterbeschäftigungsanspruch des Arbeitnehmers
I. Einführung. 375
II. Der gesetzliche Weiterbeschäftigungsanspruch gem. § 102 Abs. 5 BetrVG/§ 79 Abs. 2 BPersVG. 375
1. Voraussetzungen des Weiterbeschäftigungsanspruchs gem. § 102 Abs. 5 BetrVG. 376
a) Kündigung des Arbeitgebers. 376
b) Widerspruch des Betriebsrats. 377
c) Erhebung der Kündigungsschutzklage. 377
d) Verlangen nach Weiterbeschäftigung. 377
2. Anspruchsinhalt. 378
3. Beendigung des Weiterbeschäftigungsanspruches. 379
a) Entbindung des Arbeitgebers von der Weiterbeschäftigungspflicht. 379
aa) Mangelnde Erfolgsaussicht der Klage. 379
bb) Mutwilligkeit der Klage. 379
cc) Unzumutbare wirtschaftliche Belastung. 380
dd) Offensichtlich unbegründeter Widerspruch des Betriebsrats. 380
ee) Verfahren. 380
b) Sonstige Beendigungsgründe. 380
4. Rechtsfolgen der Entbindung und Rückabwicklung. 381
5. Anspruchsdurchsetzung. 382
6. Der gesetzliche Weiterbeschäftigungsanspruch gem. § 79 Abs. 2 BPersVG 382
7. Checkliste. 382
III. Der allgemeine Weiterbeschäftigungsanspruch. 383
1. Voraussetzungen. 383
a) Beendigungstatbestand. 384
b) Interessenabwägung. 384
aa) Zeitraum nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum ersten der Kündigungsschutzklage stattgebenden Urteil. 384
bb) Zeitraum nach stattgebendem Instanzurteil bis zu einem abweisenden Instanzurteil oder bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss. 385
cc) Zeitraum nach klageabweisendem Instanzurteil bis zu einem stattgebenden Urteil oder bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss. 385
dd) Abwägung bei offensichtlich unwirksamer Kündigung. 385
ee) Abwägung bei besonderem Beschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers. 386
2. Beendigung des allgemeinen Weiterbeschäftigungsanspruches. 386
3. Anspruchsinhalt und Rückabwicklung. 387
a) Erzwungene Weiterbeschäftigung. 388
b) Vereinbarte Weiterbeschäftigung. 388
4. Anspruchsdurchsetzung. 389
5. Böswilliges Unterlassen anderweitigen Erwerbes und Schriftform gem. § 14 Abs. 4 TzBfG. 390
6. Checkliste. 392
§ 14 Die Kündigung von Organen (AG-Vorstand und GmbH-Geschäftsführer)
I. Einführung. 393
II. Einleitende Fragestellungen. 394
1. Koppelung von Amt und Dienstvertrag. 394
2. Abmahnung. 395
3. Begründungspflicht. 395
4. Fristen. 395
5. Sonstige Beendigungstatbestände. 396
6. Zuständigkeiten. 396
7. Vertretungsbefugnis. 398
III. Kündigung von Vorstandsmitgliedern der AG. 399
1. Ordentliche Kündigung. 399
2. Außerordentliche Kündigung. 399
3. Kündigung durch das Vorstandsmitglied. 400
IV. Kündigung von Geschäftsführern der GmbH. 401
1. Ordentliche Kündigung. 401
2. Außerordentliche Kündigung. 401
3. Kündigung durch den Geschäftsführer. 402
V Rechtsfolgen und Fragen bei Beendigung der Stellung als Vorstand/Geschäftsführer. 402
VI. Arbeitsrechtliche Aspekte. 404
1. Vertretungsberechtigtes Organ und Arbeitnehmereigenschaft. 404
2. Umwandlung des Dienstverhältnisses in ein Arbeitsverhältnis, insbesondere die Weiterbeschäftigung nach Aufgabe der Organstellung. 405
3. Drittanstellungen. 405
4. Ruhen des Arbeitsverhältnisses. 406
5. Die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes auf vertretungsberechtigte Organe. 407
VII. Checkliste. 408
§ 15 Kündigung und Insolvenz
I. Einführung. 409
1. Die Zielsetzung des Insolvenzverfahrens. 409
2. Eröffnungs- und eröffnetes Verfahren. 410
a) "Eröffnungs-" oder "Antragsverfahren" (sog. "vorläufiges Insolvenzverfahren"). 410
b) Eröffnetes Verfahren. 413
aa) Forderungen, die vor dem Eröffnungsbeschluss entstanden sind. 413
bb) Forderungen, die nach dem Eröffnungsbeschluss entstanden sind. 414
II. Kündigungsrecht in der Eröffnungsphase. 414
1. Kündigung durch wen? 415
2. Freistellung. 416
3. Der Insolvenzgeldanspruch des Arbeitnehmers. 417
a) Rechtsgrundlagen. 417
b) Anspruchsberechtigter Personenkreis. 417
c) Weitere Anspruchsvoraussetzungen. 418
d) Inhalt und Umfang des Anspruchs. 419
e) Ausschlussfrist. 420
f) EU-Richtlinie zum Insolvenzgeld und ihre Umsetzung in Deutschland 420
g) Vorschuss und Vorfinanzierung von Insolvenzgeld. 421
aa) Die Vorschussregelung des § 186 SGB III. 421
bb) "Vorfinanzierung" von Insolvenzgeld gem. § 188 Abs. 4 SGB III. 422
h) Begrenzung des Insolvenzgeldes. 422
i) Prozessuales. 423
III. Kündigungsrecht und sonstige Gestaltungsrechte im eröffneten Verfahren. 423
1. Die einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften der InsO. 423
2. Individualarbeitsrecht. 424
a) Verkürzte Kündigungsfrist des § 113 Abs. 1 S. 2 InsO. 424
b) Nachkündigung durch den Insolvenzverwalter. 425
c) Kündigungsschutzklage. 426
d) Anmeldung von Kurzarbeit gem. §§ 169 ff. SGB III. 426
e) Freistellung und Weiterbeschäftigungsanspruch. 426
3. Kollektivarbeitsrecht. 427
a) Kündigung von Betriebsvereinbarungen gem. § 120 InsO. 427
b) Betriebsänderung und Sozialplanansprüche unter der Geltung der Insolvenzordnung. 427
IV Betriebsveräußerung unter der Geltung der Insolvenzordnung (§ 128 InsO). 430
V Sanierung durch AufTang- und Transfergesellschaften, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften (BQG). 431
1. Einleitung. 431
2. Rechtliche Struktur. 432
a) Übergang der Beschäftigungsverhältnisse auf die BQG. 432
aa) alter Arbeitgeber/Arbeitnehmer. 433
bb) Arbeitnehmer/BQG. 433
cc) alter Arbeitgeber/BQG. 434
b) Kein Betriebsübergang auf die BQG nach § 613a BGB. 435
c) Fortführung der Geschäftstätigkeit durch die Auffanggesellschaft. 435
3. Wirksamkeit der Gestaltung. 435
4. Allgemeine Aufklärungs- und Unterrichtungspflichten nach § 613a Abs. 5 BGB. 437
VI. Arbeitnehmeransprüche im massearmen Verfahren. 438
VII. Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz. 439
VIII. Internationales Insolvenzarbeitsrecht. 440
1. Hauptverwaltungssitz innerhalb der EU. 440
2. Hauptverwaltungssitz außerhalb der EU. 441
IX. Fazit. 441
X. Muster. 442
1. Vorläufiges Insolvenzverfahren: Bestellung eines sog. "schwachen" vorläufigen Insolvenzverwalters. 442
2. Vorläufiges Insolvenzverfahren: Bestellung eines sog. "starken" vorläufigen Insolvenzverwalters. 443
3. Sonderermächtigung des "schwachen" vorläufigen Verwalters zum Abschluss von Verträgen zu Lasten der künftigen Insolvenzmasse. 444
4. Übertragung der Arbeitgeberfunktion auf den vorläufigen "schwachen" Insolvenzverwalter. 445
5. Eröffnungsbeschluss. 446
§ 16 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
I. Ausgangspunkt. 447
II. Fragen der Vertragsgestaltung. 449
III. Pflichten aus dem Wettbewerbsverbot und Sanktionen. 450
1. Pflichten des Arbeitnehmers. 450
2. Pflichten des Arbeitgebers. 453
IV. Die Karenzentschädigung. 453
V. Das "fehlerhafte Wettbewerbsverbot". 454
1. Mangel der Schriftform, § 74 Abs. 1 HGB. 454
2. Mängel im Zusammenhang mit der Karenzentschädigung, §§ 74 Abs. 2, 75d HGB. 454
3. Mangel des berechtigten geschäftlichen Interesses, § 74a Abs. 1 S. 1 HGB 456
4. Unbillige Erschwernis, § 74a Abs. 1 S. 2 HGB. 458
5. Zeitliche Überdehnung, § 74a Abs. 1 S. 3 HGB. 458
6. Bedingte Wettbewerbsverbote/Wettbewerbsverbote mit Wahlrecht. 459
7. Nichtige Wettbewerbsverbote. 459
VI. Loslösung von rechtmäßigen Wettbewerbsverboten. 460
1. Verzicht gem. § 75a HGB. 460
2. Außerordentliche Kündigung durch den Arbeitnehmer, § 75 Abs. 1 HGB 464
3. Außerordentliche Kündigung des Arbeitgebers, § 75 Abs. 3 HGB. 465
4. Lösung des Wettbewerbsverbots bei ordentlicher Kündigung des Arbeitgebers, § 75 Abs. 2 HGB. 466
5. Einvernehmliche Aufhebung des Wettbewerbsverbotes/vertragliche Erweiterung der gesetzlichen Lösungsrechte. 467
VII. Muster. 467
1. Wettbewerbsverbotsklausel. 467
2. Fristsetzung zur Unterlassung des Wettbewerbes. 468
3. Rücktritt vom Wettbewerbsverbot. 468
4. Verzichtserklärung gem. § 75a HGB. 468
B. Befristung und auflösende Bedingung. 469
§ 17 Beendigung durch Befristung
I. Überblick. 469
II. Allgemeine Regeln zur wirksamen Befristung nach dem TzBfG. 471
1. Schriftform. 471
2. Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses. 472
3. Kündigung. 474
4. Entfristungsklage. 474
5. Befristung und Schwangerschaft. 478
6. Maßgeblicher Überprüfungszeitzeitpunkt. 479
7. Nachträgliche Befristung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses. 480
8. Keine Angabe des Befristungsgrundes und/oder der Rechtsgrundlage. 480
9. Befristung einzelner Arbeitsbedingungen. 482
10. Keine sachliche Rechtfertigung der Befristungsdauer. 483
11. Befristung in Kleinbetrieben, während der Wartezeit und bei leitenden Angestellten. 483
12. Befristungen mit Leiharbeitnehmern. 484
III. Sachgrundlose Befristungen nach dem TzBfG. 484
1. Maximal vier Befristungen in zwei Jahren. 485
2. Neueinstellung. 486
3. Befristete Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben. 488
4. Erleichterung befristeter Einstellungen für Unternehmensneugründungen 490
a) Unternehmensneugründung. 490
b) Sachgrundlose Befristung bis zur Dauer von vier Jahren. 491
c) Neueinstellung. 492
5. Tariföffnungsklausel. 493
IV. Sachgrundbefristungen nach dem TzBfG. 493
1. Allgemeines. 493
2. Die Fallgruppen des § 14 Abs. 1 S. 2 TzBfG. 493
a) Nr. 1 - Vorübergehender Arbeitskräftebedarf. 493
b) Nr. 2 - Erstanstellung im Anschluss an Ausbildung oder Studium. 495
c) Nr. 3 - Vertretung. 496
aa) Allgemeine Grundsätze. 497
bb) Elternzeitvertretung. 500
d) Nr. 4 - Eigenart der Arbeitsleistung. 500
e) Nr. 5 - Erprobung. 501
f) Nr. 6 - Gründe in der Person des Arbeitnehmers. 502
aa) Soziale Überbrückung. 502
bb) Befristung auf eigenen Wunsch. 503
cc) Arbeitserlaubnis und sonstige Einstellungs- und Beschäftigungsvoraussetzungen. 503
dd) Ausbildung. 505
ee) Studenten. 506
ff) Altersgrenze. 506
g) Nr. 7 - Haushaltsrechtliche Gründe. 507
h) Nr. 8 - Gerichtlicher Vergleich. 509
i) Sonstige sachliche Gründe. 510
V. Beteiligung des Betriebs- oder Personalrats beim Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen. 511
1. Mitbestimmungsrecht des Personalrates. 511
a) Mitbestimmungsrecht bei Einstellung. 511
b) Mitbestimmungsrecht bei Befristung. 512
2. Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. 513
VI. Musterentfristungsklage. 515
§ 18 Beendigung durch auflösende Bedingung
I. Überblick. 519
II. Sachgrundbefristungen. 519
1. Allgemeines. 519
2. Schriftform. 520
3. Klage. 520
4. Einzelne Sachgründe nach § 14 Abs. 1 S. 2 TzBfG. 521
a) Nr. 1 - Vorübergehender Arbeitskräftebedarf. 521
b) Nr. 2 - Erstanstellung im Anschluss an Ausbildung oder Studium. 521
c) Nr. 3 - Vertretung. 521
d) Nr. 4 - Eigenart der Arbeitsleistung. 521
e) Nr. 5 - Erprobung. 522
f) Nr. 6 - Gründe in der Person des Arbeitnehmers. 522
g) Nr. 7 - Haushaltsrechtliche Gründe. 523
h) Nr. 8 - Gerichtlicher Vergleich. 523
5. Sonstige Gründe. 523
6. Kein Eingreifen sonstiger Unwirksamkeitsgründe. 524
7. Rechtsfolgen unwirksamer auflösender Bedingungen. 524
C. Abwicklungs- und Aufhebungsvertrag. 525
§ 19 Abwicklungs- und Aufhebungsvertrag
I. Einführung. 525
II. Inhaltliche Ausgestaltung. 525
1. Beendigungsklausel. 526
2. Abfindungsklausel. 527
3. Abwicklungsklausel. 527
4. Freistellungsklausel. 528
5. Zeugnisklausel. 529
6. Verschwiegenheitsklausel. 529
7. Belehrungsklausel. 529
8. Wiedereinstellungsklausel. 530
9. Erledigungsklausel. 530
III. Form. 530
IV. Nichtigkeit. 531
1. Nichtigkeit infolge Anfechtung. 531
2. Nichtigkeit gem. § 134 BGB oder § 138 BGB. 532
V. Widerruf. 532
VI. Gleichwohlkündigung. 533
VII. Steuerrechtliche Behandlung von Abfindungszahlungen. 533
1. Steuerfreiheit von Abfindungen nach § 3 Nr. 9 EStG in der bis zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung. 534
a) Auflösung auf Veranlassung des Arbeitgebers. 534
b) Abfindung. 535
2. Steuerbegünstigung von Abfindungen gem. §§ 24, 34 EStG. 535
a) Entschädigung. 535
b) Zusammenballung. 536
c) Fünftelungsregelung. 536
3. Lohnsteueranrufungsauskunftsverfahren. 536
VIII. Muster: Aufhebungsvertrag. 537
IX. Muster: Abwicklungsvertrag. 539
D. Der Kündigungsschutzprozess. 541
§ 20 Der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten
I. Einführung. 541
1. Allgemeines. 541
2. Eigenständiger Rechtsweg. 541
3. Schiedsvertrag in Arbeitsstreitigkeiten. 542
4. Internationale Zuständigkeit. 542
5. Rechtswegzuständigkeit und Verweisung des Rechtsstreites. 543
6. Sachliche Zuständigkeit. 544
7. Einstweiliges Verfügungsverfahren. 544
8. Prozesskostenhilfeverfahren. 544
9. Wirkung der Entscheidung. 545
II. Prüfung der Rechtswegzuständigkeit. 546
1. Allgemeines. 546
2. Begriff des Arbeitnehmers. 546
3. Persönliche Abhängigkeit. 548
4. Beschäftigte in der Berufsausbildung. 549
a) Allgemeines/erfasster Personenkreis. 549
b) Schlichtungsausschüsse. 549
c) Zuständigkeit. 550
d) Anrufungsfrist. 550
5. Besondere Personengruppen. 551
6. Statusklage. 552
7. Die Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften auf die Rechtsverhältnisse arbeitnehmerähnlicher Personen. 553
8. Handelsvertreter. 553
9. Vertreter von juristischen Personen und Personengesamtheiten. 554
III. Rechtswegbesonderheiten. 556
1. Sachentscheidungsvoraussetzung. 556
2. Klagehäufung. 556
3. Die sog. sic-non-Fälle, aut-aut-Fälle und et-et-Fälle. 557
a) Sic-non-Fall. 557
b) Zusammenhangszuständigkeit nach § 2 Abs. 3 ArbGG. 559
c) Aut-aut-Fall. 561
d) Et-et-Fall. 562
e) Wahlfeststellung. 563
IV. Die örtliche Zuständigkeit. 563
1. Allgemeines. 563
2. Rugelose Einlassung. 563
3. Die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit. 564
4. Gerichtsstandsvereinbarungen. 565
5. Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden. 566
§ 21 Der Kündigungsschutzprozess im Allgemeinen
I. Einführung. 567
1. Die neue einheitliche Klagefrist. 567
2. Die Bedeutung der einheitlichen Klagefrist. 567
3. Die Ergänzung des § 5 KSchG für Fälle unverschuldeter Nichtkenntnis von der Schwangerschaft. 568
4. Fristberechnung bei behördlicher Zustimmung. 568
5. Änderungskündigung. 569
II. Punktuelle Streitgegenstandstheorie und ihre Folgen. 569
1. Allgemeines. 569
2. Folgerungen. 570
3. Der Schleppnetzantrag. 570
4. Mögliche Folgen aus der einheitlichen Klagefrist. 571
5. Klagefrist bei Anfechtung des Arbeitsvertrags durch Arbeitgeber? 571
III. Besonderheiten. 572
1. Entfristungsklage. 572
2. Kündigung durch den Insolvenzverwalter. 572
3. Andere Klagen als die Feststellungsklage nach § 4 KSchG. 572
IV Keine Unterbrechung der Verjährung eines auf Annahmeverzug gestützten Vergütungsanpruchs durch Erhebung der Kündigungsschutzklage. 573
V. Wahrung tarifvertraglicher Ausschlussfristen durch die Kündigungsschutzklage. 573
VI. Der zu verklagende Arbeitgeber. 574
VII. Die dreiwöchige Klagefrist. 575
1. Allgemeines. 575
2. Ausschlussfrist. 576
3. Fristberechnung. 576
4. Klageerhebung. 576
5. Richtige Bezeichnung des Arbeitgebers. 576
6. Inhalt der Klageschrift. 577
7. Schlüssigkeit der Kündigungsschutzklage. 577
8. Die eigenhändige Unterschrift. 578
9. Der PKH-Antrag. 578
10. Die Prüfung der Einhaltung der Klagefrist. 578
VIII. Ausnahmen vom Lauf der Drei-Wochen-Frist ab Kündigungszugang. 579
1. Fristberechnung bei nachträglicher Zustimmung der Behörde. 579
2. Die Klagefrist bei zum Wehrdienst Einberufenen und Wehrdienstleistenden. 580
3. Beginn der dreiwöchigen Klagefrist bei Besatzungsmitgliedern von Seeschiffen, Binnenschiffen und Luftfahrzeugen. 580
IX. Folgen der Versäumung der Drei-Wochen-Frist gem. § 7 KSchG. 581
X. Darlegungs- und Beweislast. 581
XI. Die gerichtliche Geltendmachung des Beschäftigungsanspruchs und des Weiterbeschäftigungsanspruchs. 583
1. Allgemeines. 583
2. Der Beschäftigungsanspruch. 583
3. Der Weiterbeschäftigungsanspruch. 583
4. Die gerichtliche Entscheidung. 584
5. Praxis. 584
6. Neue Rechtsprechung des BAG. 585
7. Betriebsübergang. 587
XII. Das klageabweisende Urteil im Kündigungsschutzprozess. 587
XIII. Das der Klage stattgebende Urteil. 588
§ 22 Die Zulassung verspäteter Klagen
I. Einführung. 589
II. Normzweck. 590
III. Voraussetzungen für die nachträgliche Zulassung. 591
1. Verspätete Klageerhebung. 591
2. Die zuzumutende Sorgfalt. 592
3. Einzelfälle zur Versäumung der Klagefrist. 592
a) Abwarten. 592
b) Arbeitgeber. 593
c) Arbeitsgericht. 593
d) Ausländische Arbeitnehmer. 593
e) Auskunftseinholung/falsche Auskunft. 594
f) Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage. 595
g) Familienangehörige. 595
h) Krankheit. 595
i) Ortsabwesenheit des Arbeitnehmers. 596
j) Verschulden des Vertreters. 597
k) Vergleichsverhandlungen. 598
IV Antrag auf nachträgliche Zulassung. 598
1. Form des Antrags. 598
2. Inhalt des Antrags. 599
3. Begründungsfrist. 599
4. Antragsfrist. 600
5. Fristberechnung. 601
6. Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 601
V. Entscheidung über den Antrag. 602
1. Zuständigkeit. 602
2. Zulässigkeit des Antrags. 602
3. Begründetheit des Antrags. 602
§ 23 Die Güteverhandlung
I. Einführung. 605
II. Die Güteverhandlung. 605
1. Vorbereitung der Güteverhandlung. 605
2. Persönliches Erscheinen. 606
3. Die Verhandlung. 606
4. Klagerücknahme. 606
5. Anerkenntnis und Verzicht. 607
6. Vergleich. 607
7. Zulässigkeitsrügen. 607
III. Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden. 608
1. Die Alleinentscheidungsbefugnis. 608
2. Die Alleinentscheidung auf Antrag beider Parteien. 608
IV Beweisbeschluss vor der streitigen Verhandlung, § 55 Abs. 4 ArbGG. 609
§ 24 Der Kammertermin
I. Einführung. 611
II. Streitige Verhandlung. 612
1. Die Aufforderung zur Klageerwiderung binnen einer angemessenen Frist 612
2. Auflage an den Kläger. 613
3. Zurückweisung verspäteten Vortrags. 613
§ 25 Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil und Abfindung
I. Einführung. 615
II. Der Auflösungsantrag. 616
1. Allgemeine Voraussetzungen des Auflösungsantrages. 616
2. Form, Inhalt und Zeitpunkt des Auflösungsantrages. 618
3. Auflösungsgründe. 620
a) Gründe für einen arbeitnehmerseitigen Auflösungsantrag. 620
b) Gründe für einen arbeitgeberseitigen Auflösungsantrag. 622
c) Auflösungsantrag beider Parteien. 625
III. Bemessungsfaktoren für die Höhe der auszuurteilenden Abfindung. 625
IV. Gerichtliche Entscheidung im Kündigungsschutzprozess mit Auflösungsantrag und Rechtsmittel. 627
V. Verhältnis zu anderen Ansprüchen. 627
VI. Streitwert. 629
§ 26 Der Kündigungsschutzprozess gegen Änderungskündigungen
I. Einführung. 631
II. Merkmale der Änderungskündigung. 632
1. Abgrenzung der Änderungskündigung von der Ausübung des Direktionsrechts. 632
2. Abgrenzung der Änderungskündigung vom Widerrufsvorbehalt. 634
3. Arten der Änderungskündigung. 634
4. Sachlicher und zeitlicher Zusammenhang von Kündigung und Änderungsangebot. 635
5. Ordentliche und außerordentliche Änderungskündigung. 636
III. Reaktionsmöglichkeiten des betroffenen Arbeitnehmers. 637
1. Vorbehaltlose Annahme des Änderungsangebotes. 637
2. Annahme unter Vorbehalt. 637
a) Form und Frist. 638
b) Inhalt. 639
3. Ablehnung. 639
4. Sonstige Einigung. 639
IV. Klageerhebung. 640
1. Anträge. 640
2. Klagefrist. 642
V. Prüfung der sozialen Rechtfertigung im Prozess. 642
1. Grundsätze der Prüfung. 642
2. Die betriebsbedingte Änderungskündigung. 643
3. Die Verhaltens- und personenbedingte Änderungskündigung. 646
VI. Prüfung der Einhaltung der Beteiligungsrechte des Betriebsrates im Prozess. 646
1. Anhörungserfordernis gem. § 102 BetrVG. 646
2. Mitbestimmungsrechte gem. §§ 99 ff. BetrVG. 647
3. Mitbestimmungsrechte gem. § 87 BetrVG. 648
VII. Prüfung sonstiger Unwirksamkeitsgründe im Prozess. 648
VIII. Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 649
IX. Streitwert. 650
§ 27 Der Kündigungsschutzprozess in der II. Instanz
I. Der Zugang zum Rechtsmittelgericht. 651
1. Statthaftigkeit der Berufung. 651
2. Beschwer. 651
a) Die formelle Beschwer. 651
b) Die Beschwer bei Auflösungsanträgen. 652
3. Das zuständige Gericht. 653
a) Das Landesarbeitsgericht als Berufungsgericht. 653
b) Die Zuständigkeitsprüfung in der Berufungsinstanz. 653
aa) Die örtliche Zuständigkeit. 653
bb) Die Zulässigkeit des Rechtswegs. 654
4. Die Einlegung der Berufung. 655
a) Anwaltszwang. 655
b) Form. 655
aa) Eigenhändig unterschriebenes Schriftstück. 655
bb) Verwendung moderner Kommunikationsmittel. 655
c) Inhalt der Berufungsschrift. 656
aa) Notwendiger Mindestinhalt. 656
bb) Beigabe einer vollständigen Urteilsabschrift. 656
cc) Berufungsanträge. 656
dd) Begründung der Berufung schon bei ihrer Einlegung. 657
d) Die Berufungsfrist. 658
aa) Dauer der Frist. 658
bb) Beginn des Fristenlaufs. 659
cc) Das Sonderproblem der Fünf-Monats-Frist des § 66 Abs. 1 S. 2 letzter Hs. ArbGG. 659
dd) Einlegung der Berufung vor Urteilszustellung innerhalb der ersten fünf Monate ab Verkündung. 661
ee) Rechtsnatur der Berufungsfrist; Wiedereinsetzung. 662
ff) Wiederholte Einlegung der Berufung. 662
e) Einlegung der Berufung und Prozesskostenhilfe. 662
5. Die Berufungsbegründung. 663
a) Die Berufungsbegründung als Zulässigkeitsvoraussetzung. 663
b) Die Frist zur Berufungsbegründung. 663
aa) Dauer der Frist. 663
bb) Fristbeginn. 663
cc) Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist auf Antrag. 664
dd) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 666
c) Inhaltliche Anforderungen an die Berufungsbegründung. 666
aa) Berufung gegen ein "Urteil ohne Gründe". 667
bb) Berufung ausschließlich wegen neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel. 668
cc) Berufung in Auseinandersetzung mit dem erstinstanzlichen Urteil 668
d) Die substantiierte Berufungsbegründung als Voraussetzung für den Erfolg. 669
6. Die Verwerfung der Berufung als unzulässig. 670
7. Keine Zurückweisung der Berufung als unbegründet durch Beschluss. 671
8. Der Eintritt des Berufungsbeklagten in das Verfahren und die Berufungsbeantwortung. 671
a) Die Zustellung der Berufungs- und Berufungsbegründungsschrift. 671
b) Die Berufungsbeantwortungsfrist und ihre Verlängerung. 672
c) Folgen der Nichteinhaltung der Berufungsbeantwortungsfrist. 672
9. Die Zulässigkeit neuen Vorbringens in der Berufungsinstanz. 673
a) Erstinstanzlich zurückgewiesene Angriffs- und Verteidigungsmittel, § 67 Abs. 1 ArbGG. 673
b) Verletzung richterlicher Schriftsatzfristen in I. Instanz, § 67 Abs. 2 ArbGG. 673
c) Verletzung allgemeiner Prozessförderungspflichten in I. Instanz, § 67 Abs. 3 ArbGG. 673
d) Aufnahme neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel in die Berufungsbegründungs- oder -beantwortungsschrift. 674
e) Verletzung richterlicher Schriftsatzfristen in II. Instanz, §§ 64 Abs. 7, 56 Abs. 2 ArbGG. 674
f) Wann wird die Erledigung des Verfahrens durch verspätetes Vorbringen verzögert? 674
II. Klageänderung, Klageerweiterung, Klagerücknahme; Berufungsrücknahme, Berufungsverzicht. 675
1. Klageänderung. 675
2. Klageerweiterung. 676
3. Der erstmals in der Berufungsinstanz gestellte Auflösungsantrag. 676
4. (Teil-)Klagerücknahme. 676
5. Berufungsrücknahme. 676
6. Berufungsverzicht. 677
III. Die Anschlussberufung. 678
IV. Der Ablauf des Berufungsverfahrens. 679
1. Der Gang des Verfahrens und seine voraussichtliche Dauer. 679
a) Die Terminierung. 679
b) Die mündliche Verhandlung vor dem Berufungsgericht. 679
c) Die voraussichtliche Dauer des Berufungsverfahrens. 680
2. Allgemeine Verfahrensgrundsätze. 680
a) Verhältnis von ArbGG zu ZPO; Verhältnis von erst- zu zweitinstanzlichem Verfahren. 680
b) Einige wichtige Besonderheiten. 681
aa) Die Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Arbeitsgericht. 681
bb) Säumnisverfahren. 681
cc) Übertragung der Entscheidung auf den Vorsitzenden. 681
dd) Vereidigung von Zeugen als Ausnahme. 682
ee) Anordnung des persönlichen Erscheinens der Parteien. 682
3. Hinweise zur Prozesssituation im Berufungsstreit um eine Kündigung. 683
4. Die gütliche Einigung im Berufungsverfahren. 683
V. Das Berufungsurteil und seine Anfechtbarkeit; Kosten und Streitwert. 684
1. Das Berufungsurteil. 684
2. Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gegen das Berufungsurteil. 684
a) Die Revision. 684
b) Die Nichtzulassungsbeschwerde und die Rechtskraft des Berufungsurteils. 685
c) Die Gehörsrüge nach § 78a ArbGG. 686
d) Die sofortige Beschwerde wegen verspäteter Absetzung des Berufungsurteils nach § 72b ArbGG. 687
3. Kosten und Streitwert. 687
VI. Besondere Verfahrensarten im Streit um eine Kündigung. 687
1. Sofortige Beschwerde im Verfahren nach § 5 KSchG. 687
2. Beschwerde im Beschlussverfahren nach § 103 BetrVG. 688
§ 28 Die Beendigung des Kündigungsschutzprozesses durch Prozessvergleich
I. Einführung. 689
II. Der Prozessvergleich. 690
1. Zustandekommen. 690
2. Inhalt. 690
a) Beendigungsart und Zeitpunkt. 691
b) Abfindung. 693
c) Lohnzahlung und weitere Durchführung des Arbeitsverhältnisses. 698
d) Urlaubsanspruch und Freistellung. 702
e) Regelungen zur Erteilung eines Zeugnisses. 706
f) Regelungen zur Erteilung von Arbeitspapieren. 707
g) Sonstige Regelungsgegenstände; große Erledigungsklausel. 708
§ 29 Die Geltendmachung von (Neben-)Ansprüchen im Kündigungsschutzprozess
I. Einführung. 711
II. Entgeltansprüche des Arbeitnehmers. 711
1. Klage auf Bruttoentgelt. 711
2. Arbeitslosengeld. 712
3. Checkliste. 712
III. Ansprüche auf Zeugniserteilung/Zeugnisberichtigung. 713
1. Arbeitszeugnis. 713
2. Geltendmachung. 715
3. Klageantrag. 715
4. Darlegungs- und Beweislast. 715
5. Zeugniserteilung nach Verurteilung. 716
6. Checkliste. 716
§ 30 Der Einstweilige Rechtsschutz
I. Einführung. 717
II. Arrest und einstweilige Verfügung. 717
1. Verfahrensrechtliche Grundlagen. 717
2. Arrest. 719
3. Einstweilige Verfügung. 720
III. Einzelfälle. 721
1. Beschäftigung und Weiterbeschäftigung. 721
a) Beschäftigungsanspruch. 721
b) Allgemeiner Weiterbeschäftigungsanspruch. 721
c) Betriebsverfassungsrechtlicher Weiterbeschäftigungsanspruch. 722
2. Arbeitsvergütung. 724
3. Wettbewerbsverbot. 726
4. Herausgabeansprüche. 728
a) Arbeitsmittel. 728
b) Dienstwagen. 728
5. Arbeitspapiere, Zeugnis. 729
IV. Antragsmuster. 731
1. Arrest. 731
2. Einstweilige Verfügung. 731
a) Betriebsverfassungsrechtlicher Weiterbeschäftigungsanspruch. 731
b) Arbeitsvergütung. 732
c) Wettbewerbsverbot. 732
d) Herausgabe eines Dienstwagens. 732
e) Arbeitspapiere, Zeugnis. 733
E. Sozialversicherungsrecht. 735
§ 31 Arbeitslosengeld I und II
I. Einführung. 735
II. Arbeitslosengeld (I). 736
1. Voraussetzungen des Anspruchs. 736
a) Arbeitslosigkeit. 737
aa) Beschäftigungslosigkeit. 737
bb) Eigenbemühungen. 738
cc) Verfügbarkeit. 740
b) Arbeitslosmeldung/Antrag. 743
c) Erfüllung der Anwartschaftszeit. 745
d) Keine Vollendung des 65. Lebensjahres. 745
2. Ruhen des Anspruchs. 746
3. Dauer des Anspruchs. 746
4. Höhe des Anspruchs. 747
a) Bemessungsentgelt. 747
b) Leistungsentgelt. 749
c) Leistungssatz. 749
5. Erlöschen des Anspruchs. 750
6. Sozialversicherungsschutz des Arbeitslosen. 750
II. Arbeitslosengeld II. 751
1. Vorbemerkung. 751
2. Voraussetzungen des Anspruchs. 753
a) Erwerbsfähigkeit. 753
b) Hilfebedürftigkeit. 754
aa) Ermittlung des Grundsicherungsbedarfs. 754
bb) Zu berücksichtigendes Einkommen und/oder Vermögen. 754
cc) Hilfe durch Dritte. 755
dd) Aufnahme einer zumutbaren Arbeit. 756
c) Bedarfsgemeinschaft. 757
d) Antrag. 758
3. Inhalt des Anspruchs: Grundsicherung. 758
a) Regelleistung zur Sicherung des Unterhalts. 759
b) Mehrbedarfe. 760
c) Angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung. 760
d) Befristeter Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld. 761
d) Sozialgeld. 761
e) Berechnung. 761
4. Verstöße gegen Mitwirkungs-/Meldeobliegenheiten. 762
a) Verstoß gegen Mitwirkungsobliegenheiten. 762
b) Verstoß gegen Meldeobliegenheiten. 763
c) Sonderregelungen. 764
d) Wirkung der Sanktionen. 764
e) Sanktionen gegenüber Beziehern von Sozialgeld. 765
5. Sozialversicherungsschutz. 765
§ 32 Sperrzeittatbestände und Ruhen
I. Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs. 767
II. Ruhenstatbestände. 767
1. Ruhen des Anspruchs bei Sperrzeit. 768
a) Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe. 768
aa) Lösen des Beschäftigungsverhältnisses. 768
bb) Anlass durch vertragswidriges Verhalten. 771
cc) Kausalität. 772
dd) Verschulden. 772
ee) Wichtiger Grund. 773
ff) Beginn und Dauer der Sperrzeit. 775
b) Sperrzeit bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung. 776
c) Weitere Sperrzeittatbestände. 776
d) Wirkung der Sperrzeit. 777
2. Ruhen des Anspruchs bei Entlassungsentschädigung. 778
a) Entlassungsentschädigung. 778
b) Maßgebliche Kündigungsfrist. 778
c) Dauer des Ruhens. 779
d) Gleichwohlgewährung. 780
3. Ruhen des Anspruchs bei Entgelt und Urlaubsabgeltung. 781
§ 33 Erstattungspflicht des Arbeitgebers
I. Einführung. 783
II. Voraussetzungen und Umfang der Erstattungspflicht. 784
1. Allgemeines. 784
2. Grundvoraussetzungen. 784
3. Befreiungstatbestände. 785
a) Kurzer Bestand des Arbeitsverhältnisses. 785
b) Kleinstunternehmen. 785
c) Arbeitnehmerkündigung ohne Abfindung. 786
d) Sozial gerechtfertigte Kündigung. 786
e) Berechtigung zur außerordentlichen Kündigung. 788
f) Personalabbau. 788
g) Unzumutbare Belastung. 789
4. Erstattungsschuldner. 789
5. Beginn und Umfang der Erstattungspflicht. 789
6. Beratung und Vorabentscheidung. 790
III. Vereinbarungen zur Vermeidung einer Erstattungspflicht. 790
F. Steuerrecht. 791
§ 34 Steuerrechtliches Umfeld der Beendigung von Arbeitsverhältnissen
I. Abfindungen wegen Auflösung des Dienstverhältnisses. 791
1. Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 9 EStG. 791
2. Steuerbegünstigung gemäß §§ 24, 34 EStG. 802
3. "Brutto=Netto"-Klauseln. 808
4. Abfindungen mit Auslandsbezug. 809
II. Karenzentschädigungen. 809
G. Aspekte der Zwangsvollstreckung. 813
§ 35 Die Zwangsvollstreckung im Kontext einer Kündigung
I. Einführung. 813
II. Rechtliche Grundlagen. 814
1. Der Ausgangspunkt der Vollstreckung aus arbeitsrechtlichen Titeln. 814
2. Die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. 815
Checkliste: Allgemeine Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. 816
a) Der vollstreckungsfähige Titel, insbesondere die vorläufige Vollstreckbarkeit. 817
aa) Der Vollstreckungstitel. 817
bb) Rechtskraft und vorläufige Vollstreckbarkeit. 817
cc) Die Bestimmtheit des Vollstreckungstitels. 825
b) Die Vollstreckungsklausel. 826
c) Die Zustellung des Vollstreckungstitels. 828
3. Die Zwangsvollstreckung aus einem Zahlungstitel. 828
a) Allgemeines zur Zwangsvollstreckung aus einem Zahlungstitel. 828
b) Die Zwangsvollstreckung aus einem Bruttolohntitel. 829
c) Die Abfindungszahlung nach §§ 9, 10 KSchG. 833
4. Die Zwangsvollstreckung aus einem Herausgabetitel. 834
a) Die Herausgabevollstreckung im Kontext einer Kündigung. 835
aa) Die Herausgabe von Arbeitspapieren. 835
bb) Die Herausgabe von Arbeitsmitteln und -geräten. 836
b) Die rechtlichen Grundlagen der Herausgabevollstreckung. 837
5. Die Zwangsvollstreckung wegen einer vertretbaren oder unvertretbaren Handlung. 838
a) Die Anwendungsfälle der Zwangsvollstreckung wegen einer vertretbaren oder unvertretbaren Handlung. 838
aa) Der Anspruch auf Entfernung einer Abmahnung aus der Personalakte. 838
bb) Der Anspruch auf Ausfüllung der Arbeitspapiere. 839
cc) Der Anspruch auf Erteilung einer Lohnabrechnung und der Abrechnung von Provisionen. 840
dd) Der Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses. 841
b) Die Grundzüge der Zwangsvollstreckung einer vertretbaren Handlung 843
c) Die Grundzüge der Zwangsvollstreckung wegen einer unvertretbaren Handlung. 844
d) Die Alternative der Verurteilung zur Zahlung einer Entschädigung nach § 61 Abs. 2 ArbGG. 846
6. Die Vollstreckung des Weiterbeschäftigungsanspruchs. 850
a) Die Vollstreckung des Weiterbeschäftigungsanspruches des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer. 850
b) Die Vollstreckung des Weiterbeschäftigungsanspruches des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber. 852
aa) Die Bestimmtheit des Titels. 852
bb) Die Unmöglichkeit der Weiterbeschäftigung. 853
cc) Der Übergang von Weiterbeschäftigungsanspruch zum Ersatzanspruch. 855
dd) Die Vollstreckung des Weiterbeschäftigungsanspruchs nach § 888 ZPO. 855
7. Die Vollstreckung einer Unterlassungsverpflichtung. 856
H. Das Mandat im Kündigungsschutzprozess. 861
§ 36 Das Mandat im Kündigungsschutzprozess
I. Einführung. 861
II. Mandatsannahme. 862
III. Sachverhaltserfassung. 864
IV. Der Umgang mit den Beteiligten des Kündigungsschutzprozesses. 867
1. Der Umgang mit den Mandanten. 867
2. Umgang mit dem Gegner und dessen Vertreter. 871
3. Umgang mit Richtern. 871
V. Vergütungsfragen. 872
VI. Verhandlungsstrategie. 874
1. Festpreis. 875
2. Basar. 876
3. Kooperation. 877
4. Risikoerhöhung. 877
VII. Haftungsfragen im kündigungsrechtlichen Mandat. 879
1. Verspätetes Handeln. 880
2. Unterbliebene Aufklärung/unterbliebene oder fehlerhafte Beratung. 880
3. Fristen. 881
VIII. Fragebogen Kündigungsschutz. 883
1. Arbeitnehmerfragebogen. 883
2. Arbeitgeberfragebogen. 884
I. Taktik und Fallstricke im Kündigungsschutzprozess. 887
§ 37 Taktik und Fallstricke für den Klägervertreter
I. Einführung. 887
II. Fristgebundene Handlungen bei Erhebung der Kündigungsschutzklage. 888
1. Zurückweisung der Kündigung gem. § 174 S. 1 BGB. 888
2. Einhaltung der Frist des § 9 MuSchG. 890
3. Wahrung des Sonderkündigungsschutzes als schwerbehinderter Mensch. 891
4. Maßnahmen bei Änderungskündigungen. 893
5. Maßnahmen bei Bestehen eines Betriebsrats. 894
6. Erhalt eines Zeugnisses. 894
III. Zeitpunkt der Klageeinreichung. 895
1. Einhaltung der Drei-Wochen-Frist. 895
2. Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Drei-Wochen-Frist. 897
IV. Inhalt der Klageschrift. 898
1. Durch die Gewährung von Prozesskostenhilfe bedingte Kündigungsschutzklage? 898
2. Klageanträge. 898
3. Klagebegründung. 899
V. Durchführung außergerichtlicher Vergleichsverhandlungen. 901
VI. Vorbereitung der Güteverhandlung. 902
1. Festlegung der Ziele. 902
2. Empfehlungen zum Verhalten des Mandanten. 905
VII. Taktik in der Güteverhandlung. 905
1. Teilnahme des Arbeitnehmers an der Güteverhandlung. 905
2. Abschluss eines Vergleiches oder Scheitern der Güteverhandlung? 908
VIII. Maßnahmen zwischen Güte- und Kammerverhandlung und Vorbereitung der Kammerverhandlung. 909
1. Verhalten des Arbeitnehmers. 909
2. Weiterbeschäftigungsantrag und arbeitgeberseitig angebotene Weiterbeschäftigungsmöglichkeit. 910
3. Ausschlussfristen. 912
a) Schriftliche Geltendmachung. 912
b) Gerichtliche Geltendmachung. 913
4. Schriftsätzliche Vorbereitung der Kammerverhandlung. 914
IX. Taktik in der Kammerverhandlung. 915
§ 38 Taktik und Fallstricke für den Beklagtenvertreter
I. Einführung. 917
II. Bestimmung des Prozessrisikos. 917
1. Einschätzung des Annahmeverzugslohnrisikos. 917
2. Bestimmung sonstiger Risiken. 920
3. Erfolgsaussichten der Verteidigung gegen die Kündigungsschutzklage. 921
III. Vorbereitung der Güteverhandlung. 923
1. Schriftliche Klageerwiderung zur Vorbereitung der Güteverhandlung. 923
2. Teilnahme des Arbeitgebers an der Güteverhandlung. 923
IV. Taktik in der Güteverhandlung. 924
V. Beratung im Anschluss an eine gescheiterte Güteverhandlung. 927
1. Ermittlung und Verdeutlichung des Risikos. 927
2. "Rücknahme" der Kündigung. 928
3. Erteilung eines Zeugnisses. 929
4. Angebot einer befristeten Weiterbeschäftigung für die Dauer des Kündigungsschutzrechtsstreits. 930
J. Kostenfragen. 933
§ 39 Gerichtskosten im Kündigungsschutzmandat
I. Einführung. 933
II. Geltende Regelung. 933
1. I. Instanz. 933
2. II. und III. Instanz. 936
§ 40 Rechtsanwalts-Vergütung im Kündigungsschutzmandat
I. Einführung. 939
II. Gegenstandswert. 941
1. Kündigungsschutzmandat. 942
2. Klagehäufung. 943
3. Allgemeiner Feststellungsantrag. 943
4. Weiterbeschäftigung. 944
5. Vergleichswert. 944
III. Anwaltsgebühren. 945
1. Die Angelegenheit. 946
2. Beratung. 948
a) Wegfall der gesetzlichen Beratungsgebühr. 948
b) Gebührenrahmen. 949
c) Erstberatung. 951
d) Anrechnung der Beratungsgebühr. 951
3. Außergerichtliche Vertretung. 951
a) Systematik. 952
b) Die Geschäftsgebühr und ihre Anrechnung. 952
c) Besondere Verfahren. 953
4. Gebühren in der I. Instanz. 954
a) Verfahrensgebühr. 954
b) Terminsgebühr. 956
c) Einigungsgebühr. 958
d) Verfahrensdifferenzgebühr. 960
5. Gebühren in der II. Instanz. 961
a) Verfahrensgebühr. 962
b) Terminsgebühr. 963
c) Einigungsgebühr. 963
d) Verfahrensdifferenzgebühr. 964
g) Verlustigerklärung des Rechtsmittels. 964
6. Gebühren in der III. Instanz. 965
a) Nichtzulassungsbeschwerde. 965
b) Revision. 965
IV. Verwaltungsverfahren. 966
§ 41 Das Kündigungsmandat aus Sicht der Rechtsschutzversicherung
I. Einführung. 967
II. Aufgaben der Rechtsschutzversicherung im Allgemeinen. 968
1. Wahrnehmung rechtlicher Interessen. 968
2. Kostentragung. 968
3. Rechtsbeziehungen im Rahmen des Rechtsschutzmandats. 969
a) Allgemeines. 969
b) Kostenerstattungs- bzw. Herausgabeansprüche der Rechtsschutzversicherung. 970
c) Aufrechnung des Rechtsanwalts mit eigenen, nicht gedeckten Gebührenansprüchen. 970
d) Auskunftsanspruch des Versicherers gegen den Rechtsanwalt. 971
III. Der Arbeits-Rechtsschutz. 971
1. Begriff, Deckungsbereich. 971
2. Rechtsschutzformen mit Arbeits-Rechtsschutz. 972
3. Rechtsschutz für Vertretungsorgane (Anstellungsverträge). 973
IV. Der Rechtsschutzfall in arbeitsrechtlichen Kündigungssachen. 974
1. Begriff, Allgemeines. 974
2. Fallgestaltungen zum Eintritt des Rechtsschutzfalls. 974
a) Eintritt des Rechtsschutzfalls bei Vorliegen einer Kündigung. 974
b) Eintritt des Rechtsschutzfalls, wenn es an einer Kündigung fehlt. 975
V. Streitpunkte aus der Rechtsschutzpraxis bei Kündigungsschutzverfahren. 976
1. Besprechungen und Korrespondenz mit der Gegenseite vor Erhebung der Kündigungsschutzklage. 976
2. Weiterbeschäftigungsanspruch. 977
3. Künftige Gehaltsansprüche im Kündigungsschutzprozess. 978
4. Einigung: Einbeziehung nicht rechtshängiger Ansprüche. 978
§ 42 Anspruchsdurchsetzung gegenüber der Rechtsschutzversicherung
I. Überblick. 979
II. Geschäftsgebühr. 979
1. Außergerichtliche/gerichtliche Vollmacht. 980
a) Muster: Vollmacht für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung. 980
b) Muster: Vollmacht für die gerichtliche Vertretung. 980
2. Anschreiben an den Arbeitgeber vor Klageerhebung. 981
a) Allgemeines. 981
b) Muster: Anschreiben an den Arbeitgeber vor Klageerhebung. 982
III. Deckungsantrag für die außergerichtliche Tätigkeit. 986
a) Allgemeines. 986
b) Muster: Deckungsantragsschreiben an die Rechtsschutzversicherung - außergerichtliche Tätigkeit. 987
IV. Deckungsantrag für die gerichtliche Tätigkeit und Kostenvorschussnote. 988
a) Allgemeines. 988
b) Muster: Deckungsantragsschreiben an die Rechtsschutzversicherung - gerichtliche Tätigkeit und Kostenvorschuss. 988
V. Weiterbeschäftigungsan