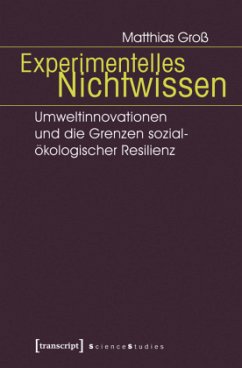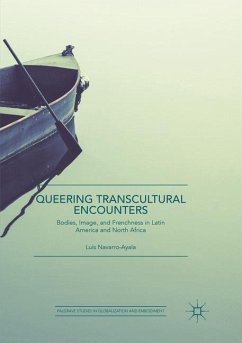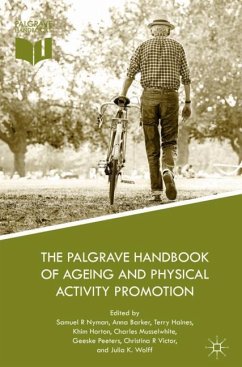Nicht lieferbar
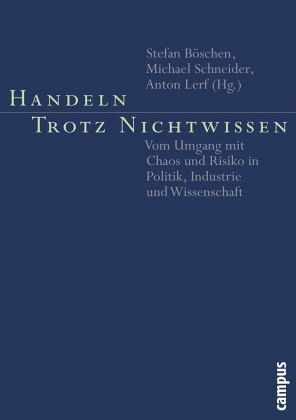
Handeln trotz Nichtwissen
Vom Umgang mit Chaos und Risiko in Politik, Industrie und Wissenschaft
Herausgegeben: Schneider, Michael; Lerf, Anton; Böschen, Stefan;Mitarbeit: Böschen, Stefan; Bruckner, Thomas; Bärmann, Michael; Dose, Nicolai; Dressel, Kerstin; Füssel, Hans-Martin; Gill, Bernhard; Gleich,
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Der Umgang mit Nichtwissen und Risiko
Mit der Zunahme von Wissen wächst auch das Nichtwissen. Das Buch bietet eine Bestandsaufnahme und interdisziplinäre Annäherung an dieses ebenso zentrale wie schillernde Thema: Es verschwimmen nicht nur die Grenzen zwischen Wissen und Nichtwissen, längst hängt auch die Unterscheidung von Machtverhältnissen und Deutungshoheiten ab. Anhand von Fallstudien aus politischer und industrieller Praxis, wie Umweltchemie, Klimaforschung, Nanotechnologie, Genforschung und dem Thema BSE, wird dargestellt, wie Nichtwissen jeweils wahrgenommen, definiert, bestritten oder strategisch eingesetzt wird.