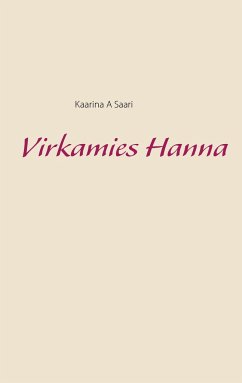Hanna"sitzt zuhause und schweigt", sie verschließt sich in sich selbst und öffnet sich kaum. Auch nicht dem erzählenden Ich, das versucht, Hannas Geheimnis und die Motive ihres Verstummens zu erkunden, weil es nicht will, dass Hanna"ausscheidet", dass sie im Dunkel verschwindet, in den Schatten, die sie umgeben. Immer wieder öffnet sich die Tür zu"ihrem kleinen Laden", herein treten Herr Emm, Lea und Rio, in diesen kleinen Ort, an dem außer Reden nicht viel möglich ist: ein paar Schritte zwischen Fenster und Treppe - lesen, schreiben,sprechen. Mit ihren Besuchern kreist Hanna um eine Geschichte, die zerbrochen und verloren scheint, aber gesucht werden will. So sehr diese Suche die Figuren immer wieder zueinander hintreibt, so wenig kommen sie doch beieinander an."Wohin geht's, wenn's nirgendwohin geht?"lautet die Frage, die das erzählende Ich stellt und die weiter wandert, von Figur zu Figur, von Ort zu Ort. Erzählen - das könnte hier Hinhören heißen, Hinhören auf Sätze, die voller Spannungen sind, voller Widersprüche. Erzählen heißt auch, die Grenze zwischen"Traum"und"Wirklichkeit"offen zu halten. Denn, wie in Andrea Winklers hochgelobtem Debüt"Arme Närrchen", wächst der Wunsch nach einer Begegnung mit dem Du an diesem Übergang. Und wie in den"Armen Närrchen"ist die Rolle der Sprache, die Wahl der Wörter und Sätze - und das Ungesagte! - das Entscheidende.

Heiliger Wittgenstein: Andrea Winkler steckt in der Sprachkrise
Von Daniela Strigl
Es gibt sie also doch noch, die reine, absolute Avantgarde. Vielleicht ist sie, wie Kathrin Röggla unlängst meinte, "völlig aus dem Feuilleton gefallen"; doch halten Unentwegte ihr Fähnlein hoch, und das ist gut so. Wer wollte schon für eine öde Einheitsfront der munteren Unterhalter plädieren?
Nach den pfiffigen Kurzprosastücken "Arme Närrchen" legt Andrea Winkler nun eine zusammenhängende - nein, Geschichte wäre zu viel gesagt, also vielleicht: Textur vor. Das Personal präsentiert die Autorin im Vorspann selbst: "Herr Emm, Rio, Lea, Hanna, ich - niemals wirklich genug, ich bedaure!" Sollen wir das glauben? Dass ihr das leid tut? "Ach, glauben Sie mir nicht, glauben Sie mir alles." Na gut. Jedenfalls geht es um Hanna, die, landläufig ausgedrückt, Symptome einer Depression aufweist. Sie spricht kaum, verbringt Stunden auf dem Sofa und will nicht aus dem Haus. Ihre Gedanken kreisen um die Vergangenheit, um ein vergangenes Glück. Die Dinge, die sie umgeben, scheinen sich zu zersetzen, die Wörter, mit denen sie sie bezeichnen könnte, auch - eine weibliche Malte-Laurids-Brigge-Figur.
Ihr steht ein Ich gegenüber, das sie, obgleich selbst angekränkelt, retten will, nach dem Muster des Kinderspiels Versteinern-Erlösen. In den kursiv gesetzten Kapiteln konzentriert sich das Ich ganz auf das Hanna-Problem, redet sie auch direkt an, blendet die anderen aus. Vielleicht aber ist dieses Ich nicht dasselbe wie das der anderen Passagen, vielleicht spricht hier Rio, der Hanna liebt? "Ich werde Hanna an der Hand nehmen müssen." Dabei könnte doch auch der Leser eine helfende Hand gebrauchen.
Man trifft sich in einem "Laden", vielleicht eine Buchhandlung, trinkt Tee, wickelt Locken um Finger. Die übrigen Personen muten maskenhaft an: Herr Emm ist älter und hat einen Stock, er kramt in Schachteln nach seinem Leben, und Lea, die lacht, ob es passt oder nicht. Womöglich sind sie ja nur Hannas Projektionen - oder die der Erzählstimme: "Du hast einen Namen, und ich erfinde fünf weitere für dich, damit du dich in ihnen ausprobieren kannst." Wo die Figuren leer sind, in ihrem Zentrum, lassen sie Platz für die Schrift: Herr Emm, "ein Häufchen Linien, ins Eis geritzt", Rio, in dessen gezeichnete Umrisse Hanna sich am Schluss einträgt.
Als Germanistin hat Andrea Winkler sich Friederike Mayröcker verschrieben, die sie auch zitiert (wie Kafka, Robert Walser und andere), ohne sich epigonal an sie anzulehnen. Gegen Winklers pastellfarbene Als-ob-Welt strotzt die der Mayröcker vor Leben und Erzähllust. Winkler spendet Trost: "Die Geschichte: ist im Suchen begriffen. Immerhin!" Meint sie auch: Sie wird im Suchen begriffen? Gute alte österreichische Sprachskepsis.
"Hanna und ich" ist ein Buch, über das man, je nach Erwartung, Geschmack und Temperament, ein begeistertes oder ein entnervtes Urteil fällen könnte, und beide wären richtig oder zumindest gerecht. Man steht vor dieser Prosa wie vor den Vitrinen eines Schmetterlingssammlers. Man sieht prächtige Muster und feine Variationen, man ahnt dahinter ein unerschöpfliches Ordnungsprinzip, man ist fest entschlossen zur Bewunderung, und man ermüdet rasch. Im Kleinen, im Ausschnitt spielt Winklers Literatur all ihre Stärken aus: ihre ungekünstelte Poesie, ihre Musikalität, ihre turnerische Grazie: "Was vom Schönsten und Unsichersten, warum denn nicht." Der Text ist bis in seine Mikrobewegungen durchkomponiert: Wenn vorne eine Frage gestellt wird, dann wird sie hinten auch beantwortet; wenn auf der ersten Seite die Zugräder rollen, dann rollen sie auch auf der letzten. Und der Zweck des Ganzen? "Erfahren, wer Du bist, schöner hinfälliger Wunsch."
Aber entsteht bei diesem Suchen der Geschichte und des Glücks nicht stellenweise auch ein lästiges Pathos? Ist die sich selbst erfahrende, verträumte Hanna (nicht ihre Rede!) kein Klischee? Und begründen die Wittgensteinschen Fragen nach den Grenzen von Sprache und Ich schon die Notwendigkeit der ganzen Unternehmung? Für Leser mit ketzerischen Zweifeln hält Winkler als Ventil den Selbstkommentar bereit, der die Melodie des Textes als eine zweite Stimme begleitet: "hält das Spiel, was es verspricht, was glauben Sie, und vor allem, wie lange noch?" Ja, wer sehnt sich nicht nach dem zupackenden Griff der Erzählerin?! "Geduld rettet", weiß Herr Emm. Am Ende entspannt sich die Lage, die Falte auf Hannas Stirn scheint fast ausgebügelt.
Mit leeren Händen steht der strapazierte Leser nicht da. "Welches Bild unter den Kopfpolster legen, welchen Satz an die Wand malen?" Wohl den Ginster im Zugfenster und den auch in der Kunst beherzigenswerten Rat: "Wer nicht in der Lokalbahn zu weit fahren möchte, sollte gar keine Reise antreten!"
- Andrea Winkler: "Hanna und ich". Literaturverlag Droschl. Graz/Wien 2008. 136 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Irritiert zeigt sich Samuel Moser angesichts der Surrealität des zweiten Prosabandes von Andrea Winkler "Hanna und ich", in dem sich die Autorin auf die "Suche nach einer Geschichte" mache, was er ihr aber nicht negativ anzurechnen scheint. Ebenso wertfrei stellt er fest, dass sowohl die Figuren als auch der Zeitrahmen des Buches lediglich Vermutungen zulassen und sich damit jeder Versuch einer Inhaltsangabe erübrigt. Der Umstand, dass Winkler wiederholt Zitate von Aichinger, Dostojewski, Robert Walser und anderen in ihr Werk einfügt, hat bei dem Rezensenten den Eindruck erweckt, die Autorin mache sich selbst zum Gegenstand des Textes, um schließlich darin zu verschwinden. Positiv bemerkt der Rezensent, der uns ein wenig ratlos über sein Urteil zu diesem Buch lässt, die Stärke von Winklers Prosa liege in ihrer Schlichtheit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH