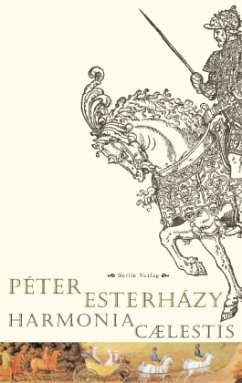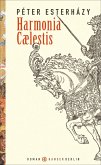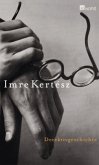Die Esterházys, eine der großen Aristokratenfamilien Europas, haben sich über Jahrhunderte in die ungarische und habsburgische Geschichte eingeschrieben. Die Esterházysche Familiengeschichte ist Landesgeschichte, und dieser monumentale Roman Harmonia Cælestis konnte kurz nach Erscheinen auch als "Nationalepos" (Corriere della Sera) begrüßt werden. Aber Esterházy wäre nicht der als Erneuerer der ungarischen Literatur bekannt gewordene Autor, wenn er nicht die Form des bürgerlichen Familienromans zugleich auch unterliefe. Buch I heißt "Numerierte Sätze aus dem Leben der Familie Esterházy". Es bietet ein barockes Füllhorn an Legenden, Chroniken, Registern, Mythen und Episoden, ein Mosaik aus Texten, in denen jede Chronologie aufgehoben ist, und die nur eine Hauptfigur kennen: "Mein Vater". Er ist Don Juan und Nichtsnutz, Magnat und Gelehrter, Bischof und Baumeister, Verrückter und Tyrann, Gesandter und Ministerpräsident, Schüler von Helmholtz, aber auch die Katze in Schrödingers Experiment - er steht für alle Familienmitglieder, ist ein Passepartout für alles, grenzenlos und unerschöpflich wie die Macht der Familie in der Geschichte. "Die Bekenntnisse einer Familie Esterházy" (Buch II) erzählen von dem Leben einer aristokratischen Familie im 20. Jahrhundert unter den Bedingungen der Diktatur, seit der Räterepublik 1919 bis in die jüngere Vergangenheit. Eine Geschichte von Enteignung, Aussiedlung und Verarmung, die Geschichte einer Familie vor dem Nichts. Zwischen diesen beiden Polen, dem Alles und dem Nichts, bewegt sich das Familienschicksal der Esterházys. Péter Esterházy wurde in diesem Jahr bereits mit zwei ungarischen Literaturpreisen für Harmonia Cælestis ausgezeichnet. Als Goethe vom "Esterházyschen Feenreich" schrieb, konnte er dieses epochale Werk noch nicht kennen.

Péter Esterhazy schildert die ungarische Rätezeit als Generalprobe für den Weltbürgerkrieg / Von Lorenz Jäger
Was tun angesichts einer Überfülle? Da ist die kleine Kommode aus Frankreich. Die englische Ausgabe von Tausendundeine Nacht. Vergilbte Fotos der Großmutter. Und nicht nur die Fotos, sondern die Namen der Ateliers, in denen sie aufgenommen wurden. Dazu Vasen, Kunstwerke, Gedenkbücher, Grabsteine. Da sind Schlösser und später, Jahrhunderte später, die kargen Wohnungen des ungarischen Kommunismus. Péter Esterhazy will von dieser Überfülle erzählen. An jedes Ding, das einmal seiner Familie gehört hat, knüpft sich zumindest eine Anekdote. Ein Roman als aufgeblättertes Familienalbum und als Inventarbeschreibung - das erinnert an Walter Benjamins Dingphysiognomik in der "Berliner Kindheit".
Und die Familie Esterhazy hat es in sich, was Aufstieg und Niedergang betrifft. Ihre Geschichte ist für die Geschichte Ungarns in den letzten Jahrhunderten repräsentativ wie keine andere, wenn sie nicht gar mit der Geschichte des Landes identisch ist. Das Adelsgeschlecht der Esterhazy stellte Politiker, Diplomaten, Ministerpräsidenten, es war weitläufig europäisch verbunden wie sonst nur die Rothschilds. In dieser Familie erblickt man Ungarns schönsten Glanz. Nicht das Licht und die Souveränität selbst, aber den Schimmer nahe bei ihnen, den Zeiger ihres Auf- und Untergangs. Denn der Familienname leitet sich ab von "esthanjal", der Venus, dem Abend- und Morgenstern. "Der Mensch des Abendsterns", schreibt Esterhazy, "ist ein sehr weicher Mensch, zweifelt in der Hauptsache, zweifelt, wo er nicht sollte, sägt an dem Ast, auf dem er sitzt."
Sein Roman war in Ungarn ein großer Verkaufserfolg, mit gutem Grund. Gegen das Programm zur Löschung der Erinnerung, das der Kommunismus und die sowjetische Oberherrschaft dem Land auferlegt hatten, findet man hier eine große Selbstbehauptung der einer jahrhundertealten Nationalgeschichte: liebevoll, wie es sich für einen Sohn gehört, aber nicht triumphal, nicht heroisierend, sondern detailliert, grotesk bis zum Irrwitz und ebenso oft herzzerreißend traurig.
Péter Esterhazy hat, bevor er Schriftsteller wurde, Mathematik studiert und als Systemorganisator am Institut für Datenverarbeitung in einem ungarischen Ministerium gearbeitet. Sein Roman nimmt sich das denkbar komplizierteste aller Systeme vor: das seiner eigenen Familie. Eheschließungen und Skandale, Geburten und Todesfälle vollziehen sich als Parallelaktionen zur politischen Geschichte Mitteleuropas. Und Esterhazy vereinfacht das Familiensystem. "Mein Vater" ist immer der jeweilige Vater, ob im siebzehnten, achtzehnten oder einem späteren Jahrhundert. Immer wieder blitzen historische Namen auf: Der junge Goethe, den ein Vorfahr am Frankfurter Roßmarkt trifft, der unglückliche Herzog von Reichstadt (er war Napoleons Sohn), der junge Churchill, der Hauptmann Dreyfus. Allerdings hat es mit der Erwähnung der Konnexionen meist sein Bewenden. Die Namen geben das Kolorit, ausgeführt ist dabei wenig. Was sich über den Leser ergießt, ist ein überreicher Anekdotenstrom.
Auf die Frage einer Wochenzeitung, welchen Traum er sich noch erfüllen wolle, hat Péter Esterhazy einmal geantwortet: "Kochen lernen." Vielleicht liegt hier das Problem. Sein neuer Roman jedenfalls ähnelt einem Gericht, bei dem Zutaten und Gewürze nach dem einzigen Maß der Fülle in den Topf kommen. Einmal werfen die Kinder eine Katze über den Zaun. Die Großmutter untersagt es ihnen: Auch die Katze ist ein Geschöpf Gottes. Esterhazy beläßt es nicht bei dem schlichten Sachverhalt: Der Zaun, so erfährt man, ist in Wahrheit aus Steinen. Diese stammen von den Ruinen in der Nähe. Dann folgt eine ausgedehnte Reflexion über die Frage, ob Katzen immer auf die Füße fallen. Und dann wird die ganze Szene noch einmal abgeschmeckt: "Aber man konnte aufregende Wetten dahingehend abschließen, wie lange dieses ungeflügelte Geschöpf in der Luft verbleiben würde, denn den heiligen Augenblick, in dem es wieder die Erde berührte, konnte man trotz allem feststellen, mit geschlossenen Augen, inbrünstig, versunken mitzählend wie die Artilleristen am Minenwerfer, eins, zwei, drei, bumm beziehungsweise: pladauz."
Irgendwann kommt auf den mehr als neunhundert Seiten auch für den Gutwilligsten der Moment, wo er andere Sätze lesen möchte. Etwa: "Als Kind habe ich einmal unsere Katze über den Zaun geworfen." Aber das wäre nicht mehr die Literatur, die der Betrieb prämiert. An seinem Umfang, vor allem aber an seinem Anspruch hat Esterhazys Roman schwer zu tragen. Er ähnelt sich der Erwartung an, die Literaturpreis-Komitees an einen Kunstroman stellen; man könnte von der Gattung der "Aha: Literatur"-Literatur sprechen, die hier ein vollendetes Muster gefunden hat.
Zu den großen Partien des Romans gehören indes die Erzählungen über die ungarische Räteregierung unter Béla Kun, die sich nach dem Ersten Weltkrieg für einige Monate halten konnte. Jede Darstellung dieser kurzen Epoche begibt sich auf ein Minenfeld. Unter den Kommunisten waren nicht wenige Juden - zu den bekanntesten gehörte der Philosoph Georg Lukàcs -, auf der anderen Seite, bei den Gegenrevolutionären, waren Antikommunismus und Antisemitismus oft kaum unterscheidbar: Für den Großvater ist die kommunistische Episode schlicht die "Judenwirtschaft".
Esterhazy hat diese Geschichte zum Sprechen gebracht und dabei der Verdrängung auf beiden Seiten keine Konzessionen gemacht. Herrlich ist schon die Ankündigung des Dieners: "Eure Exzellenz, ich würde es so sagen, bitte schön, die Kommunisten sind hier." In Budapest hat die Revolution gesiegt, eine örtliche Delegation stellt sich ein, die - Befehl von Georg Lukács - den Kunstbesitz der Familie Esterhazy beschlagnahmen soll. Noch scheint alles durch das ewige Hilfsmittel der Korruption lösbar zu sein: "Alle ihre Befehle lauteten bei Todesstrafe, welche Drohung mit Geldabgaben in schwindelnder Höhe gleichbedeutend war." Aber bald meldet sich die Ahnung, daß etwas anderes begonnen hat, daß in die dörflichen Verhältnisse um das Schloß Csákvár eine Zukunft einkehrt, von der man keinen Begriff hatte. Als der Besitz konfisziert wird, nimmt er ein anderes Gesicht an. Die Dinge liegen aufgestapelt da, wie ein Haufen Kohle. "Da also sah ich das erste Mal, wie das Viele ekelerregend sein kann, wenn das Viele kein blendender Reichtum ist, sondern dieses widerwärtige Gespei in der Mitte meines Schlosses." Der Großvater, der das neue Regime beobachtet, ist ein Reaktionär, und keine seiner Äußerungen wird beschönigt. Für ihn ist der Kommunist kein Mensch - wie später für den Enkel, der sich mit leisem Schrecken seiner Gedanken beim Schulbesuch erinnert: "Keiner wie wir, ein krimineller Verbrecher, ein liederlicher Verräter, es lohnt sich gar nicht, sich mit ihm zu beschäftigen oder, wenn doch, dann nur deshalb, weil er sich seinerseits mit uns beschäftigt, er will uns vertilgen, also muß man doch auf der Hut vor ihm sein wie vor einem tollwütigen Fuchs oder einer Ratte oder Läusen."
So wird die ungarische Rätezeit zur Generalprobe für den Weltbürgerkrieg. In den Gesprächen des Großvaters mit dem jüdischen Kommunisten Sterk nimmt er eine erste, fast noch zivile Gestalt an. Sterk ist ein gebildeter Mann, der zu argumentieren weiß. Als der Großvater ihm vorhält, die Kommunisten dächten nur in Quantitäten und sähen nicht den Unterschied zwischen einem Diner und einem Freßgelage, antwortet er: "Gewiß, Exzellenz. Jedoch wird dieser Gedanke durch den Hunger nuanciert." Und beiläufig gibt er zu bedenken: "Möglich, daß ich auch nur ein Mensch bin, wie auch Sie vor Jahves Angesicht nichts anderes sind, Herr Graf, ein Mensch . . . ein Mensch . . ." Das erinnert an den großen Monolog von Shylock: "Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht?" Aber der alte Esterhazy versteht nicht und will es wohl auch nicht, der Reaktionär sieht in Sterks Rede nur die "sentimentale Todesangst". Und er erregt sich: "Heutzutage von umfassenden Pogromen zu sprechen oder sie auch nur anzudeuten ist einfach eine Lüge! Wir befinden uns im zwanzigsten Jahrhundert!" Dann bricht die Räteherschaft zusammen. Kalt-lakonisch erinnert sich der Graf an seinen Widersacher: "Er ließ sich nach dem Scheitern der Kommune bei mir anmelden, aber ich besiegte meine Neugier und empfing ihn nicht. Er floh nach Wien, erzählte man sich im Dorf, dann nach Moskau, dann wieder zurück nach Wien, wo er unter obskuren Umständen verstarb." Esterhazys Darstellung der Räteherrschaft ist es, die am Ende für manchen erzählerischen Leerlauf in diesem Roman entschädigt. Ihre Gerechtigkeit ist neu, und sie weist in die Zukunft.
Péter Esterhazy: "Harmonia Caelestis". Roman. Aus dem Ungarischen übersetzt von Terézia Mora. Berlin Verlag, Berlin 2001. 921 S., geb., 68,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Überaus ausführlich und sehr kritisch widmet sich Andreas Breitenstein der Familiengeschichte Esterhazys, die nun in einer hervorragenden Übersetzung von Terezia Mora vorliegt. Die in Ungarn hoch gelobte Geschichte des ungarischen Adelsgeschlechts sei vom ästhetischen Standpunkt her keinesfalls leichte Kost, befindet der Rezensent, und er meint dies durchaus nicht positiv. Dem Leser sei es unmöglich, in diesem monumentalen Werk Chronologie oder deutlich erkennbare Erzählstränge herauszulesen. Eine furiose Mischung von Elementen der verschiedensten literarischen Gattungen und von Sprach- und Stilebenen erschwere zudem das Verständnis in einem unnötigen Ausmaß. Der Rezensent kritisiert, dass die postmoderne Ironie in einem derartigen Übermaß dem Inhalt des Buches nicht mehr gerecht werden kann und dass der Leser nach den ständigen Witzeleien nicht mehr zum angemessenen Ernst zurückfinden könne. Breitensteins Fazit ist daher negativ: "Peter Esterhazy zerredet (s)eine Familiengeschichte."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH