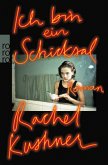Rachel Kushner ist für ihren Mut, ihren Ehrgeiz und ihren Killerinstinkt bekannt. In Harte Leute versammelt sie eine Auswahl ihrer Essays, die sich mit den drängendsten kulturellen, künstlerischen und politischen Themen unserer Zeit ebenso befasst wie mit Kushners schriftstellerischen Grundlagen und Wurzeln.
Das Buch enthält Texte über Jeff Koons, Denis Johnson und Marguerite Duras, über den Besuch in einem palästinensischen Flüchtlingslager, ein illegales Motorradrennen in Baja California, die wilden Streiks im Italien der Siebzigerjahre, ihre Liebe zu Oldtimern und ihr Leben als Jugendliche in der Musikszene von San Francisco. Es schließt mit einem Finale furioso: einem wilden Manifest über «harte Leute».
Zwanzig rasiermesserscharfe Essays von einer der großen Stimmen der zeitgenössischen US-Literatur.
Das Buch enthält Texte über Jeff Koons, Denis Johnson und Marguerite Duras, über den Besuch in einem palästinensischen Flüchtlingslager, ein illegales Motorradrennen in Baja California, die wilden Streiks im Italien der Siebzigerjahre, ihre Liebe zu Oldtimern und ihr Leben als Jugendliche in der Musikszene von San Francisco. Es schließt mit einem Finale furioso: einem wilden Manifest über «harte Leute».
Zwanzig rasiermesserscharfe Essays von einer der großen Stimmen der zeitgenössischen US-Literatur.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
In spannungsreichen, schwebenden Assoziationsketten erzählt Rachel Kushner aus ihrem Leben, verrät Rezensent Jörg Häntzschel über den Essayband "Harte Leute", dessen Protagonistin er ebenfalls als eine solche Person charakterisiert. Er staunt darüber, wie sie in allen Texten nur ein einziges Mal weint, bei einem Motorradunfall, obwohl sie einiges Wildes berichtet: Von der Hippie-Szene in San Francisco über ein Jerusalemer Flüchtlingslager bis hin zu Begegnungen mit diversen Akteur*innen aus dem Kulturbereich - nicht wenige tragische Schicksale kommen dabei vor, so Häntzschel. Er ärgert sich dabei zwar über einige Schnitzer in der Übersetzung, findet Kushners Texte aber dennoch kunstreich gestaltet und auch untereinander verwoben. Eine deutliche Empfehlung von Häntzschel.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Wer verstehen will, was in den USA geschieht, der sollte Rachel Kushner lesen. Claus-Jürgen Göpfert Frankfurter Rundschau 20221128
Einen wilden Ritt durch die USA (nicht nur) der Siebziger, durch ihre Persönlichkeit und die titelgebenden "Harten Leute", die sich vom Schrecken Amerikas nicht einschüchtern lassen, hat Claus-Jürgen Göpfert mit Rachel Kushner unternommen. Um Drogen und Hippies in San Francisco gehe es, um einen Motorradunfall, um Kunst und Kultur in New York. Temporeich findet der Rezensent das, und höchst interessant noch dazu, besonders, wenn die Autorin sich auf sich selbst zu besinnen beginnt und sich von den "harten Leuten" abgrenzt. "Kushner lesen", empfiehlt Göpfert überzeugt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH