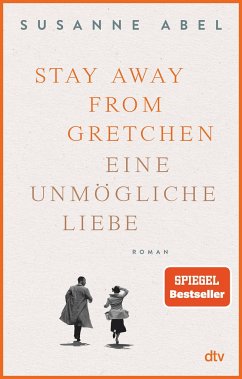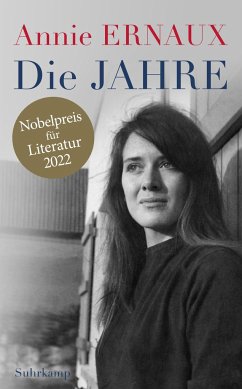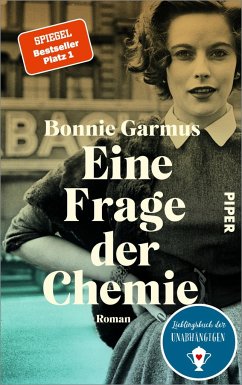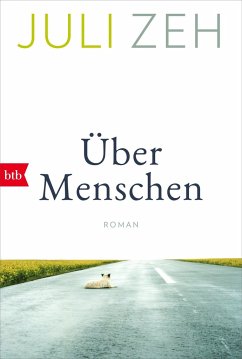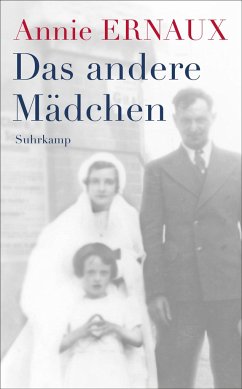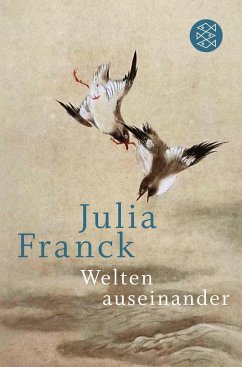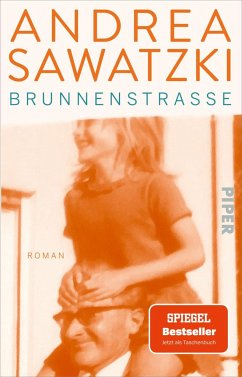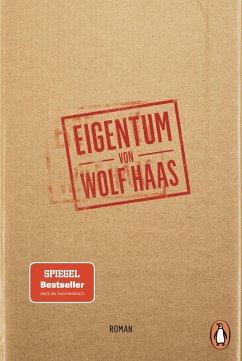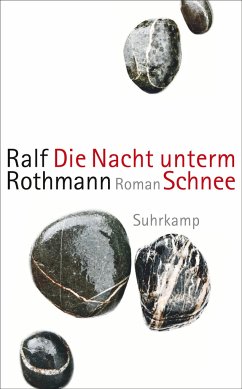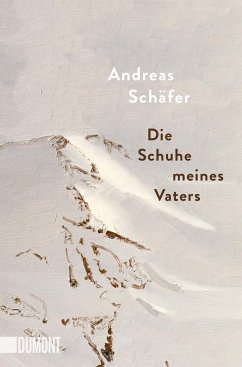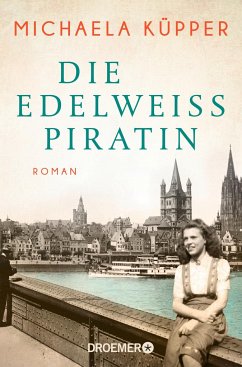Edgar Selge
Broschiertes Buch
Hast du uns endlich gefunden
Der preisgekrönte SPIEGEL Bestseller als Taschenbuch
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Das literarische Debüt von Edgar Selge: Ein Zwölfjähriger erzählt seine Geschichte zwischen Gefängnismauer und klassischer Musik. Exemplarisch und radikal persönlich.Eine Kindheit um 1960, in einer Stadt, nicht groß, nicht klein. Ein bürgerlicher Haushalt, in dem viel Musik gemacht wird. Der Vater ist Gefängnisdirektor. Der Krieg ist noch nicht lange her, und die Eltern versuchen, durch Hingabe an klassische Musik und Literatur nachzuholen, was sie ihre verlorenen Jahre nennen.Überall spürt der Junge Risse in dieser geordneten Welt. Gebannt verfolgt er die politischen Auseinanderset...
Das literarische Debüt von Edgar Selge: Ein Zwölfjähriger erzählt seine Geschichte zwischen Gefängnismauer und klassischer Musik. Exemplarisch und radikal persönlich.
Eine Kindheit um 1960, in einer Stadt, nicht groß, nicht klein. Ein bürgerlicher Haushalt, in dem viel Musik gemacht wird. Der Vater ist Gefängnisdirektor. Der Krieg ist noch nicht lange her, und die Eltern versuchen, durch Hingabe an klassische Musik und Literatur nachzuholen, was sie ihre verlorenen Jahre nennen.
Überall spürt der Junge Risse in dieser geordneten Welt. Gebannt verfolgt er die politischen Auseinandersetzungen, die seine älteren Brüder mit Vater und Mutter am Esstisch führen. Aber er bleibt Zuschauer. Immer häufiger flüchtet er sich in die Welt der Fantasie.
Dieser Junge, den der Autor als fernen Bruder seiner selbst betrachtet, erzählt uns sein Leben und entdeckt dabei den eigenen Blick auf die Welt. Wenn sich der dreiundsiebzigjährige Edgar Selge gelegentlich selbst einschaltet, wird klar: Die Schatten der Kriegsgeneration reichen bis in die Gegenwart hinein.
Edgar Selges Erzählton ist atemlos, körperlich, risikoreich. Voller Witz und Musikalität. Ob Bach oder Beethoven, Schubert oder Dvorák, Marschmusik oder Gospel: Wie eine zweite Erzählung legt sich die Musik über die Geschichte und begleitet den unbeirrbaren Drang nach Freiheit.
Eine Kindheit um 1960, in einer Stadt, nicht groß, nicht klein. Ein bürgerlicher Haushalt, in dem viel Musik gemacht wird. Der Vater ist Gefängnisdirektor. Der Krieg ist noch nicht lange her, und die Eltern versuchen, durch Hingabe an klassische Musik und Literatur nachzuholen, was sie ihre verlorenen Jahre nennen.
Überall spürt der Junge Risse in dieser geordneten Welt. Gebannt verfolgt er die politischen Auseinandersetzungen, die seine älteren Brüder mit Vater und Mutter am Esstisch führen. Aber er bleibt Zuschauer. Immer häufiger flüchtet er sich in die Welt der Fantasie.
Dieser Junge, den der Autor als fernen Bruder seiner selbst betrachtet, erzählt uns sein Leben und entdeckt dabei den eigenen Blick auf die Welt. Wenn sich der dreiundsiebzigjährige Edgar Selge gelegentlich selbst einschaltet, wird klar: Die Schatten der Kriegsgeneration reichen bis in die Gegenwart hinein.
Edgar Selges Erzählton ist atemlos, körperlich, risikoreich. Voller Witz und Musikalität. Ob Bach oder Beethoven, Schubert oder Dvorák, Marschmusik oder Gospel: Wie eine zweite Erzählung legt sich die Musik über die Geschichte und begleitet den unbeirrbaren Drang nach Freiheit.
Edgar Selge gehört zu den bedeutendsten Charakterdarstellern Deutschlands. 1948 geboren, wuchs er im ostwestfälischen Herford als Sohn eines Gefängnisdirektors auf. Seine Schauspielausbildung schloss er 1975 an der Otto Falckenberg Schule in München ab. Zuvor studierte er Philosophie und Germanistik in München und Dublin sowie klassisches Klavier in Wien. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Edgar Selge lebt mit der Schauspielerin Franziska Walser zusammen. Die beiden haben zwei Kinder.
Produktdetails
- Verlag: Rowohlt TB.
- 9. Aufl.
- Seitenzahl: 304
- Erscheinungstermin: 14. März 2023
- Deutsch
- Abmessung: 189mm x 125mm x 26mm
- Gewicht: 275g
- ISBN-13: 9783499000966
- ISBN-10: 3499000962
- Artikelnr.: 66203735
Herstellerkennzeichnung
Rowohlt Taschenbuch
Kirchenallee 19
20099 Hamburg
produktsicherheit@rowohlt.de
Ein sensationelles literarisches Debüt... «Hast du uns endlich gefunden» würde als Roman einer deutschen Nachkriegsjugend durchgehen oder als Familienstudie eines Bildungsbürgertums mit Generationenbruch; oder als ein Buch über die Wiedererlangung des eigenen Kindheitsgefühls, wie es Annie Ernaux oder Didier Eribon geschrieben haben. Dahingehend ist Edgar Selge ein Hit gelungen: im Auflebenlassen einer unbestechlichen Kindheit. Margarete Affenzeller Der Standard 20211125
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Bewegt liest Rezensentin Claudia Ingenhoven den ersten Roman des Schauspielers Edgar Selge, der ihr hier fiktionalisiert aus seiner Kindheit erzählt. Sie blickt mit dem zwölfjährigen Edgar in eine Kindheit in Westfalen in den fünfziger und sechziger Jahren und erlebt das strenge Regiment der Eltern - der Vater ist Gefängnisdirektor und "tobt sich an Edgar aus", resümiert Ingenhoven. Die Kritikerin spürt die jahrelange Arbeit, die Selge in dieses Buch gesteckt hat deutlich: Geradezu körperlich erfahrbar erscheinen ihr Edgars Erfahrungen. Nicht zuletzt lobt sie, wie der Autor immer wieder Reflexionen aus der Distanz des Alters einflicht und sich mit Witz und Offenheit den eigenen Gefühlen stellt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»[Edgar Selge] zuzuhören, wie er als reifer Mann noch einmal in seine eigenen Kinderschuhe schlüpft und in den Flur, das Klavierzimmer, die Nachbarhäuser der Nachkriegszeit trippelt, das hat gleichermaßen erzählerische wie darstellerische Größe.« Sabine Busch-Frank Passauer Neue Presse 20220427
Wie nannte er das Werk? "Biografische Fiktion"? Einerseits gut zu lesen, trotz der etwas ermüdenden Einseitigkeit, Ichbezogenheit hauptsächlich in Bezug auf das große Trauma: Der prügelnde Vater, mit dem er aber auch lachen kann. Ob dessen sexuelle Versuche bei den …
Mehr
Wie nannte er das Werk? "Biografische Fiktion"? Einerseits gut zu lesen, trotz der etwas ermüdenden Einseitigkeit, Ichbezogenheit hauptsächlich in Bezug auf das große Trauma: Der prügelnde Vater, mit dem er aber auch lachen kann. Ob dessen sexuelle Versuche bei den älteren Brüdern weiterkamen, bekommt der Leser nicht heraus. Sollen Krieg, juristische Bildung, musikalisches Talent den Familientyrannen, der sich hinter völkisch geprägter Erziehungsideologie versteckt, entschuldigen? Anfangs mehr in Kindersprache, als später. Natürlich kann der vorletzte Sohn der Eltern stolzes Mitmachen nicht beschreiben, aber er hätte erzählen können, was seine Brüder darüber wussten. Passend dazu die Magenstiche der Mutter, deren Leben in einem schwachen Moment die Wendung in die persönliche Sackgasse nimmt. Aber ab wann erkennt sie die, regelmäßig einmal im Jahr?
Trotz wertvoller Stellen, meist flapsig formuliert, wirkt alles fragmentarisch, darstellend, ohne Antworten, Deutungen, Festlegungen - butterweich.
Gelungen ist die Musikbeschreibung zu Dvoraks Cellokonzert, das Werner übt, aber vielleicht auch nur weil ich es gut im Kopf habe.
Wie immer spart die scheinbar gepflegte Offenheit auch Dinge aus, über die man trotz aller freimütiger anderer Erzählungen nichts verlauten lässt. Da wirkt Scham. Warum manchmal ehrlich, aber bei anderen Schilderungen nicht?
So sehr diese Selbsterkenntnis mutig und soweit sie bewundernswert ist, sowenig ist es literarisch, zu sehr wird die Fiktion durch Realismus verwischt.
Der Verkauf lebt natürlich von der Fernsehbekanntheit und die harmlose, unkritische Nennung von Coronamaßnahmen, ist ein weiterer Hinweis auf Feigheit, unter der seine Eltern nicht litten.
Vielleicht liegt da der direkte Wert? Die Elternart des "damals kann nicht alles falsch gewesen sein", gibt ihm keine Idee, von dem, was in der alten Bundesrepublik mit Grundgesetz, freier Meinungsäußerung und öffentlich-rechtlichem Rundfunk auch nicht falsch gewesen sein kann, er aber ohne Rührung aufgegeben hat.
Eine Feigheit im Mut der Bekenntnis, wie soll man bewerten? Also kein Vergleich zu Juli Zeh, was weiteren Punktabzug in Sachen Glaubwürdigkeit ergibt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Hörbuch-Download MP3
Momentan ist es sehr beliebt, sich autobiografisch mit seinem Leben auseinanderzusetzen - was dem Leser wiederrum neben tiefen privaten auch Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt des Autors ermöglicht.
Nun also das Buch "Hast du uns endlich gefunden" des bekannten …
Mehr
Momentan ist es sehr beliebt, sich autobiografisch mit seinem Leben auseinanderzusetzen - was dem Leser wiederrum neben tiefen privaten auch Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt des Autors ermöglicht.
Nun also das Buch "Hast du uns endlich gefunden" des bekannten Schauspielers Edgar Selge.
In Erwartung der durch den Titel suggeriertenThematik war der Einstieg für mich recht zäh und ich war kurz davor abzubrechen. Zum Glück habe ich mich jedoch durchgerungen weiter zu hören, denn mit dem Hörfortschritt wurde das Buch für mich zunehmend interessanter. Eine Verbindung des Titels mit dem Inhalt konnte ich jedoch nicht wirklich herstellen.
Nach dem etwas unspektakulären Einstieg mit der Arbeits- und Familiensituation dringt der Autor immer tiefer in die Problematik der Nachkriegsjahre, in der neue politische Ausrichtungen mit der Vergangenheit, explizit bestimmten Personen, korrelieren, alle alten Werte falsch plötzlich falsch sind und man seinen Platz erst wieder finden muss. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Eltern, deren tief verwurzelten Ansichten immer wieder zu Konflikten mit den Söhnen führen, die auch über die Vergangenheit reden wollen, anstatt sie totzuschweigen. Es wird sehr deutlich, das es noch ein weiter und schwerer Weg sein wird, sich diesem Thema unbefangen stellen zu können, die Auswirkungen des Krieges noch lange in die Gegenwart ausstrahlen werden.
Der Autor liest sein Buch selbst - und das ist in meinen Augen (oder wohl besser Ohren) sehr gelungen. Es ist vor allem die angenehme Stimme des alten Mannes, der zurückblickend mit viel Schalk von seiner Kindheit und Jugend erzählt, die sehr fesselt. Dadurch wirken die Schilderungen sehr authentisch.
Hatte ich anfänglich noch Schwierigkeiten mit dem Buch, war ich zum Schluss schon fast traurig, das es zu Ende war. Ich hätte Edgar Selge noch ewig zuhören können.
Weniger
Antworten 8 von 8 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 8 von 8 finden diese Rezension hilfreich
MP3-CD
Die Erinnerungen des Schauspielers Edgar Selge beginnen1958, als er 10 Jahre alt war.
Er erzählt von seiner Kindheit. Ganz zentral im Blickpunkt stehen dabei seine Eltern, vor allen sein charismatischer Vater, ein Direktor eines Jugendgefängnisses, der sich sehr um seine jugendlichen …
Mehr
Die Erinnerungen des Schauspielers Edgar Selge beginnen1958, als er 10 Jahre alt war.
Er erzählt von seiner Kindheit. Ganz zentral im Blickpunkt stehen dabei seine Eltern, vor allen sein charismatischer Vater, ein Direktor eines Jugendgefängnisses, der sich sehr um seine jugendlichen Insassen kümmert.
Edgar Selge liest den Text selber ein und dadurch wird umso mehr die Sympathie spürbar, die er für seine Familie empfand, aber auch für das nicht immer brave Kind, das er war.
Klassische Musik ist in der Familie wichtig, auch für Edgar, aber mehr noch lebt er für das Schauspiel und er schildert viele Passagen als kleine Dramen und fast immer voller Witz.
Manchmal sind aber auch ernste Themen dabei, z.B. Edgars schwierige Beziehung zum Vater. Er wurde als Kind häufig vom Vater geschlagen wurde oder immer wieder die schwierige Vergangenheitsbewältigung.
Die sechziger Jahre werden spürbar.
Als Zuhörer ist man stark von den Episoden gefangengenommen.
Es sind Erinnerungen von Ausmaßen eines Marcel Proust, aber mit Tempo und sehr unterhaltsam. Die 8,5 Stunden Spieldauer des Hörbuchs vergehen wie im Flug.
Weniger
Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Es ist 1960, der Zweite Weltkrieg ist noch gar nicht so lange her, der zwölfjährige Edgar lebt mit Eltern, den älteren zwei Brüdern Werner und Martin sowie dem jüngeren Andreas neben der Jugendstrafanstalt, in der sein Vater Gefängnisdirektor ist. Musik spielt in der …
Mehr
Es ist 1960, der Zweite Weltkrieg ist noch gar nicht so lange her, der zwölfjährige Edgar lebt mit Eltern, den älteren zwei Brüdern Werner und Martin sowie dem jüngeren Andreas neben der Jugendstrafanstalt, in der sein Vater Gefängnisdirektor ist. Musik spielt in der Familie eine große Rolle, täglich wird musiziert und regelmäßig werden Hauskonzerte veranstaltet. Edgar ist ein neugieriges Kind, das aber trotzdem lieber für sich bleibt und in seiner Phantasiewelt lebt. Der vergangene Krieg wird ungerne thematisiert und falls doch, führt dies regelmäßig zu Streitgesprächen zwischen dem Vater und den älteren zwei Brüdern.
Eine ungewöhnliche Erzählweise hat der Autor gewählt. Der zwölfjährige Edgar weicht manchmal dem älteren Mann, zu dem er herangewachsen ist, der sich darüber mokiert, aufgrund der Pandemie geschützt werden zu müssen. Dies geschieht fließend, manchmal mitten im Kapitel, ist aber nie verwirrend oder lässt mich im Unklaren zurück. Es ist, als ob Edgar mir seine Geschichte erzählt und jeden Gedanken, der ihn ereilt, sofort verfolgen und mir darlegen muss. Es sind raue Zeiten, die Erziehung hart und nicht immer kindergerecht. Dazu kommt, dass Edgar kein einfaches Kind ist, seltsam entrückt und eigensinnig ist er, lügt, stiehlt und sieht sich meistens im Recht. Natürlich rechtfertigt dies alles nicht, gezüchtigt zu werden. Es sind andere Zeiten, rau und ungerecht.
„Ich will nicht zugeben, von jemandem geschlagen zu werden, den ich liebe. Und noch weniger will ich zugeben, dass seine Schläge meine Liebe nicht ausgelöscht haben. Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt.“ (Seite 131)
Edgar testet immer wieder seine Grenzen aus, als Kind bereits, aber auch immer noch als erwachsener Mann. Die Aufarbeitung der Vergangenheit seiner Eltern ist ihm wie ein Zwang, auch hier übertritt er Grenzen, ist sich dessen bewusst und bereut, um es das nächste Mal genauso zu machen.
„Seine Angst geht mir nahe. Und ihre Pflichterfüllung, ihre nicht ausgelebte Wut über diese Pflichterfüllung, erschreckt mich so sehr, dass ich ihre Liebe ganz vergesse.“ (Seite 237)
Was für ein wunderbares Buch, ganze Sätze wollte ich markieren, rausschreiben und behalten. Die Erzählweise ist so intensiv, so eindringlich, oft war es für mich sehr emotional und schwer auszuhalten, wenn es erzählt, dieses manchmal so undurchschaubare Kind. Edgar urteilt nicht, weder verurteilt, noch beurteilt er. Er erzählt und stellt fest, er spricht zum toten Vater, erklärt gedanklich etwas einem der Brüder, er reflektiert sein Verhalten und stellt sich so bloß. Dies ist dermaßen interessant und spannend, dass ich gerne weiter zugehört, dringend weitere Episoden erfahren hätte aus seinem Leben. Ich wäre für eine Fortsetzung bereit. Volle Punktzahl und eine Leseempfehlung gibt es dafür von mir.
Weniger
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Hörbuch-Download MP3
„Edgar Selge … wer ist das nochmal?“ Der Name sagte mir nichts, da musste ein Bild her. Gesagt, getan und wer grinste mir da auf einmal ganz verschmitzt entgegen? Der einarmige Polizeiruf 110 Kommissar Jürgen Tauber! Und schon wurde die Sache höchstinteressant, denn er …
Mehr
„Edgar Selge … wer ist das nochmal?“ Der Name sagte mir nichts, da musste ein Bild her. Gesagt, getan und wer grinste mir da auf einmal ganz verschmitzt entgegen? Der einarmige Polizeiruf 110 Kommissar Jürgen Tauber! Und schon wurde die Sache höchstinteressant, denn er hat seinen autofiktionalen Roman nicht nur selbst geschrieben, sondern auch selbst gelesen. Meist geht das schief, denn Autoren sind keine Sprecher, wie eben auch Sprecher keine Autoren sind. Anders gelagert ist das bei Edgar Selge, der dank seiner fundierten Schauspielausbildung durchaus vortragen kann. So erzählt er dann über unterhaltsame achteinhalb Stunden die Geschichte seiner Familie und welche Rolle ihm darin zuteilwurde. Oft reduzierte sie sich ein wenig auf die des Außenstehenden. Zu jung, um mit dem Vater Debatten zu führen und wiederum zu alt, um Mutters Nesthäkchen zu sein. Auch leidet er oft unter der Strenge der Eltern, besonders der des Vaters, der gerne auch mal den Gürtel als Mittel der Bestrafung wählt. Der Vater führt schon von Berufswegen ein unnachsichtiges Regiment und zeigt selten emotionale Regungen. Zuhause fünf Söhne und im Gefängnis ein ganzes Regiment von Delinquenten, da schien ihm ein hartes Durchgreifen erforderlich. Die Familie ist aber auch geprägt durch ihr wunderbares musikalisches Talent und die vielen Hauskonzerte, die regelmäßig stattfinden und so wächst der junge Edgar zwischen Butterbrot und Peitsche auf, muss denn herben Verlust zweier Brüder verschmerzen und so ganz nebenbei auch noch zu sich selbst finden.
Ich habe es geliebt ihm zuzuhören, war nicht eine Minute gelangweilt oder gar enttäuscht und vergebe gerne mit fünf Sternen die Bestnote. Wer Edgar Selge auf seine Rolle des Kommissars reduziert, tut ihm wirklich unrecht. Er ist ein intelligenter und ehrgeiziger Mensch, der stets auch das Wohl der anderen im Sinn hat. Ich habe mich jedenfalls gefreut, durch das Hörbuch nähere Bekanntschaft mit ihm gemacht zu haben und empfehle sein Buch – besonders in der Hörbuchfassung - gerne weiter.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für