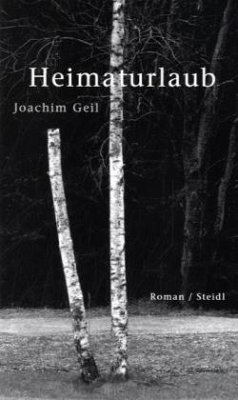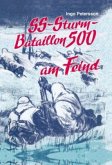Eine Woche Heimaturlaub hat Leutnant Dieter Thomas, der im Sommer 1944 von der Ostfront kommt. In der pfälzischen Provinz lebt es sich beschaulich: Der Krieg scheint fern, man glaubt unerschütterlich an den »Endsieg«, im Freibad geht die Zeit dahin. Rasch hat Dieter ein Auge auf Heidi geworfen und Heidi auf ihn.
Doch die Idylle bekommt Risse, denn Dieter wird von einer Erinnerung aus dem russischen Winter heimgesucht. Seine Romanze mit der hübschen Maschenka im Dorf »Malaja Irgendwas« endet mit einem brutalen Übergriff, und in Verzweiflung weiß Dieter nur einen Ausweg: seine Liebe durch einen Mord zu retten.
Außen netter Bursche, innen eine verheerte Seele: Joachim Geil erkundet die verschwiegenen und unterdrückten Gefühle eines Menschen im Krieg. Er schildert die bodenlosen Ängste und inneren Konflikte, die sich keinen Weg bahnen dürfen. Heimaturlaub lässt niemanden unberührt - ein großer Roman über das persönliche Trauma Krieg.
Doch die Idylle bekommt Risse, denn Dieter wird von einer Erinnerung aus dem russischen Winter heimgesucht. Seine Romanze mit der hübschen Maschenka im Dorf »Malaja Irgendwas« endet mit einem brutalen Übergriff, und in Verzweiflung weiß Dieter nur einen Ausweg: seine Liebe durch einen Mord zu retten.
Außen netter Bursche, innen eine verheerte Seele: Joachim Geil erkundet die verschwiegenen und unterdrückten Gefühle eines Menschen im Krieg. Er schildert die bodenlosen Ängste und inneren Konflikte, die sich keinen Weg bahnen dürfen. Heimaturlaub lässt niemanden unberührt - ein großer Roman über das persönliche Trauma Krieg.

Soldaten und Mörder: Joachim Geils psychologisch und sprachlich überragender Kriegsheimkehrerroman
Wenn sich in der tiefen Pfalz die gewichtige Schwere des Alltags auf ihre Bewohner senkt, niederdrückend ihnen das Gefühl verleiht, sie hätten Pudding in den Beinen - "mit Pudding in de Bää, wie Tante Emmy sagen würde" -, ist das doch zugleich ein wenig wie Vermählung mit dem Boden, ein geheimer Magnetismus, der im Innern des schwebenden Begriffs Heimat steckt, der Friede, der ewige, so nah. Zwei Todgeweihte treffen auf dieser Erde im Juni 1944 aufeinander: der Pfarrer Stepp mit dem offenen Rücken, im Angesicht des Todes öffentlich der Wahrheit huldigend ("Er hat die Welt angezündet") und daher bereits von seinem Schwiegersohn des Defätismus gegen den Führer angezeigt, und sein Enkel, der junge Leutnant Dieter Thomas, der auf eine Woche die Ostfront verlassen darf, Heimaturlaub, und von seinem eigenen Ende allenfalls im Verborgenen ahnt.
Doch die Ahnung ist da, schon auf der ersten Seite des Buches, in der betäubenden Schwüle dieses Sommers steckt sie: "Die Hand zwischen Hals und Uniformkragen, merkt in der kurzen Schlange der blonde Soldat, der einen guten Kopf größer ist als alle anderen Wartenden, dass es keinen Sinn hat, die feuchte Hitze entweichen zu lassen. Wo soll sie hin, wenn sie von feuchter Hitze umgeben ist?"
Kühlung ist nicht mehr möglich inmitten der überheizten Maschinerie, die Frage ist einzig, wann sie durchbrennt, wann alles verglüht. Der sterbende Großvater, ein Menetekel: "Der Tod hat hier etwas Getragenes und Besonderes, hier wird ein Tod gestorben, der sich ankündigt und alle in seinen Bann zieht." Der dunklen Wahrheit versucht der junge Kämpfer - "So gesehen ein Held" - noch einmal zu entfliehen ("Man denkt ans Wichtige: Schwimmbad, Erdbeeren, was Kühles trinken. Ach, wird das schön"), wird aber immer gnadenloser von ihr heimgesucht, ja, heimgedrängt. Aber seine Heimat, die ist längst nicht mehr dort, wo er herkommt, wie bei so vielen traumatisierten Kriegsheimkehrern.
Tief blicken wir mit Dieter in diesen Dieter hinein, ganz allmählich durch die Schizophrenie hindurch, die seiner Schuldverstrickung folgte, denn was der Autor Joachim Geil mit großem Sprachgespür und psychologischem Feinsinn entworfen hat, dieser Debütroman, ist über weite Strecken ein fulminanter, zwanghaft um ein Geheimnis kreisender innerer Monolog eines Schuldigen, in dem zwei Instanzen im Widerstreit miteinander liegen, zweimal Dieter also, ein heimlicher und ein unheimlicher. Die Bruchlinie verläuft jedoch nicht oder zumindest nicht allein zwischen dem liebenswerten Zivilisten und dem nationalsozialistischen Barbaren, denn auch vor seinen sengenden und mordenden Kameraden hat er ein Geheimnis. Das macht diesen Roman so interessant und enthebt ihn ein Stück weit der gleichwohl präzisen historischen Verortung. Zeitlos jedenfalls scheint die Frage, ob man die Tat des Leutnants, so unverzeihlich sie ist, verstehen kann.
Im pfälzischen Urlaub geht der Protagonist eine Affäre ein mit der schönen, wortgewandten und glühend rassistischen Majorstochter Heidi, gerät ins Träumen, malt sich gar Zukünfte aus, und auch die eigene Familie, die vielen Tanten und Cousinen, für die er "der liebe Dieter" ist, macht ihm Freude. Schwimmbadbesuche stehen täglich an, doch nicht nur mit den Sommerregengüssen kommt die Räson zurück, auch dadurch, dass ihn die Hand des sterbenden Großvaters ergreift. Als Liebhaber versagt er kläglich. So nimmt Dieter plötzlich die Axt und schlägt der Tante den Arm ab, danach den Hals, dann wirft er den Zucht und Auslese von Tomaten perfektionierenden Onkel Gustav zu Boden und treibt ihm einen spitzen Pfahl durch die Gedärme, ertränkt die geliebten zappelnden Kinder, zerbricht knackend Genicke, zerhackt und zertrümmert wahllos das Leben von Verwandten und Fremden, tut all das natürlich nicht wirklich, aber wer von solchen Vorstellungen geplagt wird, der hat offensichtlich mehr zu verarbeiten als Todesangst: Er hat gemordet, und zwar aus Liebe, er hat das Geliebte ermordet und sich eingeredet, es sei ein Gnadenerweis gewesen. "Jetzt kann er nicht mehr."
Schuld und Vergebung ist das große Thema des Buches. "Ich bin bei dir. Ich verzeih' dir", die Worte der Großmutter, die Dieter auch die Mutter ersetzen musste, bilden denn auch die Schlüsselstelle: "Verzeihen? Was? Was verzeihen? Fünfjährige treue Pflichterfüllung? Dieter versteht nicht recht." Doch, natürlich versteht er: "Weiß, was sie meint. Weiß nur zu genau, was sie meint", auch wenn er nicht weiß, ob das funktionieren kann mit dem Verzeihen, auch wenn er nicht weiß, ob das funktionieren kann mit der Fahnenflucht, die ihm der Großvater nahelegt - und er wählt schließlich seinen eigenen Weg. Vor den Erinnerungen lässt sich nicht desertieren.
Eingeführt wird die Geschichte über eine etwas vertrackte Quellenfiktion: Ein Gegenwartserzähler nämlich tritt mit auktorialer Geste auf, erkundet anhand von Briefen die Vergangenheit der eigenen Familie, stößt auf einen Onkel, von dem außer den Feldpostbriefen nichts bekannt ist. Diese Zwischenschaltung einer Erzählerebene, die zwar autobiographisch gedeckt ist, wie Joachim Geil im Interview erklärt, fügt der Handlung bedauerlicherweise keine Dimension hinzu. Dieser Erzähler bleibt blass, er verschwindet mitsamt seiner Zeitebene nach und nach aus dem Geschehen.
Dass die Handlung stark konstruiert wirkt, ist an sich noch kein Mangel, immerhin handelt es sich um eine exemplarische Fabel. Und doch hätte es vielleicht nicht immer der maximalen Pegelausschläge bedurft: Die junge russische Geliebte ("Verliebt hat er sich, verliebt in ein Russenmädchen") ist natürlich eine wahre Heilsgestalt, die sich Dieter nach einer rituell anmutenden Waschung nicht nur jungfräulich hingibt, sondern ihm auch noch unter Lebensgefahr die Haut rettet. Und natürlich durchläuft ihre Schändung alle Stadien des Grauens, metzelt man alle Bewohner ihres Dorfes hin und wirft sie der Kompanie zum Fraß vor, und natürlich ist Dieter der Letzte, der sich an der zerfetzten Beute gütlich tun soll und plötzlich erkennt, wen er da vor sich hat. Diese Überdeutlichkeit setzt sich in der Symbolik fort, wenn etwa der Blitz just in den Baum einschlägt, unter dem Dieter Schutz sucht und unschuldige Nüsse tötet: "Unreif. Reif wären sie erst im Oktober, dann kann man sie aufheben, aufsammeln, trocken lagern und zu Nusskuchen verarbeiten. Aber nicht jetzt. Viel zu früh."
Aber trotz dieser beiden kleinen Einschränkungen, der Unmotiviertheit der Rahmenhandlung und der leichten Überzeichnung, ragt das Buch des in Köln lebenden Kurators und Lektors aufgrund seiner erzählerischen Souveränität und erstaunlichen Sprachkraft deutlich aus der großen Masse der Debüts hervor. In seiner subtilen Widerlegung aller Kollektivschuldphantasmen ist diese so berührend einfühlsam geschilderte Geschichte zugleich ein radikaler Antikriegsroman - und schon daher nach wie vor nötig in einer Gesellschaft, die Kriege als Mittel der Politik anerkennt.
OLIVER JUNGEN
Joachim Geil: "Heimaturlaub". Roman. Steidl Verlag, Göttingen 2010. 290 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensent Dieter Hildebrandt liest Joachim Geils Debütroman mit ambivalenten Gefühlen. Er begibt sich mit dem Autor auf Russlandfeldzug und auf Heimaturlaub und beobachtet, dass der Autor die Geschichte des Romanhelden, die er erzählt, "überhaupt erst verstehen lernen will". Bei manchen Passagen über die Traumata des jungen Soldaten fragt sich der Rezensent, ob er vor "Szenen von expressionistischer Wucht" steht, oder ob der Autor schlicht am Unsagbaren scheitert. Entschieden ist er jedoch, wenn es um die "Glaubwürdigkeit" geht, die dem Protagonisten fehlt. In jedem Fall aber ein lesenswertes Erstlingswerk, findet Hildebrandt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH