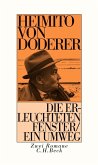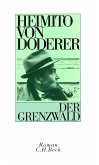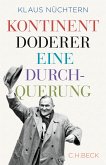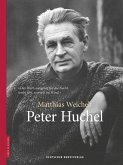Ein Kauz, der gern mit Pfeil und Bogen posierte, zur sexuellen Stimulation mittelalterliche Märtyrerszenen nachspielte - Samtpeitsche inklusive - und bei Wutanfällen Teekannen exekutierte: Bis in seine Fünfziger lag das verwöhnte Nesthäkchen noch seiner reichen Familie auf der Tasche. Dann wurde der österreichische Schriftsteller Heimito von Doderer (1896-1966) mit außergewöhnlichen Romanen und Erzählungen blitzartig berühmt. Eva Menasse plädiert leidenschaftlich für die Wiederentdeckung von Doderers vielgestaltigem Werk, das größte Gegensätze mühelos verbindet. Es ist formal avanciert, wahnsinnig komisch und sprachlich bildschön.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Heimito von Doderer ist das, was man im Englischen einen author's author nennt, einen Schriftsteller, der von seinen Kollegen bewundert, gewiss auch beneidet wird. Die Liste seiner Verehrer ist lang und divers: Martin Mosebach, Daniel Kehlmann, Uwe Tellkamp, Jenny Erpenbeck, Ror Wolf, um nur einige Lebende zu nennen, die nicht einmal österreichische Landsleute von Doderer sind. Doch eine schreibende Landsmännin muss unbedingt Erwähnung finden, weil sie zum fünfzigsten Todes- und 120. Geburtstag Doderers, die beide in dieses Jahr fallen, die schönste Publikation zu bieten hat: Eva Menasse ("Heimito von Doderer". Leben in Bildern. Hrsg. von Dieter Stoltz. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2016. 88 S., zahlr. Abb., geb., 22,- [Euro]).
Nun ist es nicht so, dass an guten Büchern über diesen Autor Mangel herrschte (erwähnt sei nur Henner Löfflers "Doderer-ABC"), geschweige denn an Doderers eigenen Werken. Bis auf Teile der Tagebücher, die zum Besten gehören, was die Diaristik des zwanzigsten Jahrhunderts zu bieten hat - und das will einiges heißen -, ist das Gesamtwerk lieferbar, darunter die Großromane "Die Strudlhofstiege" und "Die Dämonen", die beide in den fünfziger Jahren erschienen. Mit ihnen knüpfte Doderer wie sonst nur Wolf von Niebelschütz an ein Erzählen an, das nach Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg in deutscher Sprache gar nicht mehr möglich schien: in Eleganz und Wortgewalt wurzelnd, mit melancholischem Blick auf die Vergangenheit, und gerade aus dieser doppelten Tradition heraus ironisch und absolut modern. Spielerisch bei größtem ästhetischen Ernst. Man könnte auch sagen: selbst- und sprachverliebt. Jedenfalls keinesfalls engagierte Literatur. Vielmehr enragierte Literatur auf der Grundlage konservativen Empfindens. Darüber zu spotten war zeitweise geradezu Sport.
Eva Menasse steht nicht für das Gegenteil von Doderer, dafür schreibt sie zu gut. Aber als Autorin mischt sie sich gern in gesellschaftliche Debatten ein. Wie kann sie dann diesen literarischen Schön- und privaten Unruhegeist mit bisweilen peinlichen politischen Verirrungen schätzen? Ganz einfach, sie liebt das Werk, das für sie zu "den schönsten, reichhaltigsten, formal avanciertesten und nicht zuletzt: lustigsten und unterhaltsamsten der Literatur und nicht nur der österreichischen" gehört. Im neuesten Band der Schriftsteller-Bildmonographien des Deutschen Kunstverlags schreibt sie ein halbes Dutzend knapper Essays über Doderer, in denen sie Leben und Werk überzeugend kurzschließt.
Besondere Zuneigung pflegt Eva Menasse zu dem 1962 erschienenen Roman "Die Merowinger". Sie korrigiert den eigenen Bruder Robert Menasse, der das Buch als einen "Witz, zum Roman ausgewalzt" bezeichnete, und fragt sich "unter Lachtränen", worüber "Die Merowinger" am meisten sagten: "über den Autor im Allgemeinen oder Speziellen, über die Nazizeit oder andere mörderische Ideologien, oder gar über das Verhältnis alldessen zueinander". Genau darum geht es auch in ihrer Verneigung vor Doderer. (apl)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main